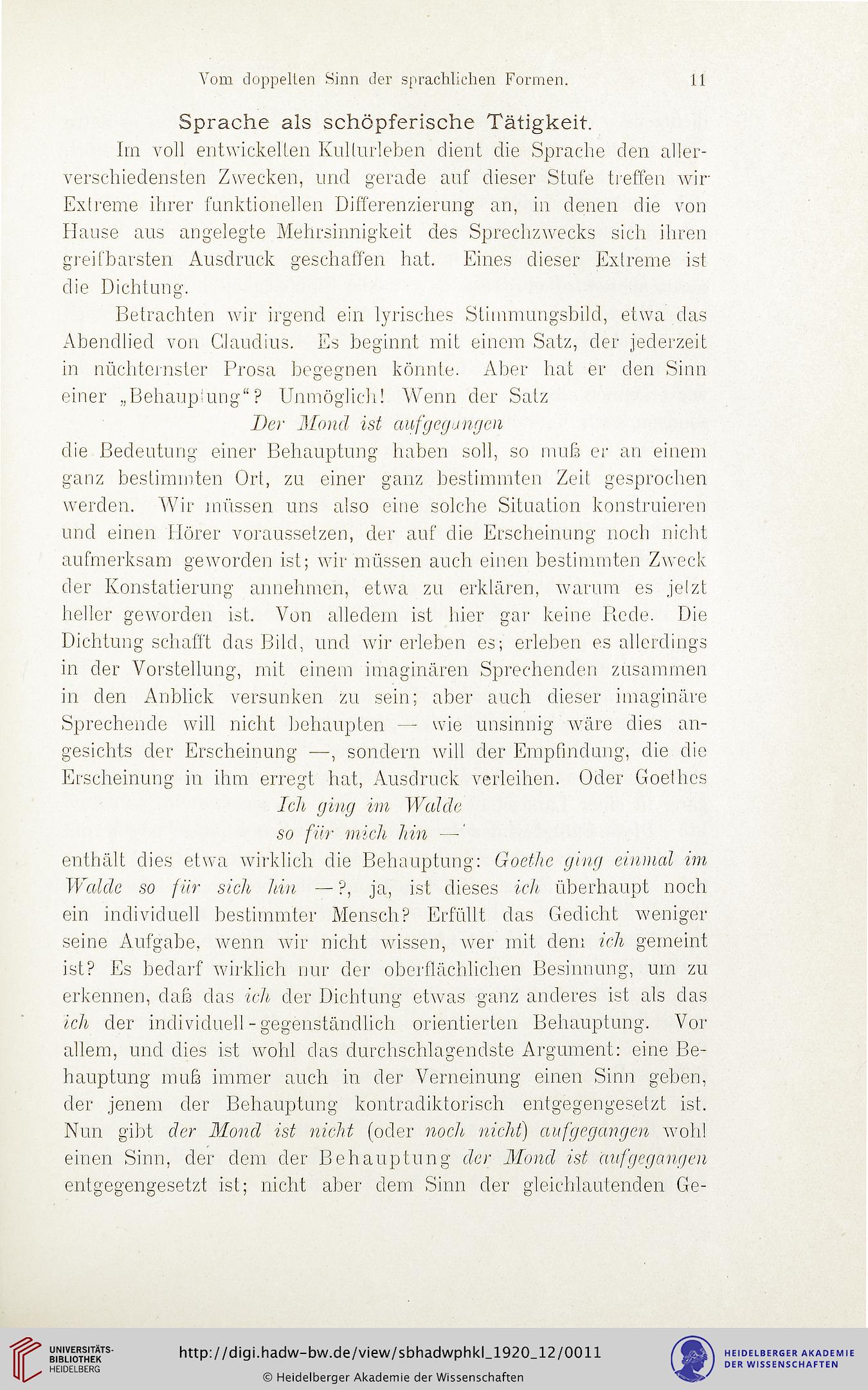Vom doppelten Sinn der sprachlichen Formen.
11
Sprache als schöpferische Tätigkeit.
Im voll entwickelten Kulturleben dient die Sprache den aller-
verschiedensten Zwecken, und gerade auf dieser Stufe treffen wir
Extreme ihrer funktionellen Differenzierung an, in denen die von
Hause aus angelegte Mehrsinnigkeit des Sprechzwecks sich ihren
greifbarsten Ausdruck geschaffen hat. Eines dieser Extreme ist
die Dichtung.
Betrachten wir irgend ein lyrisches Stimmungsbild, etwa das
Abendlied von Claudius. Es beginnt mit einem Satz, der jederzeit
in nüchternster Prosa begegnen könnte. Aber hat er den Sinn
einer „Behauptung“? Unmöglich! Wenn der Satz
Der Mond ist aufgegungen
die Bedeutung einer Behauptung haben soll, so muß er an einem
ganz bestimmten Ort, zu einer ganz bestimmten Zeit gesprochen
werden. Wir müssen uns also eine solche Situation konstruieren
und einen Hörer voraussetzen, der auf die Erscheinung noch nicht
aufmerksam geworden ist; wir müssen auch einen bestimmten Zweck
der Konstatierung annehmen, etwa zu erklären, warum es jetzt
heller geworden ist. Von alledem ist liier gar keine Rede. Die
Dichtung schafft das Bild, und wir erleben es; erleben es allerdings
in der Vorstellung, mit einem imaginären Sprechenden zusammen
in den Anblick versunken zu sein; aber auch dieser imaginäre
Sprechende will nicht behaupten — wie unsinnig wäre dies an-
gesichts der Erscheinung —, sondern will der Empfindung, die die
Erscheinung in ihm erregt hat, Ausdruck verleihen. Oder Goethes
Ich ging im Walde
so für mich hin —’
enthält dies etwa wirklich die Behauptung: Goethe ging einmal im
Walde so für sich hin — ?, ja, ist dieses ich überhaupt noch
ein individuell bestimmter Mensch? Erfüllt das Gedicht weniger
seine Aufgabe, wenn wir nicht wissen, wer mit dem ich gemeint
ist? Es bedarf wirklich nur der oberflächlichen Besinnung, um zu
erkennen, daß das ich der Dichtung etwas ganz anderes ist als das
ich der individuell-gegenständlich orientierten Behauptung. Vor
allem, und dies ist wohl das durchschlagendste Argument: eine Be-
hauptung muß immer auch in der Verneinung einen Sinn geben,
der jenem der Behauptung kontradiktorisch entgegengesetzt ist.
Nun gibt der Mond ist nicht (oder noch nicht) aufgegangen w7ohl
einen Sinn, der dem der Behauptung der Mond ist auf gegangen
entgegengesetzt ist; nicht aber dem Sinn der gleichlautenden Ge-
11
Sprache als schöpferische Tätigkeit.
Im voll entwickelten Kulturleben dient die Sprache den aller-
verschiedensten Zwecken, und gerade auf dieser Stufe treffen wir
Extreme ihrer funktionellen Differenzierung an, in denen die von
Hause aus angelegte Mehrsinnigkeit des Sprechzwecks sich ihren
greifbarsten Ausdruck geschaffen hat. Eines dieser Extreme ist
die Dichtung.
Betrachten wir irgend ein lyrisches Stimmungsbild, etwa das
Abendlied von Claudius. Es beginnt mit einem Satz, der jederzeit
in nüchternster Prosa begegnen könnte. Aber hat er den Sinn
einer „Behauptung“? Unmöglich! Wenn der Satz
Der Mond ist aufgegungen
die Bedeutung einer Behauptung haben soll, so muß er an einem
ganz bestimmten Ort, zu einer ganz bestimmten Zeit gesprochen
werden. Wir müssen uns also eine solche Situation konstruieren
und einen Hörer voraussetzen, der auf die Erscheinung noch nicht
aufmerksam geworden ist; wir müssen auch einen bestimmten Zweck
der Konstatierung annehmen, etwa zu erklären, warum es jetzt
heller geworden ist. Von alledem ist liier gar keine Rede. Die
Dichtung schafft das Bild, und wir erleben es; erleben es allerdings
in der Vorstellung, mit einem imaginären Sprechenden zusammen
in den Anblick versunken zu sein; aber auch dieser imaginäre
Sprechende will nicht behaupten — wie unsinnig wäre dies an-
gesichts der Erscheinung —, sondern will der Empfindung, die die
Erscheinung in ihm erregt hat, Ausdruck verleihen. Oder Goethes
Ich ging im Walde
so für mich hin —’
enthält dies etwa wirklich die Behauptung: Goethe ging einmal im
Walde so für sich hin — ?, ja, ist dieses ich überhaupt noch
ein individuell bestimmter Mensch? Erfüllt das Gedicht weniger
seine Aufgabe, wenn wir nicht wissen, wer mit dem ich gemeint
ist? Es bedarf wirklich nur der oberflächlichen Besinnung, um zu
erkennen, daß das ich der Dichtung etwas ganz anderes ist als das
ich der individuell-gegenständlich orientierten Behauptung. Vor
allem, und dies ist wohl das durchschlagendste Argument: eine Be-
hauptung muß immer auch in der Verneinung einen Sinn geben,
der jenem der Behauptung kontradiktorisch entgegengesetzt ist.
Nun gibt der Mond ist nicht (oder noch nicht) aufgegangen w7ohl
einen Sinn, der dem der Behauptung der Mond ist auf gegangen
entgegengesetzt ist; nicht aber dem Sinn der gleichlautenden Ge-