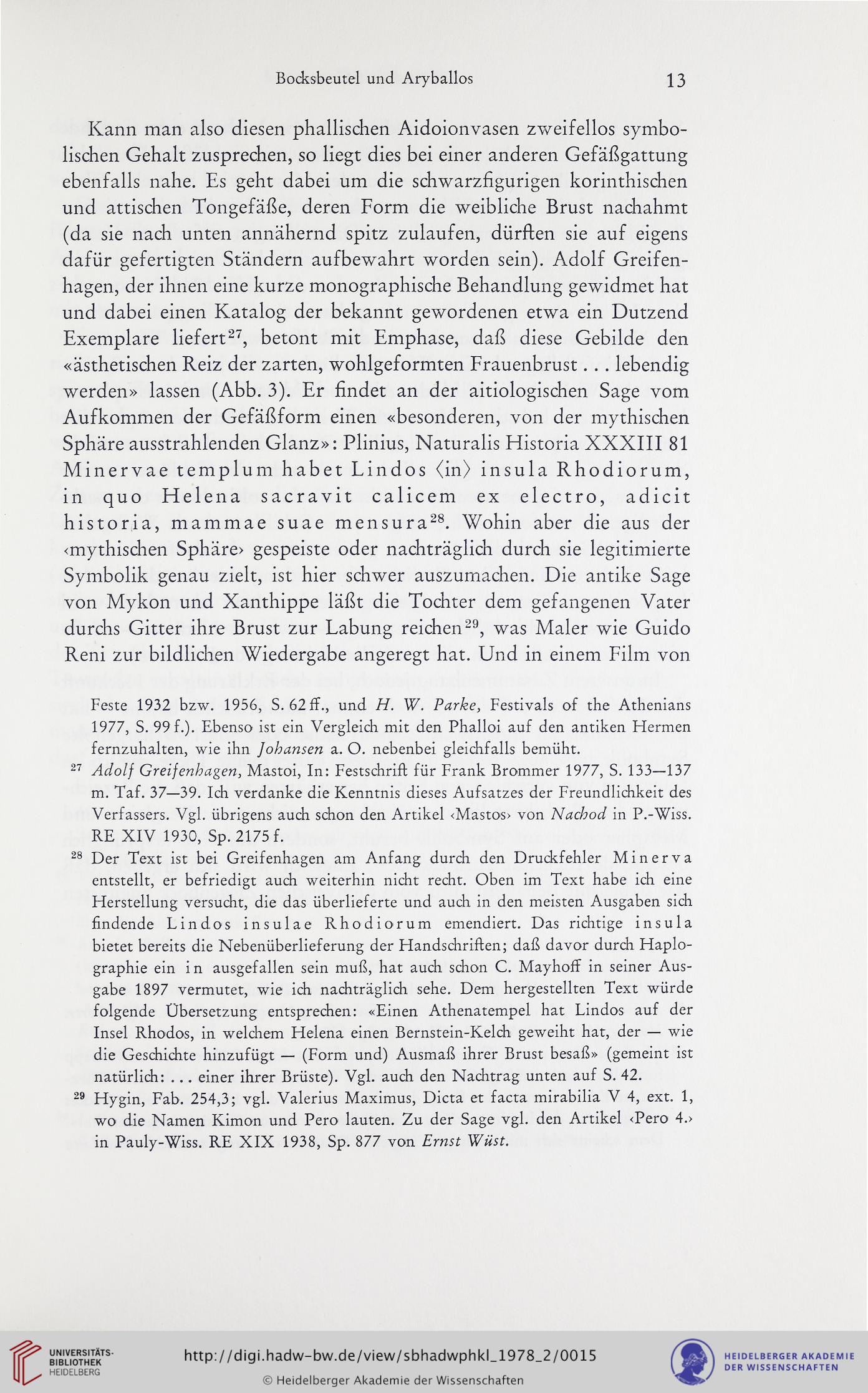Bocksbeutel und Aryballos
13
Kann man also diesen phallischen Aidoionvasen zweifellos symbo-
lischen Gehalt zusprechen, so liegt dies bei einer anderen Gefäßgattung
ebenfalls nahe. Es geht dabei um die schwarzfigurigen korinthischen
und attischen Tongefäße, deren Form die weibliche Brust nachahmt
(da sie nach unten annähernd spitz zulaufen, dürften sie auf eigens
dafür gefertigten Ständern aufbewahrt worden sein). Adolf Greifen-
hagen, der ihnen eine kurze monographische Behandlung gewidmet hat
und dabei einen Katalog der bekannt gewordenen etwa ein Dutzend
Exemplare liefert27, betont mit Emphase, daß diese Gebilde den
«ästhetischen Reiz der zarten, wohlgeformten Frauenbrust. . . lebendig
werden» lassen (Abb. 3). Er findet an der aitiologischen Sage vom
Aufkommen der Gefäßform einen «besonderen, von der mythischen
Sphäre ausstrahlenden Glanz»: Plinius, Naturalis Historia XXXIII 81
Minervae templum habet Lindos (in) insula Rhodiorum,
in quo Helena sacravit calicem ex electro, adicit
historia, mammae suae mensura28. Wohin aber die aus der
<mythischen Sphäre> gespeiste oder nachträglich durch sie legitimierte
Symbolik genau zielt, ist hier schwer auszumachen. Die antike Sage
von Mykon und Xanthippe läßt die Tochter dem gefangenen Vater
durchs Gitter ihre Brust zur Labung reichen29, was Maler wie Guido
Reni zur bildlichen Wiedergabe angeregt hat. Und in einem Film von
Feste 1932 bzw. 1956, S. 62 ff., und H. W. Parke, Festivals of the Athenians
1977, S. 99 f.). Ebenso ist ein Vergleich mit den Phalloi auf den antiken Hermen
fernzuhalten, wie ihn Johansen a. O. nebenbei gleichfalls bemüht.
27 Adolf Greifenhagen, Mastoi, In: Festschrift für Frank Brommer 1977, S. 133—137
m. Taf. 37—39. Ich verdanke die Kenntnis dieses Aufsatzes der Freundlichkeit des
Verfassers. Vgl. übrigens auch schon den Artikel <Mastos> von Nachod in P.-Wiss.
RE XIV 1930, Sp. 2175 f.
28 Der Text ist bei Greifenhagen am Anfang durch den Druckfehler Minerva
entstellt, er befriedigt auch weiterhin nicht recht. Oben im Text habe ich eine
Herstellung versucht, die das überlieferte und auch in den meisten Ausgaben sich
findende Lindos insulae Rhodiorum emendiert. Das richtige insula
bietet bereits die Nebenüberlieferung der Handschriften; daß davor durch Haplo-
graphie ein in ausgefallen sein muß, hat auch schon C. Mayhoff in seiner Aus-
gabe 1897 vermutet, wie ich nachträglich sehe. Dem hergestellten Text würde
folgende Übersetzung entsprechen: «Einen Athenatempel hat Lindos auf der
Insel Rhodos, in welchem Helena einen Bernstein-Kelch geweiht hat, der — wie
die Geschichte hinzufügt — (Form und) Ausmaß ihrer Brust besaß» (gemeint ist
natürlich: ... einer ihrer Brüste). Vgl. auch den Nachtrag unten auf S. 42.
29 Hygin, Fab. 254,3; vgl. Valerius Maximus, Dieta et facta mirabilia V 4, ext. 1,
wo die Namen Kimon und Pero lauten. Zu der Sage vgl. den Artikel <Pero 4.>
in Pauly-Wiss. RE XIX 1938, Sp. 877 von Ernst Wüst.
13
Kann man also diesen phallischen Aidoionvasen zweifellos symbo-
lischen Gehalt zusprechen, so liegt dies bei einer anderen Gefäßgattung
ebenfalls nahe. Es geht dabei um die schwarzfigurigen korinthischen
und attischen Tongefäße, deren Form die weibliche Brust nachahmt
(da sie nach unten annähernd spitz zulaufen, dürften sie auf eigens
dafür gefertigten Ständern aufbewahrt worden sein). Adolf Greifen-
hagen, der ihnen eine kurze monographische Behandlung gewidmet hat
und dabei einen Katalog der bekannt gewordenen etwa ein Dutzend
Exemplare liefert27, betont mit Emphase, daß diese Gebilde den
«ästhetischen Reiz der zarten, wohlgeformten Frauenbrust. . . lebendig
werden» lassen (Abb. 3). Er findet an der aitiologischen Sage vom
Aufkommen der Gefäßform einen «besonderen, von der mythischen
Sphäre ausstrahlenden Glanz»: Plinius, Naturalis Historia XXXIII 81
Minervae templum habet Lindos (in) insula Rhodiorum,
in quo Helena sacravit calicem ex electro, adicit
historia, mammae suae mensura28. Wohin aber die aus der
<mythischen Sphäre> gespeiste oder nachträglich durch sie legitimierte
Symbolik genau zielt, ist hier schwer auszumachen. Die antike Sage
von Mykon und Xanthippe läßt die Tochter dem gefangenen Vater
durchs Gitter ihre Brust zur Labung reichen29, was Maler wie Guido
Reni zur bildlichen Wiedergabe angeregt hat. Und in einem Film von
Feste 1932 bzw. 1956, S. 62 ff., und H. W. Parke, Festivals of the Athenians
1977, S. 99 f.). Ebenso ist ein Vergleich mit den Phalloi auf den antiken Hermen
fernzuhalten, wie ihn Johansen a. O. nebenbei gleichfalls bemüht.
27 Adolf Greifenhagen, Mastoi, In: Festschrift für Frank Brommer 1977, S. 133—137
m. Taf. 37—39. Ich verdanke die Kenntnis dieses Aufsatzes der Freundlichkeit des
Verfassers. Vgl. übrigens auch schon den Artikel <Mastos> von Nachod in P.-Wiss.
RE XIV 1930, Sp. 2175 f.
28 Der Text ist bei Greifenhagen am Anfang durch den Druckfehler Minerva
entstellt, er befriedigt auch weiterhin nicht recht. Oben im Text habe ich eine
Herstellung versucht, die das überlieferte und auch in den meisten Ausgaben sich
findende Lindos insulae Rhodiorum emendiert. Das richtige insula
bietet bereits die Nebenüberlieferung der Handschriften; daß davor durch Haplo-
graphie ein in ausgefallen sein muß, hat auch schon C. Mayhoff in seiner Aus-
gabe 1897 vermutet, wie ich nachträglich sehe. Dem hergestellten Text würde
folgende Übersetzung entsprechen: «Einen Athenatempel hat Lindos auf der
Insel Rhodos, in welchem Helena einen Bernstein-Kelch geweiht hat, der — wie
die Geschichte hinzufügt — (Form und) Ausmaß ihrer Brust besaß» (gemeint ist
natürlich: ... einer ihrer Brüste). Vgl. auch den Nachtrag unten auf S. 42.
29 Hygin, Fab. 254,3; vgl. Valerius Maximus, Dieta et facta mirabilia V 4, ext. 1,
wo die Namen Kimon und Pero lauten. Zu der Sage vgl. den Artikel <Pero 4.>
in Pauly-Wiss. RE XIX 1938, Sp. 877 von Ernst Wüst.