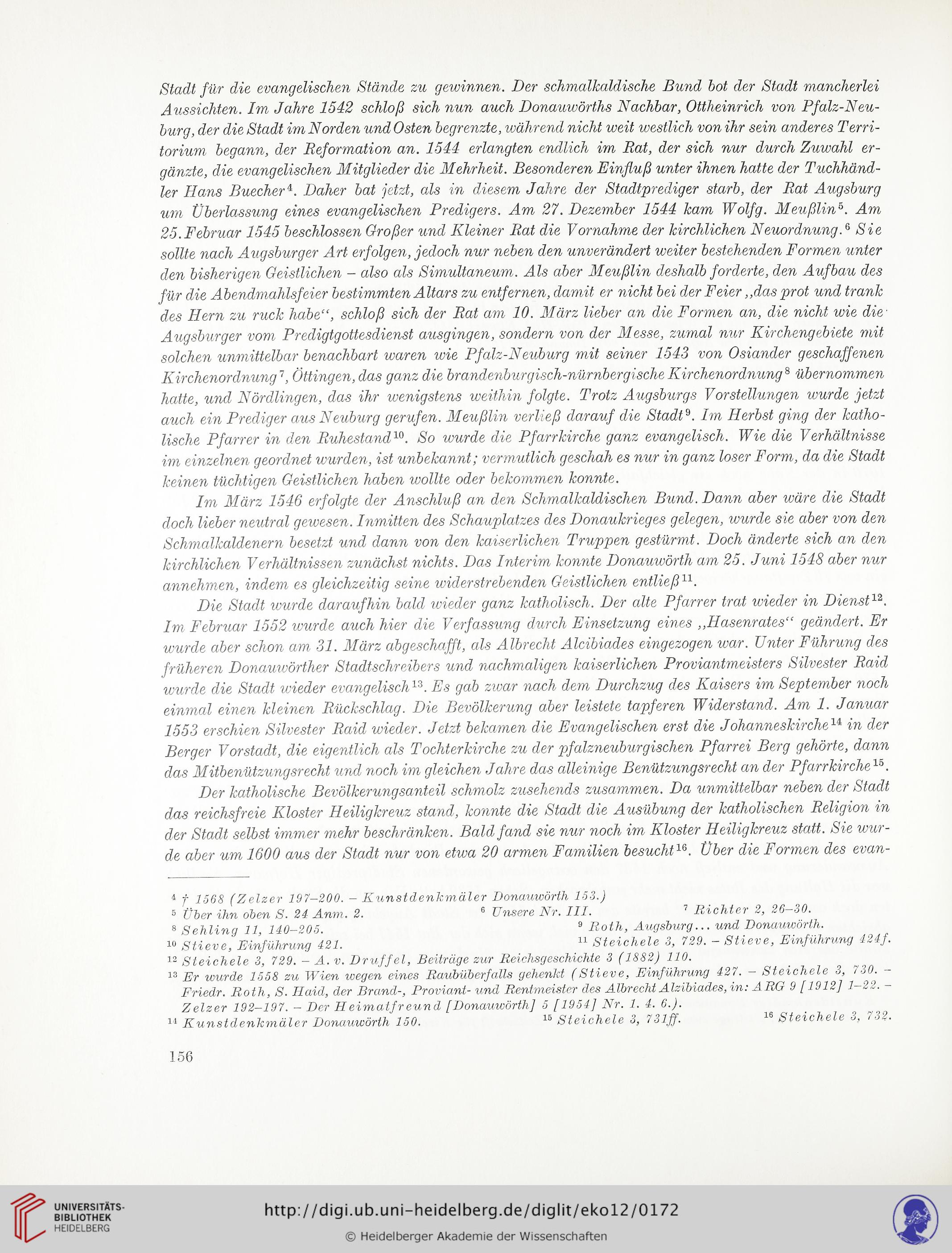Stadt für die evangelischen Stände zu gewinnen. Der schmalkaldische Bund bot der Stadt mancherlei
Aussichten. Im Jahre 1542 schloß sich nun auch Donauwörths Nachbar, Ottheinrich von Pfalz-Neu-
burg, der die Stadt im Norden und Osten begrenzte, während nicht weit westlich von ihr sein anderes Terri-
torium begann, der Reformation an. 1544 erlangten endlich im Rat, der sich nur durch Zuwahl er-
gänzte, die evangelischen Mitglieder die Mehrheit. Besonderen Einfluß unter ihnen hatte der Tuchhänd-
ler Hans Buecher4. Daher bat jetzt, als in diesem Jahre der Stadtprediger starb, der Rat Augsburg
um Überlassung eines evangelischen Predigers. Am 27. Dezember 1544 kam Wolfg. Meußlin5. Am
25.Februar 1545 beschlossen Großer und Kleiner Rat die Vornahme der kirchlichen Neuordnung.6 Sie
sollte nach Augsburger Art erfolgen, jedoch nur neben den unverändert weiter bestehenden Formen unter
den bisherigen Geistlichen - also als Simultaneum. Als aber Meußlin deshalb forderte, den Aufbau des
für die Abendmahlsfeier bestimmten Altars zu entfernen, damit er nicht bei der Feier ,,das prot und trank
des Hern zu ruck habe“, schloß sich der Rat am 10. März lieber an die Formen an, die nicht wie die •
Augsburger vom Predigtgottesdienst ausgingen, sondern von der Messe, zumal nur Kirchengebiete mit
solchen unmittelbar benachbart waren wie Pfalz-Neuburg mit seiner 1543 von Osiander geschaffenen
Kirchenordnung7, Öttingen, das ganz die brandenburgisch-nürnbergische Kirchenordnung8 übernommen
hatte, und Nördlingen, das ihr wenigstens weithin folgte. Trotz Augsburgs Vorstellungen wurde jetzt
auch ein Prediger aus Neuburg gerufen. Meußlin verließ darauf die Stadt9. Im Herbst ging der katho-
lische Pfarrer in den Ruhestand10. So wurde die Pfarrkirche ganz evangelisch. Wie die Verhältnisse
im einzelnen geordnet wurden, ist unbekannt; vermutlich geschah es nur in ganz loser Form, da die Stadt
keinen tüchtigen Geistlichen haben wollte oder bekommen konnte.
Im März 1546 erfolgte der Anschluß an den Schmalkaldischen Bund. Dann aber wäre die Stadt
doch lieber neutral gewesen. Inmitten des Schauplatzes des Donaukrieges gelegen, wurde sie aber von den
Schmalkaldenern besetzt und dann von den kaiserlichen Truppen gestürmt. Doch änderte sich an den
kirchlichen Verhältnissen zunächst nichts. Das Interim konnte Donauwörth am 25. Juni 1548 aber nur
annehmen, indem es gleichzeitig seine widerstrebenden Geistlichen entließ11.
Die Stadt wurde daraufhin bald wieder ganz katholisch. Der alte Pfarrer trat wieder in Dienst12.
Im Februar 1552 wurde auch hier die Verfassung durch Einsetzung eines ,,Hasenrates“ geändert. Er
wurde aber schon am 31. März abgeschafft, als Albrecht Alcibiades eingezogen war. Unter Führung des
früheren Donauwörther Stadtschreibers und nachmaligen kaiserlichen Proviantmeisters Silvester Raid
wurde die Stadt wieder evangelisch13. Es gab zwar nach dem Durchzug des Kaisers im September noch
einmal einen kleinen Rückschlag. Die Bevölkerung aber leistete tapferen Widerstand. Am 1. Januar
1553 erschien Silvester Raid wieder. Jetzt bekamen die Evangelischen erst die Johanneskirche14 in der
Berger Vorstadt, die eigentlich als Tochterkirche zu der pfalzneuburgischen Pfarrei Berg gehörte, dann
das Mitbenützungsrecht und noch im gleichen Jahre das alleinige Benützungsrecht an der Pfarrkirche15.
Der katholische Bevölkerungsanteil schmolz zusehends zusammen. Da unmittelbar neben der Stadt
das reichsfreie Kloster Heiligkreuz stand, konnte die Stadt die Ausübung der katholischen Religion in
der Stadt selbst immer mehr beschränken. Bald fand sie nur noch im Kloster Heiligkreuz statt. Sie wur-
de aber um 1600 aus der Stadt nur von etwa 20 armen Familien besucht16. Über die Formen des evan-
4 † 1568 (Zelzer 197-200. - Kunstdenkmäler Donauwörth 153.)
5 Über ihn oben S. 24 Anm. 2. 6 Unsere Nr. III. 7 Richter 2, 26—30.
8 Sehling 11, 140-205. 9 Roth, Augsburg... und Donauwörth.
10 Stieve, Einführung 421. 11 Steichele 3, 729. — Stieve, Einführung 424f.
12 Steichele 3, 729. - A. v. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte 3 (1882) 110.
13 Er wurde 1558 zu Wien wegen eines Raubüberfalls gehenkt (Stieve, Einführung 427. — Steichele 3, 730. -
Friedr. Roth, S. Haid, der Brand-, Proviant- und Rentmeister des Albrecht Alzibiades, in: ARG 9 [ 1912] 1-22. -
Zelzer 192-197. - Der Heimatfreund [Donauwörth] 5 [1954] Nr. 1. 4. 6.).
14 Kunstdenkmäler Donauwörth 150. 15 Steichele 3, 731ff. 16 Steichele 3, 732.
156
Aussichten. Im Jahre 1542 schloß sich nun auch Donauwörths Nachbar, Ottheinrich von Pfalz-Neu-
burg, der die Stadt im Norden und Osten begrenzte, während nicht weit westlich von ihr sein anderes Terri-
torium begann, der Reformation an. 1544 erlangten endlich im Rat, der sich nur durch Zuwahl er-
gänzte, die evangelischen Mitglieder die Mehrheit. Besonderen Einfluß unter ihnen hatte der Tuchhänd-
ler Hans Buecher4. Daher bat jetzt, als in diesem Jahre der Stadtprediger starb, der Rat Augsburg
um Überlassung eines evangelischen Predigers. Am 27. Dezember 1544 kam Wolfg. Meußlin5. Am
25.Februar 1545 beschlossen Großer und Kleiner Rat die Vornahme der kirchlichen Neuordnung.6 Sie
sollte nach Augsburger Art erfolgen, jedoch nur neben den unverändert weiter bestehenden Formen unter
den bisherigen Geistlichen - also als Simultaneum. Als aber Meußlin deshalb forderte, den Aufbau des
für die Abendmahlsfeier bestimmten Altars zu entfernen, damit er nicht bei der Feier ,,das prot und trank
des Hern zu ruck habe“, schloß sich der Rat am 10. März lieber an die Formen an, die nicht wie die •
Augsburger vom Predigtgottesdienst ausgingen, sondern von der Messe, zumal nur Kirchengebiete mit
solchen unmittelbar benachbart waren wie Pfalz-Neuburg mit seiner 1543 von Osiander geschaffenen
Kirchenordnung7, Öttingen, das ganz die brandenburgisch-nürnbergische Kirchenordnung8 übernommen
hatte, und Nördlingen, das ihr wenigstens weithin folgte. Trotz Augsburgs Vorstellungen wurde jetzt
auch ein Prediger aus Neuburg gerufen. Meußlin verließ darauf die Stadt9. Im Herbst ging der katho-
lische Pfarrer in den Ruhestand10. So wurde die Pfarrkirche ganz evangelisch. Wie die Verhältnisse
im einzelnen geordnet wurden, ist unbekannt; vermutlich geschah es nur in ganz loser Form, da die Stadt
keinen tüchtigen Geistlichen haben wollte oder bekommen konnte.
Im März 1546 erfolgte der Anschluß an den Schmalkaldischen Bund. Dann aber wäre die Stadt
doch lieber neutral gewesen. Inmitten des Schauplatzes des Donaukrieges gelegen, wurde sie aber von den
Schmalkaldenern besetzt und dann von den kaiserlichen Truppen gestürmt. Doch änderte sich an den
kirchlichen Verhältnissen zunächst nichts. Das Interim konnte Donauwörth am 25. Juni 1548 aber nur
annehmen, indem es gleichzeitig seine widerstrebenden Geistlichen entließ11.
Die Stadt wurde daraufhin bald wieder ganz katholisch. Der alte Pfarrer trat wieder in Dienst12.
Im Februar 1552 wurde auch hier die Verfassung durch Einsetzung eines ,,Hasenrates“ geändert. Er
wurde aber schon am 31. März abgeschafft, als Albrecht Alcibiades eingezogen war. Unter Führung des
früheren Donauwörther Stadtschreibers und nachmaligen kaiserlichen Proviantmeisters Silvester Raid
wurde die Stadt wieder evangelisch13. Es gab zwar nach dem Durchzug des Kaisers im September noch
einmal einen kleinen Rückschlag. Die Bevölkerung aber leistete tapferen Widerstand. Am 1. Januar
1553 erschien Silvester Raid wieder. Jetzt bekamen die Evangelischen erst die Johanneskirche14 in der
Berger Vorstadt, die eigentlich als Tochterkirche zu der pfalzneuburgischen Pfarrei Berg gehörte, dann
das Mitbenützungsrecht und noch im gleichen Jahre das alleinige Benützungsrecht an der Pfarrkirche15.
Der katholische Bevölkerungsanteil schmolz zusehends zusammen. Da unmittelbar neben der Stadt
das reichsfreie Kloster Heiligkreuz stand, konnte die Stadt die Ausübung der katholischen Religion in
der Stadt selbst immer mehr beschränken. Bald fand sie nur noch im Kloster Heiligkreuz statt. Sie wur-
de aber um 1600 aus der Stadt nur von etwa 20 armen Familien besucht16. Über die Formen des evan-
4 † 1568 (Zelzer 197-200. - Kunstdenkmäler Donauwörth 153.)
5 Über ihn oben S. 24 Anm. 2. 6 Unsere Nr. III. 7 Richter 2, 26—30.
8 Sehling 11, 140-205. 9 Roth, Augsburg... und Donauwörth.
10 Stieve, Einführung 421. 11 Steichele 3, 729. — Stieve, Einführung 424f.
12 Steichele 3, 729. - A. v. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte 3 (1882) 110.
13 Er wurde 1558 zu Wien wegen eines Raubüberfalls gehenkt (Stieve, Einführung 427. — Steichele 3, 730. -
Friedr. Roth, S. Haid, der Brand-, Proviant- und Rentmeister des Albrecht Alzibiades, in: ARG 9 [ 1912] 1-22. -
Zelzer 192-197. - Der Heimatfreund [Donauwörth] 5 [1954] Nr. 1. 4. 6.).
14 Kunstdenkmäler Donauwörth 150. 15 Steichele 3, 731ff. 16 Steichele 3, 732.
156