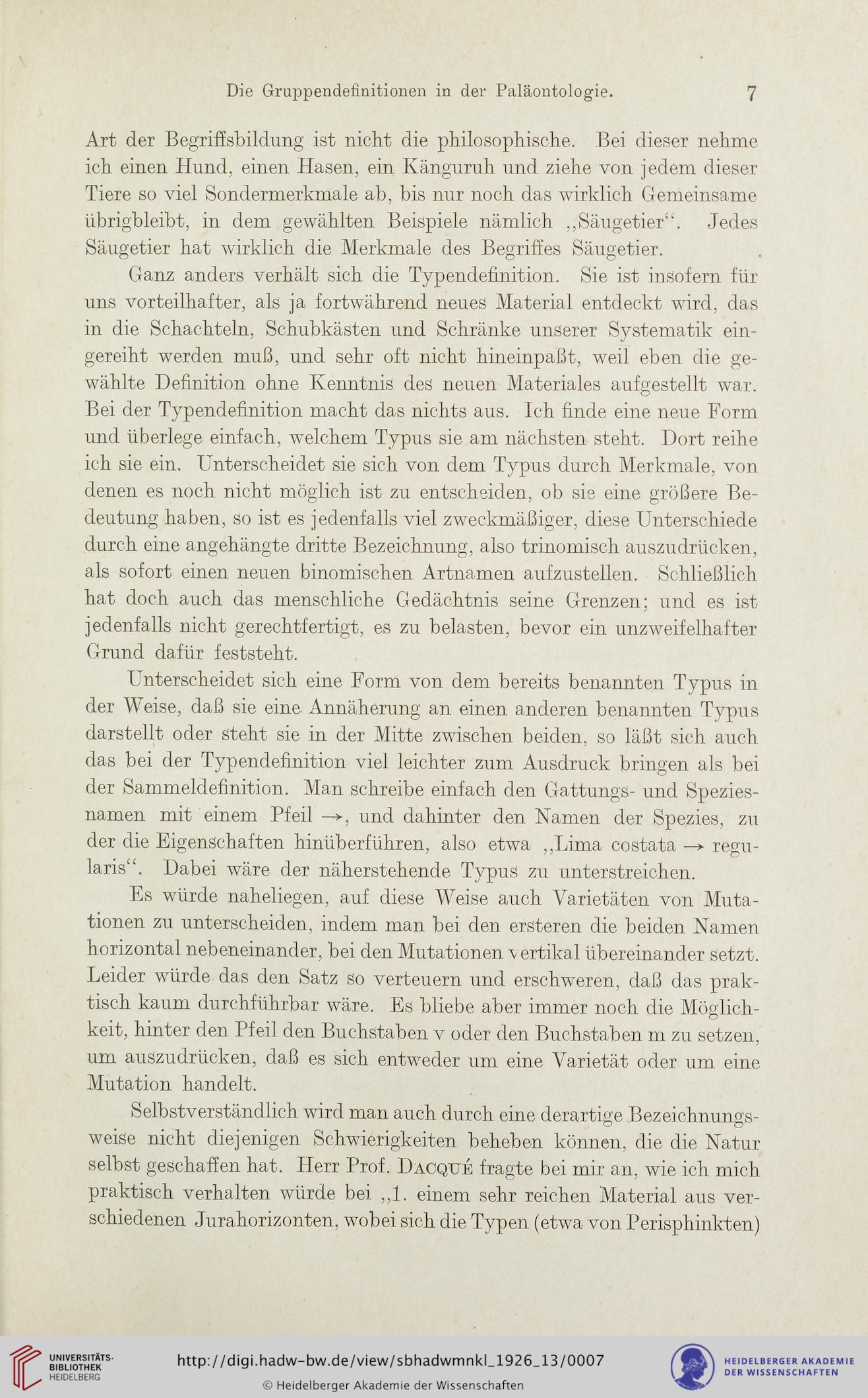Die Gruppendefinitionen in der Paläontologie.
7
Art der Begriffsbildung ist nicht die philosophische. Bei dieser nehme
ich einen Hund, einen Hasen, ein Känguruh und ziehe von jedem dieser
Tiere so viel Sondermerkmale ab, bis nur noch das wirklich Gemeinsame
übrigbleibt, in dem gewählten Beispiele nämlich „Säugetier“. Jedes
Säugetier hat wirklich die Merkmale des Begriffes Säugetier.
Ganz anders verhält sich die Typendefinition. Sie ist insofern für
uns vorteilhafter, als ja fortwährend neues Material entdeckt wird, das
in die Schachteln, Schubkästen und Schränke unserer Systematik ein-
gereiht werden muß, und sehr oft nicht hineinpaßt, weil eben die ge-
wählte Definition ohne Kenntnis des neuen Materiales auf gestellt war.
Bei der Typendefinition macht das nichts aus. Ich finde eine neue Form
und überlege einfach, welchem Typus sie am nächsten steht. Dort reihe
ich sie ein. Unterscheidet sie sich von dem Typus durch Merkmale, von
denen es noch nicht möglich ist zu entscheiden, ob sie eine größere Be-
deutung haben, so ist es jedenfalls viel zweckmäßiger, diese Unterschiede
durch eine angehängte dritte Bezeichnung, also trinomisch auszudrücken,
als sofort einen neuen binomischen Artnamen aufzustellen. Schließlich
hat doch auch das menschliche Gedächtnis seine Grenzen; und es ist
jedenfalls nicht gerechtfertigt, es zu belasten, bevor ein unzweifelhafter
Grund dafür feststeht.
Unterscheidet sich eine Form von dem bereits benannten Typus in
der Weise, daß sie eine Annäherung an einen anderen benannten Typus
darstellt oder steht sie in der Mitte zwischen beiden, so läßt sich auch
das bei der Typendefinition viel leichter zum Ausdruck bringen als bei
der Sammeldefinition. Man schreibe einfach den GattungS- und Spezies-
namen mit einem Ff eil —und dahinter den Namen der Spezies, zu
der die Eigenschaften hinüberführen, also etwa „Lima costata —> regu-
laris“. Dabei wäre der näherstehende Typus zu unterstreichen.
Es würde naheliegen, auf diese Weise auch Varietäten von Muta-
tionen zu unterscheiden, indem man bei den ersteren die beiden Namen
horizontal nebeneinander, bei den Mutationen \ ertikal übereinander setzt.
Leider würde das den Satz so verteuern und erschweren, daß das prak-
tisch kaum durchführbar wäre. Es bliebe aber immer noch die Möglich-
keit, hinter den Pfeil den Buchstaben v oder den Buchstaben m zu setzen,
um auszudrücken, daß es sich entweder um eine Varietät oder um eine
Mutation handelt.
Selbstverständlich wird man auch durch eine derartige Bezeichnungs-
weise nicht diejenigen Schwierigkeiten beheben können, die die Natur
selbst geschaffen hat. Herr Prof. Dacque fragte bei mir an, wie ich mich
praktisch verhalten würde bei „1. einem sehr reichen Material aus ver-
schiedenen Jurahorizonten, wobei sich die Typen (etwa von Perisphinkten)
7
Art der Begriffsbildung ist nicht die philosophische. Bei dieser nehme
ich einen Hund, einen Hasen, ein Känguruh und ziehe von jedem dieser
Tiere so viel Sondermerkmale ab, bis nur noch das wirklich Gemeinsame
übrigbleibt, in dem gewählten Beispiele nämlich „Säugetier“. Jedes
Säugetier hat wirklich die Merkmale des Begriffes Säugetier.
Ganz anders verhält sich die Typendefinition. Sie ist insofern für
uns vorteilhafter, als ja fortwährend neues Material entdeckt wird, das
in die Schachteln, Schubkästen und Schränke unserer Systematik ein-
gereiht werden muß, und sehr oft nicht hineinpaßt, weil eben die ge-
wählte Definition ohne Kenntnis des neuen Materiales auf gestellt war.
Bei der Typendefinition macht das nichts aus. Ich finde eine neue Form
und überlege einfach, welchem Typus sie am nächsten steht. Dort reihe
ich sie ein. Unterscheidet sie sich von dem Typus durch Merkmale, von
denen es noch nicht möglich ist zu entscheiden, ob sie eine größere Be-
deutung haben, so ist es jedenfalls viel zweckmäßiger, diese Unterschiede
durch eine angehängte dritte Bezeichnung, also trinomisch auszudrücken,
als sofort einen neuen binomischen Artnamen aufzustellen. Schließlich
hat doch auch das menschliche Gedächtnis seine Grenzen; und es ist
jedenfalls nicht gerechtfertigt, es zu belasten, bevor ein unzweifelhafter
Grund dafür feststeht.
Unterscheidet sich eine Form von dem bereits benannten Typus in
der Weise, daß sie eine Annäherung an einen anderen benannten Typus
darstellt oder steht sie in der Mitte zwischen beiden, so läßt sich auch
das bei der Typendefinition viel leichter zum Ausdruck bringen als bei
der Sammeldefinition. Man schreibe einfach den GattungS- und Spezies-
namen mit einem Ff eil —und dahinter den Namen der Spezies, zu
der die Eigenschaften hinüberführen, also etwa „Lima costata —> regu-
laris“. Dabei wäre der näherstehende Typus zu unterstreichen.
Es würde naheliegen, auf diese Weise auch Varietäten von Muta-
tionen zu unterscheiden, indem man bei den ersteren die beiden Namen
horizontal nebeneinander, bei den Mutationen \ ertikal übereinander setzt.
Leider würde das den Satz so verteuern und erschweren, daß das prak-
tisch kaum durchführbar wäre. Es bliebe aber immer noch die Möglich-
keit, hinter den Pfeil den Buchstaben v oder den Buchstaben m zu setzen,
um auszudrücken, daß es sich entweder um eine Varietät oder um eine
Mutation handelt.
Selbstverständlich wird man auch durch eine derartige Bezeichnungs-
weise nicht diejenigen Schwierigkeiten beheben können, die die Natur
selbst geschaffen hat. Herr Prof. Dacque fragte bei mir an, wie ich mich
praktisch verhalten würde bei „1. einem sehr reichen Material aus ver-
schiedenen Jurahorizonten, wobei sich die Typen (etwa von Perisphinkten)