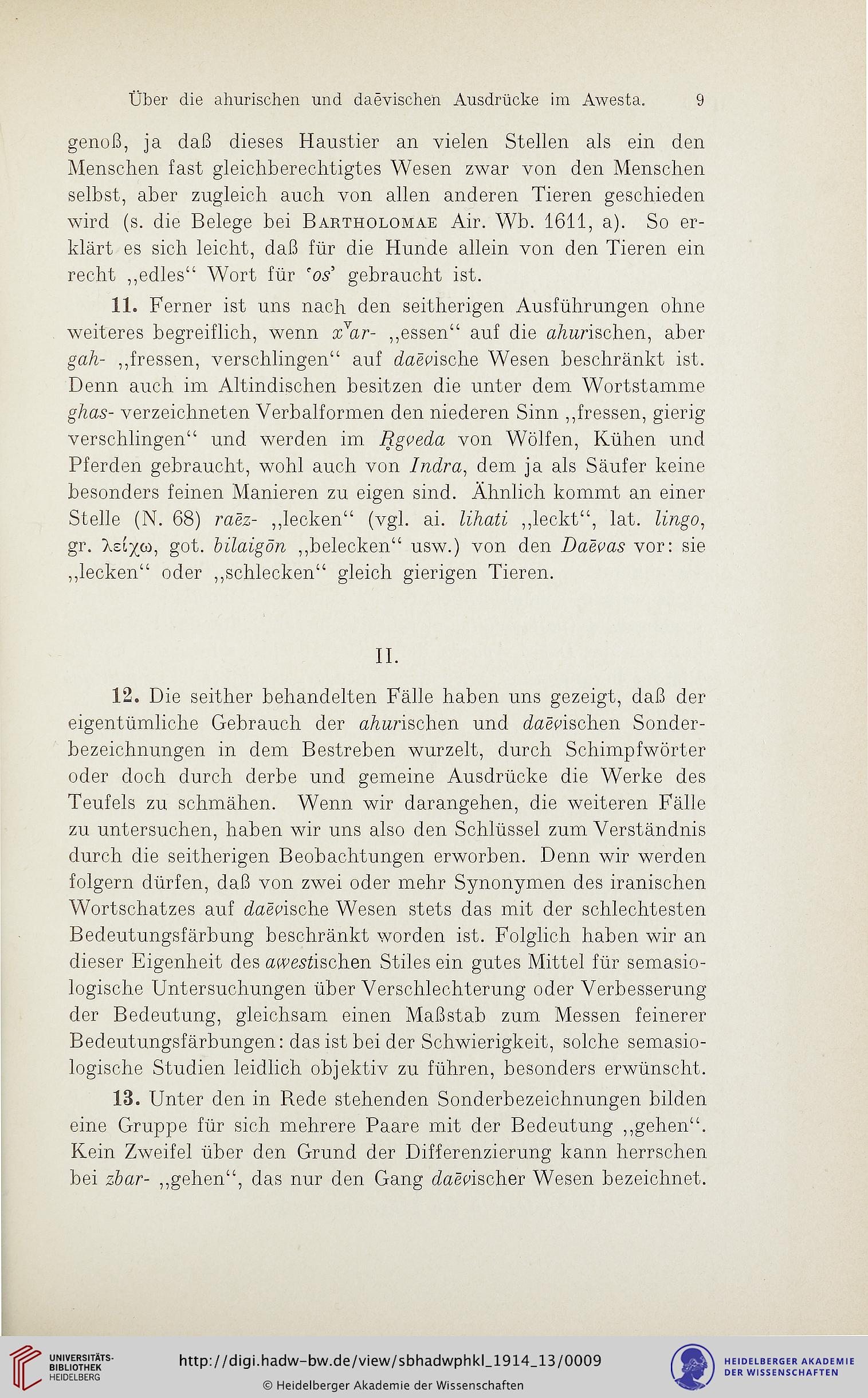Über die ahurischen und daevischen Ausdrücke im Awesta.
9
genoß, ja daß dieses Haustier an vielen Stellen als ein den
Menschen fast gleichberechtigtes Wesen zwar von den Menschen
selbst, aber zugleich auch von allen anderen Tieren geschieden
wird (s. die Belege bei Bartholomae Air. Wb. 1611, a). So er-
klärt es sich leicht, daß für die Hunde allein von den Tieren ein
recht ,,edles“ Wort für 'os’ gebraucht ist.
11. Ferner ist uns nach den seitherigen Ausführungen ohne
weiteres begreiflich, wenn x Yar- „essen“ auf die a/mrischen, aber
gah- „fressen, verschlingen“ auf daevische Wesen beschränkt ist.
Denn auch im Altindischen besitzen die unter dem Wortstamme
ghas- verzeichneten Verbalformen den niederen Sinn „fressen, gierig
verschlingen“ und werden im Rgveda von Wölfen, Kühen und
Pferden gebraucht, wohl auch von Indra, dem ja als Säufer keine
besonders feinen Manieren zu eigen sind. Ähnlich kommt an einer
Stelle (N. 68) raez- „lecken“ (vgl. ai. lihati ,,leckt“, lat. lingo,
gr. got. bilaigön „belecken“ usw.) von den Daevas vor: sie
„lecken“ oder „schlecken“ gleich gierigen Tieren.
II.
12. Die seither behandelten Fälle haben uns gezeigt, daß der
eigentümliche Gebrauch der ahuri&chen und daecischen Sonder-
bezeichnungen in dem Bestreben wurzelt, durch Schimpfwörter
oder doch durch derbe und gemeine Ausdrücke die Werke des
Teufels zu schmähen. Wenn wir darangehen, die weiteren Fälle
zu untersuchen, haben wir uns also den Schlüssel zum Verständnis
durch die seitherigen Beobachtungen erworben. Denn wir werden
folgern dürfen, daß von zwei oder mehr Synonymen des iranischen
Wortschatzes auf daevische Wesen stets das mit der schlechtesten
Bedeutungsfärbung beschränkt worden ist. Folglich haben wir an
dieser Eigenheit des awestischen Stiles ein gutes Mittel für semasio-
logische Untersuchungen über Verscldechterung oder Verbesserung
der Bedeutung, gleichsam einen Maßstab zum Messen feinerer
Bedeutungsfärbungen: das ist bei der Schwierigkeit, solche semasio-
logische Studien leidlich objektiv zu führen, besonders erwünscht.
13. Unter den in Rede stehenden Sonderbezeichnungen bilden
eine Gruppe für sich mehrere Paare mit der Bedeutung „gehen“.
Kein Zweifel über den Grund der Differenzierung kann herrschen
bei zbar- „gehen“, das nur den Gang daevischer Wesen bezeichnet.
9
genoß, ja daß dieses Haustier an vielen Stellen als ein den
Menschen fast gleichberechtigtes Wesen zwar von den Menschen
selbst, aber zugleich auch von allen anderen Tieren geschieden
wird (s. die Belege bei Bartholomae Air. Wb. 1611, a). So er-
klärt es sich leicht, daß für die Hunde allein von den Tieren ein
recht ,,edles“ Wort für 'os’ gebraucht ist.
11. Ferner ist uns nach den seitherigen Ausführungen ohne
weiteres begreiflich, wenn x Yar- „essen“ auf die a/mrischen, aber
gah- „fressen, verschlingen“ auf daevische Wesen beschränkt ist.
Denn auch im Altindischen besitzen die unter dem Wortstamme
ghas- verzeichneten Verbalformen den niederen Sinn „fressen, gierig
verschlingen“ und werden im Rgveda von Wölfen, Kühen und
Pferden gebraucht, wohl auch von Indra, dem ja als Säufer keine
besonders feinen Manieren zu eigen sind. Ähnlich kommt an einer
Stelle (N. 68) raez- „lecken“ (vgl. ai. lihati ,,leckt“, lat. lingo,
gr. got. bilaigön „belecken“ usw.) von den Daevas vor: sie
„lecken“ oder „schlecken“ gleich gierigen Tieren.
II.
12. Die seither behandelten Fälle haben uns gezeigt, daß der
eigentümliche Gebrauch der ahuri&chen und daecischen Sonder-
bezeichnungen in dem Bestreben wurzelt, durch Schimpfwörter
oder doch durch derbe und gemeine Ausdrücke die Werke des
Teufels zu schmähen. Wenn wir darangehen, die weiteren Fälle
zu untersuchen, haben wir uns also den Schlüssel zum Verständnis
durch die seitherigen Beobachtungen erworben. Denn wir werden
folgern dürfen, daß von zwei oder mehr Synonymen des iranischen
Wortschatzes auf daevische Wesen stets das mit der schlechtesten
Bedeutungsfärbung beschränkt worden ist. Folglich haben wir an
dieser Eigenheit des awestischen Stiles ein gutes Mittel für semasio-
logische Untersuchungen über Verscldechterung oder Verbesserung
der Bedeutung, gleichsam einen Maßstab zum Messen feinerer
Bedeutungsfärbungen: das ist bei der Schwierigkeit, solche semasio-
logische Studien leidlich objektiv zu führen, besonders erwünscht.
13. Unter den in Rede stehenden Sonderbezeichnungen bilden
eine Gruppe für sich mehrere Paare mit der Bedeutung „gehen“.
Kein Zweifel über den Grund der Differenzierung kann herrschen
bei zbar- „gehen“, das nur den Gang daevischer Wesen bezeichnet.