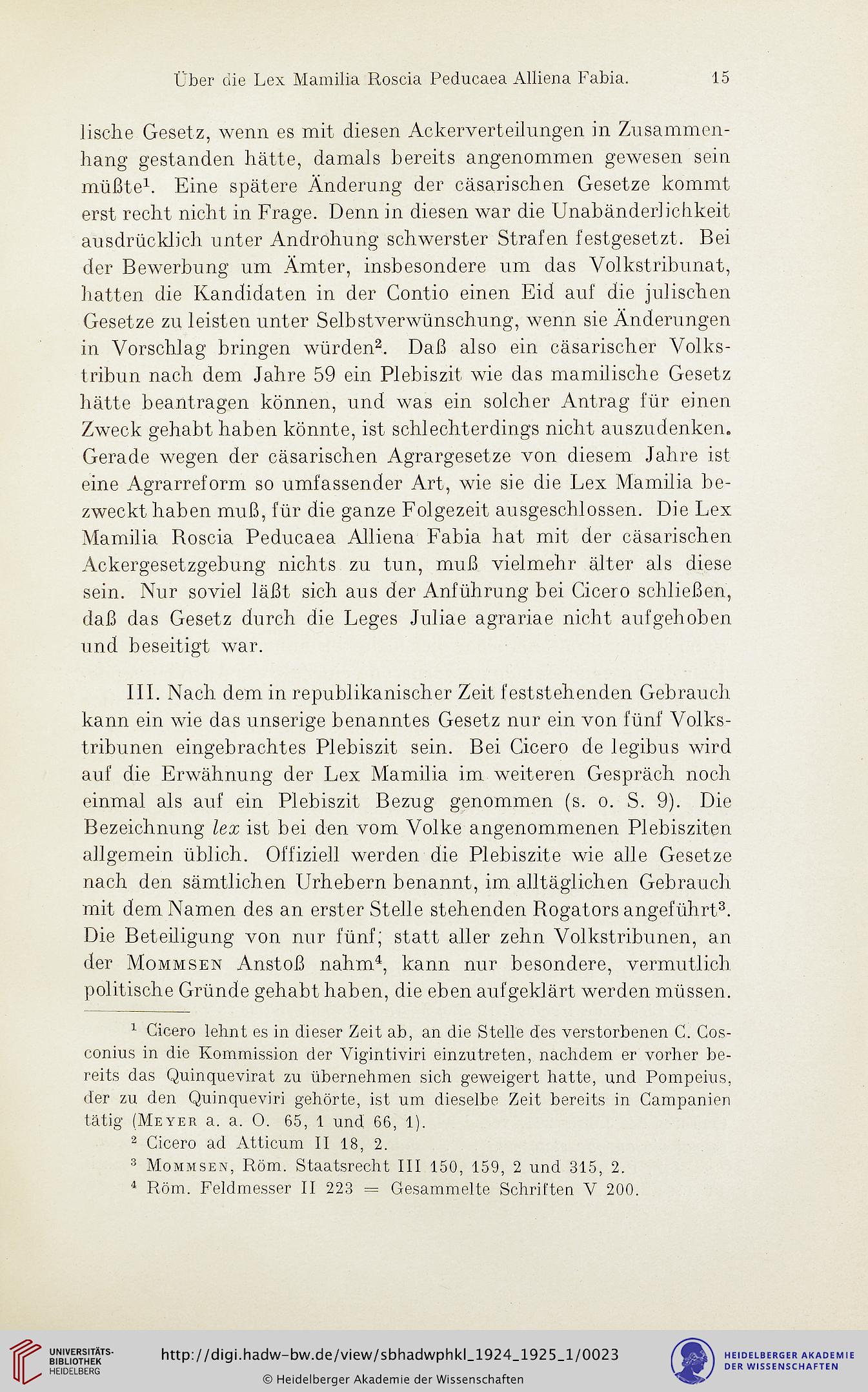Über die Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia.
15
lische Gesetz, wenn es mit diesen Ackerverteilnngen in Zusammen-
hang gestanden hätte, damals bereits angenommen gewesen sein
müßte1. Eine spätere Änderung der cäsarischen Gesetze kommt
erst recht nicht in Frage. Denn in diesen war die Unabänderlichkeit
ausdrücklich unter Androhung schwerster Strafen festgesetzt. Bei
der Bewerbung um Ämter, insbesondere um das Volkstribunat,
hatten die Kandidaten in der Contio einen Eid auf die julischen
Gesetze zu leisten unter Selb st Verwünschung, wenn sie Änderungen
in Vorschlag bringen würden2. Daß also ein cäsarischer Volks-
tribun nach dem Jahre 59 ein Plebiszit wie das mamilische Gesetz
hätte beantragen können, und was ein solcher Antrag für einen
Zweck gehabt haben könnte, ist schlechterdings nicht auszudenken.
Gerade wegen der cäsarischen Agrargesetze von diesem Jahre ist
eine Agrarreform so umfassender Art, wie sie die Lex Mamilia be-
zweckt haben muß, für die ganze Folgezeit ausgeschlossen. Die Lex
Mamilia Boscia Peducaea Alliena Fabia hat mit der cäsarischen
Ackergesetzgebung nichts zu tun, muß vielmehr älter als diese
sein. Nur soviel läßt sich aus der Anführung bei Cicero schließen,
daß das Gesetz durch die Leges Juliae agrariae nicht aufgehoben
und beseitigt war.
III. Nach dem in republikanischer Zeit feststehenden Gebrauch
kann ein wie das unserige benanntes Gesetz nur ein von fünf Volks-
tribunen eingebrachtes Plebiszit sein. Bei Cicero de legibus wird
auf die Erwähnung der Lex Mamilia im weiteren Gespräch noch
einmal als auf ein Plebiszit Bezug genommen (s. o. S. 9). Die
Bezeichnung lex ist bei den vom Volke angenommenen Plebisziten
allgemein üblich. Offiziell werden die Plebiszite wie alle Gesetze
nach den sämtlichen Urhebern benannt, im alltäglichen Gebrauch
mit dem Namen des an erster Stelle stehenden Rogators angeführt3.
Die Beteiligung von nur fünf; statt aller zehn Volkstribunen, an
der Mommsen Anstoß nahm4, kann nur besondere, vermutlich
politische Gründe gehabt haben, die eben aufgeklärt werden müssen.
1 Cicero lehnt es in dieser Zeit ab, an die Stelle des verstorbenen C. Cos-
conius in die Kommission der Vigintiviri einzutreten, nachdem er vorher be-
reits das Quinquevirat zu übernehmen sich geweigert hatte, und Pompeius,
der zu den Quinqueviri gehörte, ist um dieselbe Zeit bereits in Campanien
tätig (Meyer a. a. O. 65, 1 und 66, 1).
2 Cicero ad Atticum II 18, 2.
3 Mommsen, Röm. Staatsrecht III 150, 159, 2 und 315, 2.
4 Röm. Feldmesser II 223 — Gesammelte Schriften V 200.
15
lische Gesetz, wenn es mit diesen Ackerverteilnngen in Zusammen-
hang gestanden hätte, damals bereits angenommen gewesen sein
müßte1. Eine spätere Änderung der cäsarischen Gesetze kommt
erst recht nicht in Frage. Denn in diesen war die Unabänderlichkeit
ausdrücklich unter Androhung schwerster Strafen festgesetzt. Bei
der Bewerbung um Ämter, insbesondere um das Volkstribunat,
hatten die Kandidaten in der Contio einen Eid auf die julischen
Gesetze zu leisten unter Selb st Verwünschung, wenn sie Änderungen
in Vorschlag bringen würden2. Daß also ein cäsarischer Volks-
tribun nach dem Jahre 59 ein Plebiszit wie das mamilische Gesetz
hätte beantragen können, und was ein solcher Antrag für einen
Zweck gehabt haben könnte, ist schlechterdings nicht auszudenken.
Gerade wegen der cäsarischen Agrargesetze von diesem Jahre ist
eine Agrarreform so umfassender Art, wie sie die Lex Mamilia be-
zweckt haben muß, für die ganze Folgezeit ausgeschlossen. Die Lex
Mamilia Boscia Peducaea Alliena Fabia hat mit der cäsarischen
Ackergesetzgebung nichts zu tun, muß vielmehr älter als diese
sein. Nur soviel läßt sich aus der Anführung bei Cicero schließen,
daß das Gesetz durch die Leges Juliae agrariae nicht aufgehoben
und beseitigt war.
III. Nach dem in republikanischer Zeit feststehenden Gebrauch
kann ein wie das unserige benanntes Gesetz nur ein von fünf Volks-
tribunen eingebrachtes Plebiszit sein. Bei Cicero de legibus wird
auf die Erwähnung der Lex Mamilia im weiteren Gespräch noch
einmal als auf ein Plebiszit Bezug genommen (s. o. S. 9). Die
Bezeichnung lex ist bei den vom Volke angenommenen Plebisziten
allgemein üblich. Offiziell werden die Plebiszite wie alle Gesetze
nach den sämtlichen Urhebern benannt, im alltäglichen Gebrauch
mit dem Namen des an erster Stelle stehenden Rogators angeführt3.
Die Beteiligung von nur fünf; statt aller zehn Volkstribunen, an
der Mommsen Anstoß nahm4, kann nur besondere, vermutlich
politische Gründe gehabt haben, die eben aufgeklärt werden müssen.
1 Cicero lehnt es in dieser Zeit ab, an die Stelle des verstorbenen C. Cos-
conius in die Kommission der Vigintiviri einzutreten, nachdem er vorher be-
reits das Quinquevirat zu übernehmen sich geweigert hatte, und Pompeius,
der zu den Quinqueviri gehörte, ist um dieselbe Zeit bereits in Campanien
tätig (Meyer a. a. O. 65, 1 und 66, 1).
2 Cicero ad Atticum II 18, 2.
3 Mommsen, Röm. Staatsrecht III 150, 159, 2 und 315, 2.
4 Röm. Feldmesser II 223 — Gesammelte Schriften V 200.