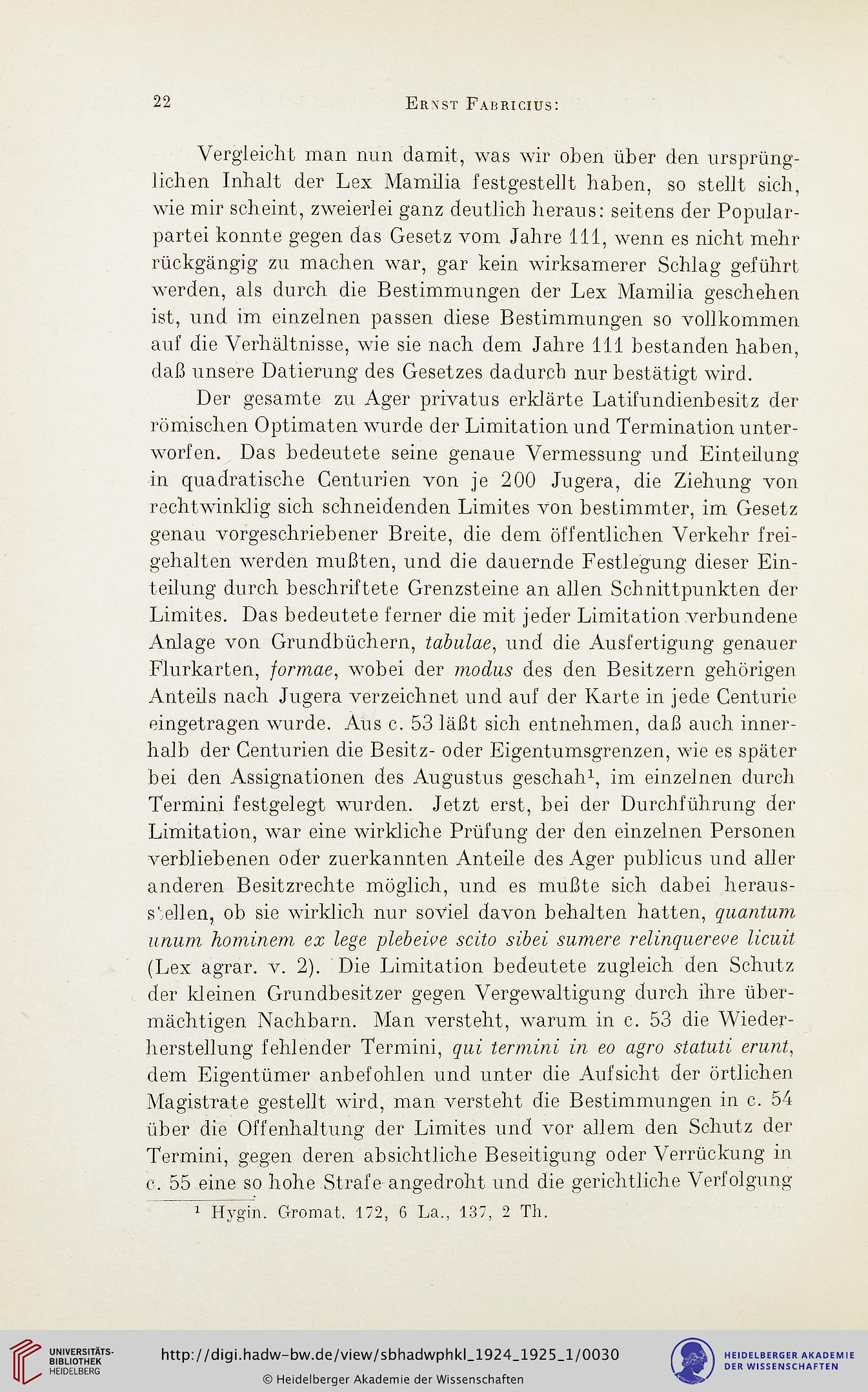22
Ernst Fabricius:
Vergleicht man nun damit, was wir oben über den ursprüng-
lichen Inhalt der Lex Mamilia festgestellt haben, so stellt sich,
wie mir scheint, zweierlei ganz deutlich heraus: seitens der Popular-
partei konnte gegen das Gesetz vom Jahre 111, wenn es nicht mehr
rückgängig zu machen war, gar kein wirksamerer Schlag geführt
werden, als durch die Bestimmungen der Lex Mamilia geschehen
ist, und im einzelnen passen diese Bestimmungen so vollkommen
auf die Verhältnisse, wie sie nach dem Jahre 111 bestanden haben,
daß unsere Datierung des Gesetzes dadurch nur bestätigt wird.
Der gesamte zu Ager privatus erklärte Latifundienbesitz der
römischen Optimaten wurde der Limitation und Termination unter-
worfen. Das bedeutete seine genaue Vermessung und Einteilung
in quadratische Centurien von je 200 Jugera, die Ziehung von
rechtwinklig sich schneidenden Limites von bestimmter, im Gesetz
genau vorgeschriebener Breite, die dem öffentlichen Verkehr frei-
gehalten werden mußten, und die dauernde Festlegung dieser Ein-
teilung durch beschriftete Grenzsteine an allen Schnittpunkten der
Limites. Das bedeutete ferner die mit jeder Limitation verbundene
Anlage von Grundbüchern, tabulae, und die Ausfertigung genauer
Flurkarten, formaß, wobei der modus des den Besitzern gehörigen
Anteils nach Jugera verzeichnet und auf der Karte in jede Centurie
eingetragen wurde. Aus c. 53 läßt sich entnehmen, daß auch inner-
halb der Centimen die Besitz- oder Eigentumsgrenzen, wie es später
bei den Assignationen des Augustus geschah1, im einzelnen durch
Termini festgelegt wurden. Jetzt erst, bei der Durchführung der
Limitation, war eine wirkliche Prüfung der den einzelnen Personen
verbliebenen oder zuerkannten Anteile des Ager publicus und aller
anderen Besitzrechte möglich, und es mußte sich dabei heraus-
stellen, ob sie wirklich nur soviel davon behalten hatten, quantum
unum hominem ex lege plebeive scito sibei saniere relinquereve licuit
(Lex agrar, v. 2). Die Limitation bedeutete zugleich den Schutz
der kleinen Grundbesitzer gegen Vergewaltigung durch ihre über-
mächtigen Nachbarn. Man versteht, warum in c. 53 die Wieder-
herstellung fehlender Termini, qui termini in eo agro statuti erunt,
dem Eigentümer anbefohlen und unter die Aufsicht der örtlichen
Magistrate gestellt wird, man versteht die Bestimmungen in c. 54
über die Offenhaltung der Limites und vor allem den Schutz der
Termini, gegen deren absichtliche Beseitigung oder Verrückung in
c. 55 eine so hohe Strafe angedroht und die gerichtliche Verfolgung
1 Hygin. Gromat. 172, 6 La., 137, 2 Th.
Ernst Fabricius:
Vergleicht man nun damit, was wir oben über den ursprüng-
lichen Inhalt der Lex Mamilia festgestellt haben, so stellt sich,
wie mir scheint, zweierlei ganz deutlich heraus: seitens der Popular-
partei konnte gegen das Gesetz vom Jahre 111, wenn es nicht mehr
rückgängig zu machen war, gar kein wirksamerer Schlag geführt
werden, als durch die Bestimmungen der Lex Mamilia geschehen
ist, und im einzelnen passen diese Bestimmungen so vollkommen
auf die Verhältnisse, wie sie nach dem Jahre 111 bestanden haben,
daß unsere Datierung des Gesetzes dadurch nur bestätigt wird.
Der gesamte zu Ager privatus erklärte Latifundienbesitz der
römischen Optimaten wurde der Limitation und Termination unter-
worfen. Das bedeutete seine genaue Vermessung und Einteilung
in quadratische Centurien von je 200 Jugera, die Ziehung von
rechtwinklig sich schneidenden Limites von bestimmter, im Gesetz
genau vorgeschriebener Breite, die dem öffentlichen Verkehr frei-
gehalten werden mußten, und die dauernde Festlegung dieser Ein-
teilung durch beschriftete Grenzsteine an allen Schnittpunkten der
Limites. Das bedeutete ferner die mit jeder Limitation verbundene
Anlage von Grundbüchern, tabulae, und die Ausfertigung genauer
Flurkarten, formaß, wobei der modus des den Besitzern gehörigen
Anteils nach Jugera verzeichnet und auf der Karte in jede Centurie
eingetragen wurde. Aus c. 53 läßt sich entnehmen, daß auch inner-
halb der Centimen die Besitz- oder Eigentumsgrenzen, wie es später
bei den Assignationen des Augustus geschah1, im einzelnen durch
Termini festgelegt wurden. Jetzt erst, bei der Durchführung der
Limitation, war eine wirkliche Prüfung der den einzelnen Personen
verbliebenen oder zuerkannten Anteile des Ager publicus und aller
anderen Besitzrechte möglich, und es mußte sich dabei heraus-
stellen, ob sie wirklich nur soviel davon behalten hatten, quantum
unum hominem ex lege plebeive scito sibei saniere relinquereve licuit
(Lex agrar, v. 2). Die Limitation bedeutete zugleich den Schutz
der kleinen Grundbesitzer gegen Vergewaltigung durch ihre über-
mächtigen Nachbarn. Man versteht, warum in c. 53 die Wieder-
herstellung fehlender Termini, qui termini in eo agro statuti erunt,
dem Eigentümer anbefohlen und unter die Aufsicht der örtlichen
Magistrate gestellt wird, man versteht die Bestimmungen in c. 54
über die Offenhaltung der Limites und vor allem den Schutz der
Termini, gegen deren absichtliche Beseitigung oder Verrückung in
c. 55 eine so hohe Strafe angedroht und die gerichtliche Verfolgung
1 Hygin. Gromat. 172, 6 La., 137, 2 Th.