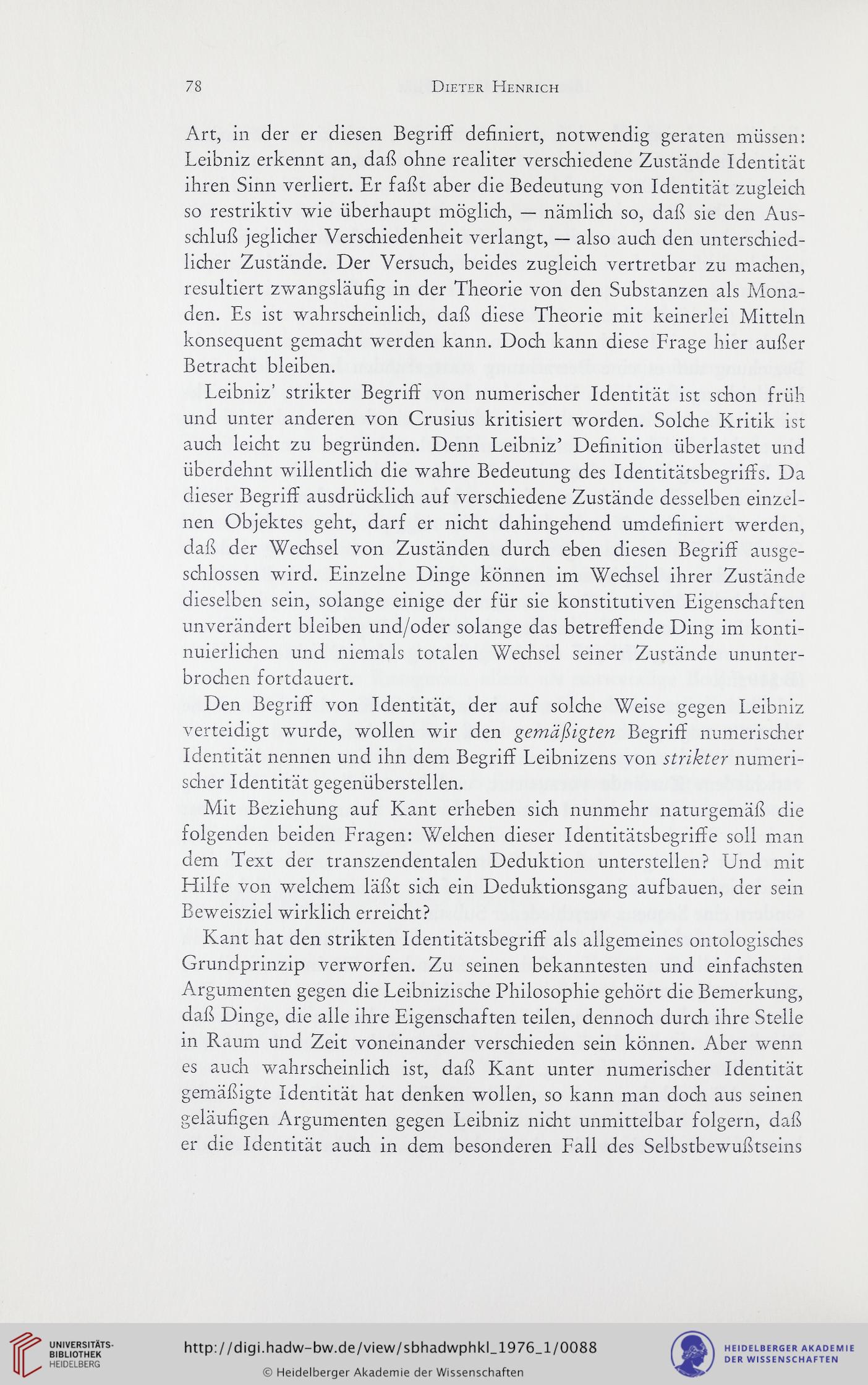78
Dieter Henrich
Art, in der er diesen Begriff definiert, notwendig geraten müssen:
Leibniz erkennt an, daß ohne realiter verschiedene Zustände Identität
ihren Sinn verliert. Er faßt aber die Bedeutung von Identität zugleich
so restriktiv wie überhaupt möglich, — nämlich so, daß sie den Aus-
schluß jeglicher Verschiedenheit verlangt, — also auch den unterschied-
licher Zustände. Der Versuch, beides zugleich vertretbar zu machen,
resultiert zwangsläufig in der Theorie von den Substanzen als Mona-
den. Es ist wahrscheinlich, daß diese Theorie mit keinerlei Mitteln
konsequent gemacht werden kann. Doch kann diese Frage hier außer
Betracht bleiben.
Leibniz’ strikter Begriff von numerischer Identität ist schon früh
und unter anderen von Crusius kritisiert worden. Solche Kritik ist
auch leicht zu begründen. Denn Leibniz’ Definition überlastet und
überdehnt willentlich die wahre Bedeutung des Identitätsbegriffs. Da
dieser Begriff ausdrücklich auf verschiedene Zustände desselben einzel-
nen Objektes geht, darf er nicht dahingehend umdefiniert werden,
daß der Wechsel von Zuständen durch eben diesen Begriff ausge-
schlossen wird. Einzelne Dinge können im Wechsel ihrer Zustände
dieselben sein, solange einige der für sie konstitutiven Eigenschaften
unverändert bleiben und/oder solange das betreffende Ding im konti-
nuierlichen und niemals totalen Wechsel seiner Zustände ununter-
brochen fortdauert.
Den Begriff von Identität, der auf solche Weise gegen Leibniz
verteidigt wurde, wollen wir den gemäßigten Begriff numerischer
Identität nennen und ihn dem Begriff Leibnizens von strikter numeri-
scher Identität gegenüberstellen.
Mit Beziehung auf Kant erheben sich nunmehr naturgemäß die
folgenden beiden Fragen: Welchen dieser Identitätsbegriffe soll man
dem Text der transzendentalen Deduktion unterstellen? Und mit
Hilfe von welchem läßt sich ein Deduktionsgang aufbauen, der sein
Beweisziel wirklich erreicht?
Kant hat den strikten Identitätsbegriff als allgemeines ontologisches
Grundprinzip verworfen. Zu seinen bekanntesten und einfachsten
Argumenten gegen die Leibnizische Philosophie gehört die Bemerkung,
daß Dinge, die alle ihre Eigenschaften teilen, dennoch durch ihre Stelle
in Raum und Zeit voneinander verschieden sein können. Aber wenn
es auch wahrscheinlich ist, daß Kant unter numerischer Identität
gemäßigte Identität hat denken wollen, so kann man doch aus seinen
geläufigen Argumenten gegen Leibniz nicht unmittelbar folgern, daß
er die Identität auch in dem besonderen Fall des Selbstbewußtseins
Dieter Henrich
Art, in der er diesen Begriff definiert, notwendig geraten müssen:
Leibniz erkennt an, daß ohne realiter verschiedene Zustände Identität
ihren Sinn verliert. Er faßt aber die Bedeutung von Identität zugleich
so restriktiv wie überhaupt möglich, — nämlich so, daß sie den Aus-
schluß jeglicher Verschiedenheit verlangt, — also auch den unterschied-
licher Zustände. Der Versuch, beides zugleich vertretbar zu machen,
resultiert zwangsläufig in der Theorie von den Substanzen als Mona-
den. Es ist wahrscheinlich, daß diese Theorie mit keinerlei Mitteln
konsequent gemacht werden kann. Doch kann diese Frage hier außer
Betracht bleiben.
Leibniz’ strikter Begriff von numerischer Identität ist schon früh
und unter anderen von Crusius kritisiert worden. Solche Kritik ist
auch leicht zu begründen. Denn Leibniz’ Definition überlastet und
überdehnt willentlich die wahre Bedeutung des Identitätsbegriffs. Da
dieser Begriff ausdrücklich auf verschiedene Zustände desselben einzel-
nen Objektes geht, darf er nicht dahingehend umdefiniert werden,
daß der Wechsel von Zuständen durch eben diesen Begriff ausge-
schlossen wird. Einzelne Dinge können im Wechsel ihrer Zustände
dieselben sein, solange einige der für sie konstitutiven Eigenschaften
unverändert bleiben und/oder solange das betreffende Ding im konti-
nuierlichen und niemals totalen Wechsel seiner Zustände ununter-
brochen fortdauert.
Den Begriff von Identität, der auf solche Weise gegen Leibniz
verteidigt wurde, wollen wir den gemäßigten Begriff numerischer
Identität nennen und ihn dem Begriff Leibnizens von strikter numeri-
scher Identität gegenüberstellen.
Mit Beziehung auf Kant erheben sich nunmehr naturgemäß die
folgenden beiden Fragen: Welchen dieser Identitätsbegriffe soll man
dem Text der transzendentalen Deduktion unterstellen? Und mit
Hilfe von welchem läßt sich ein Deduktionsgang aufbauen, der sein
Beweisziel wirklich erreicht?
Kant hat den strikten Identitätsbegriff als allgemeines ontologisches
Grundprinzip verworfen. Zu seinen bekanntesten und einfachsten
Argumenten gegen die Leibnizische Philosophie gehört die Bemerkung,
daß Dinge, die alle ihre Eigenschaften teilen, dennoch durch ihre Stelle
in Raum und Zeit voneinander verschieden sein können. Aber wenn
es auch wahrscheinlich ist, daß Kant unter numerischer Identität
gemäßigte Identität hat denken wollen, so kann man doch aus seinen
geläufigen Argumenten gegen Leibniz nicht unmittelbar folgern, daß
er die Identität auch in dem besonderen Fall des Selbstbewußtseins