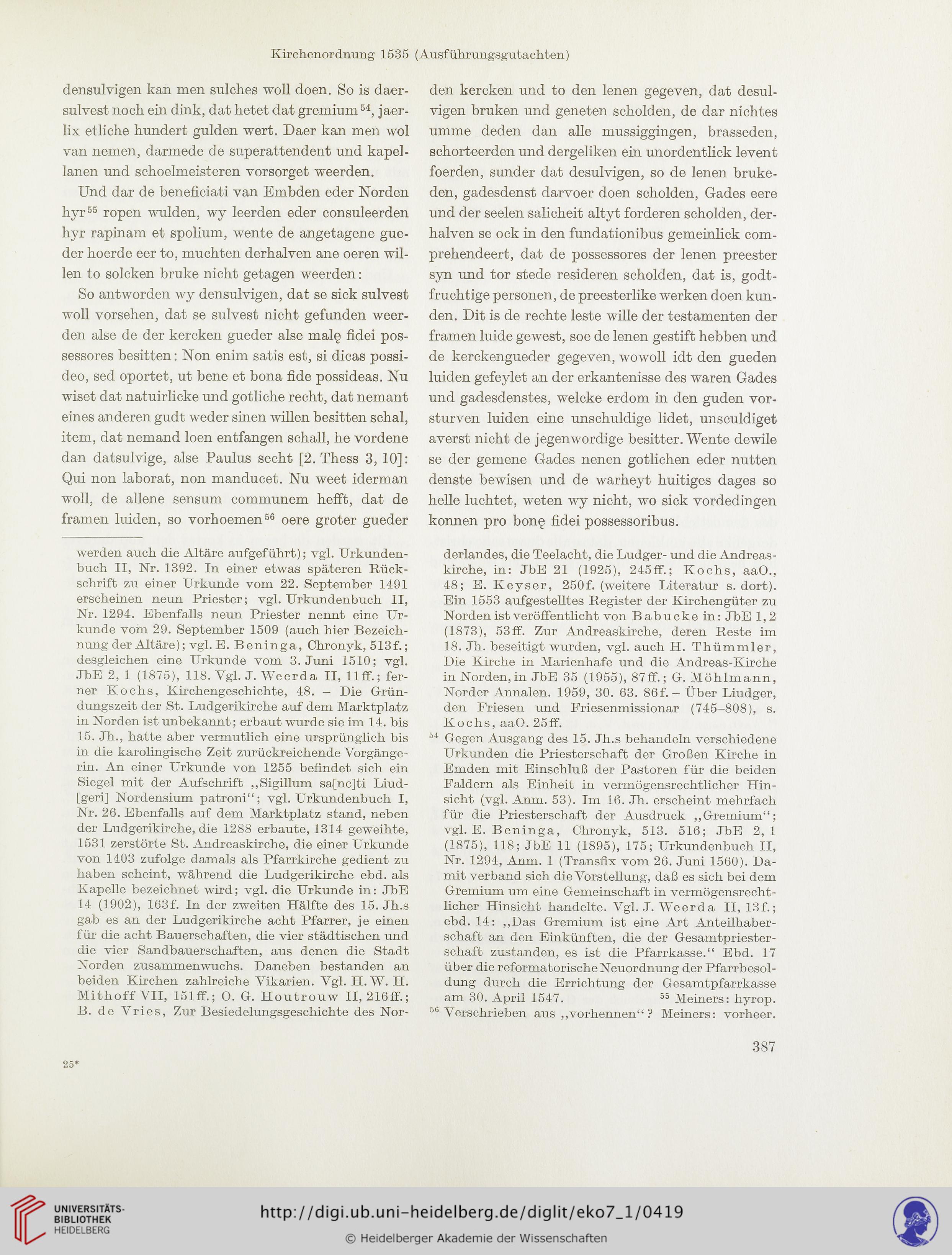Kirchenordnung 1535 (Ausführungsgutachten)
densulvigen kan men sulches woll doen. So is daer-
sulvest noch ein dink, dat hetet dat gremium 54, jaer-
lix etliche hundert gulden wert. Daer kan men wol
van nemen, darmede de superattendent und kapel-
lanen und schoelmeisteren vorsorget weerden.
Und dar de beneficiati van Embden eder Norden
hyr 55 ropen wulden, wy leerden eder consuleerden
hyr rapinam et spolium, wente de angetagene gue-
der hoerde eer to, muchten derhalven ane oeren wil-
len to solcken bruke nicht getagen weerden:
So antworden wy densulvigen, dat se sick sulvest
woll vorsehen, dat se sulvest nicht gefunden weer-
den alse de der kercken gueder alse malae fidei pos-
sessores besitten: Non enim satis est, si dicas possi-
deo, sed oportet, ut bene et bona fide possideas. Nu
wiset dat natuirlicke und gotliche recht, dat nemant
eines anderen gudt weder sinen willen besitten schal,
item, dat nemand loen entfangen schall, he vordene
dan datsulvige, alse Paulus secht [2. Thess 3, 10]:
Qui non laborat, non manducet. Nu weet iderman
woll, de allene sensum communem hefft, dat de
framen luiden, so vorhoemen 56 oere groter gueder
werden auch die Altäre aufgeführt); vgl. Urkunden-
buch II, Nr. 1392. In einer etwas späteren Rück-
schrift zu einer Urkunde vom 22. Septemher 1491
erscheinen neun Priester; vgl. Urkundenbuch II,
Nr. 1294. Ebenfalls neun Priester nennt eine Ur-
kunde vom 29. September 1509 (auch hier Bezeich-
nung der Altäre); vgl. E. Beninga, Chronyk, 513f.;
desgleichen eine Urkunde vom 3. Juni 1510; vgl.
JbE 2, 1 (1875), 118. Vgl. J. Weerda II, 11 ff.; fer-
ner Kochs, Kirchengeschichte, 48. — Die Grün-
dungszeit der St. Ludgerikirche auf dem Marktplatz
in Norden ist unbekannt; erbaut wurde sie im 14. bis
15. Jh., hatte aber vermutlich eine ursprünglich bis
in die karolingische Zeit zurückreichende Vorgänge-
rin. An einer Urkunde von 1255 befindet sich ein
Siegel mit der Aufschrift „Sigillum sa[nc]ti Liud-
[geri] Nordensium patroni“; vgl. Urkundenbuch I,
Nr. 26. Ebenfalls auf dem Marktplatz stand, neben
der Ludgerikirche, die 1288 erbaute, 1314 geweihte,
1531 zerstörte St. Andreaskirche, die einer Urkunde
von 1403 zufolge damals als Pfarrkirche gedient zu
haben scheint, während die Ludgerikirche ebd. als
Kapelle bezeichnet wird; vgl. die Urkunde in: JbE
14 (1902), 163f. In der zweiten Hälfte des 15. Jh.s
gab es an der Ludgerikirche acht Pfarrer, je einen
für die acht Bauerschaften, die vier städtischen und
die vier Sandbauerschaften, aus denen die Stadt
Norden zusammenwuchs. Daneben bestanden an
beiden Kirchen zahlreiche Vikarien. Vgl. H. W. H.
Mithoff VII, 151 ff.; O. G. Houtrouw II, 216ff.;
B. de Vries, Zur Besiedelungsgeschichte des Nor-
den kercken und to den lenen gegeven, dat desul-
vigen bruken und geneten scholden, de dar nichtes
umme deden dan alle mussiggingen, brasseden,
schorteerden und dergeliken ein unordentlick levent
foerden, sunder dat desulvigen, so de lenen bruke-
den, gadesdenst darvoer doen scholden, Gades eere
und der seelen salicheit altyt forderen scholden, der-
halven se ock in den fundationibus gemeinlick com-
prehendeert, dat de possessores der lenen preester
syn und tor stede resideren scholden, dat is, godt-
fruchtige personen, de preesterlike werken doen kun-
den. Dit is de rechte leste wille der testamenten der
framen luide gewest, soe de lenen gestift hebben und
de kerckengueder gegeven, wowoll idt den gueden
luiden gefeylet an der erkantenisse des waren Gades
und gadesdenstes, welcke erdom in den guden vor-
sturven luiden eine unschuldige lidet, unsculdiget
averst nicht de jegenwordige besitter. Wente dewile
se der gemene Gades nenen gotlichen eder nutten
denste bewisen und de warheyt huitiges dages so
helle luchtet, weten wy nicht, wo sick vordedingen
konnen pro bonae fidei possessoribus.
derlandes, die Teelacht, die Ludger- und die Andreas-
kirche, in: JbE 21 (1925), 245ff.; Kochs, aaO.,
48; E. Keyser, 250f. (weitere Literatur s. dort).
Ein 1553 aufgestelltes Register der Kirchengüter zu
Norden ist veröffentlicht von Babucke in: JbE 1,2
(1873), 53ff. Zur Andreaskirche, deren Reste im
18. Jh. beseitigt wurden, vgl. auch H. Thümmler,
Die Kirche in Marienhafe und die Andreas-Kirche
in Norden, in JbE 35 (1955), 87ff.; G. Möhlmann,
Norder Annalen. 1959, 30. 63. 86f. — Über Liudger,
den Friesen und Friesenmissionar (745-808), s.
Kochs, aaO. 25ff.
54 Gegen Ausgang des 15. Jh.s behandeln verschiedene
Urkunden die Priesterschaft der Großen Kirche in
Emden mit Einschluß der Pastoren für die beiden
Faldern als Einheit in vermögensrechtlicher Hin-
sicht (vgl. Anm. 53). Im 16. Jh. erscheint mehrfach
für die Priesterschaft der Ausdruck „Gremium“;
vgl. E. Beninga, Chronyk, 513. 516; JbE 2,1
(1875), 118; JbE 11 (1895), 175; Urkundenbuch II,
Nr. 1294, Anm. 1 (Transfix vom 26. Juni 1560). Da-
mit verband sich die Vorstellung, daß es sich bei dem
Gremium um eine Gemeinschaft in vermögensrecht-
licher Hinsicht handelte. Vgl. J. Weerda II, 13f.;
ebd. 14: „Das Gremium ist eine Art Anteilhaber-
schaft an den Einkünften, die der Gesamtpriester-
schaft zustanden, es ist die Pfarrkasse.“ Ebd. 17
über die reformatorische Neuordnung der Pfarrbesol-
dung durch die Errichtung der Gesamtpfarrkasse
am 30. April 15 47 . 55 Meiners: hyrop.
56 Verschrieben aus „vorhennen“ ? Meiners: vorheer.
25*
387
densulvigen kan men sulches woll doen. So is daer-
sulvest noch ein dink, dat hetet dat gremium 54, jaer-
lix etliche hundert gulden wert. Daer kan men wol
van nemen, darmede de superattendent und kapel-
lanen und schoelmeisteren vorsorget weerden.
Und dar de beneficiati van Embden eder Norden
hyr 55 ropen wulden, wy leerden eder consuleerden
hyr rapinam et spolium, wente de angetagene gue-
der hoerde eer to, muchten derhalven ane oeren wil-
len to solcken bruke nicht getagen weerden:
So antworden wy densulvigen, dat se sick sulvest
woll vorsehen, dat se sulvest nicht gefunden weer-
den alse de der kercken gueder alse malae fidei pos-
sessores besitten: Non enim satis est, si dicas possi-
deo, sed oportet, ut bene et bona fide possideas. Nu
wiset dat natuirlicke und gotliche recht, dat nemant
eines anderen gudt weder sinen willen besitten schal,
item, dat nemand loen entfangen schall, he vordene
dan datsulvige, alse Paulus secht [2. Thess 3, 10]:
Qui non laborat, non manducet. Nu weet iderman
woll, de allene sensum communem hefft, dat de
framen luiden, so vorhoemen 56 oere groter gueder
werden auch die Altäre aufgeführt); vgl. Urkunden-
buch II, Nr. 1392. In einer etwas späteren Rück-
schrift zu einer Urkunde vom 22. Septemher 1491
erscheinen neun Priester; vgl. Urkundenbuch II,
Nr. 1294. Ebenfalls neun Priester nennt eine Ur-
kunde vom 29. September 1509 (auch hier Bezeich-
nung der Altäre); vgl. E. Beninga, Chronyk, 513f.;
desgleichen eine Urkunde vom 3. Juni 1510; vgl.
JbE 2, 1 (1875), 118. Vgl. J. Weerda II, 11 ff.; fer-
ner Kochs, Kirchengeschichte, 48. — Die Grün-
dungszeit der St. Ludgerikirche auf dem Marktplatz
in Norden ist unbekannt; erbaut wurde sie im 14. bis
15. Jh., hatte aber vermutlich eine ursprünglich bis
in die karolingische Zeit zurückreichende Vorgänge-
rin. An einer Urkunde von 1255 befindet sich ein
Siegel mit der Aufschrift „Sigillum sa[nc]ti Liud-
[geri] Nordensium patroni“; vgl. Urkundenbuch I,
Nr. 26. Ebenfalls auf dem Marktplatz stand, neben
der Ludgerikirche, die 1288 erbaute, 1314 geweihte,
1531 zerstörte St. Andreaskirche, die einer Urkunde
von 1403 zufolge damals als Pfarrkirche gedient zu
haben scheint, während die Ludgerikirche ebd. als
Kapelle bezeichnet wird; vgl. die Urkunde in: JbE
14 (1902), 163f. In der zweiten Hälfte des 15. Jh.s
gab es an der Ludgerikirche acht Pfarrer, je einen
für die acht Bauerschaften, die vier städtischen und
die vier Sandbauerschaften, aus denen die Stadt
Norden zusammenwuchs. Daneben bestanden an
beiden Kirchen zahlreiche Vikarien. Vgl. H. W. H.
Mithoff VII, 151 ff.; O. G. Houtrouw II, 216ff.;
B. de Vries, Zur Besiedelungsgeschichte des Nor-
den kercken und to den lenen gegeven, dat desul-
vigen bruken und geneten scholden, de dar nichtes
umme deden dan alle mussiggingen, brasseden,
schorteerden und dergeliken ein unordentlick levent
foerden, sunder dat desulvigen, so de lenen bruke-
den, gadesdenst darvoer doen scholden, Gades eere
und der seelen salicheit altyt forderen scholden, der-
halven se ock in den fundationibus gemeinlick com-
prehendeert, dat de possessores der lenen preester
syn und tor stede resideren scholden, dat is, godt-
fruchtige personen, de preesterlike werken doen kun-
den. Dit is de rechte leste wille der testamenten der
framen luide gewest, soe de lenen gestift hebben und
de kerckengueder gegeven, wowoll idt den gueden
luiden gefeylet an der erkantenisse des waren Gades
und gadesdenstes, welcke erdom in den guden vor-
sturven luiden eine unschuldige lidet, unsculdiget
averst nicht de jegenwordige besitter. Wente dewile
se der gemene Gades nenen gotlichen eder nutten
denste bewisen und de warheyt huitiges dages so
helle luchtet, weten wy nicht, wo sick vordedingen
konnen pro bonae fidei possessoribus.
derlandes, die Teelacht, die Ludger- und die Andreas-
kirche, in: JbE 21 (1925), 245ff.; Kochs, aaO.,
48; E. Keyser, 250f. (weitere Literatur s. dort).
Ein 1553 aufgestelltes Register der Kirchengüter zu
Norden ist veröffentlicht von Babucke in: JbE 1,2
(1873), 53ff. Zur Andreaskirche, deren Reste im
18. Jh. beseitigt wurden, vgl. auch H. Thümmler,
Die Kirche in Marienhafe und die Andreas-Kirche
in Norden, in JbE 35 (1955), 87ff.; G. Möhlmann,
Norder Annalen. 1959, 30. 63. 86f. — Über Liudger,
den Friesen und Friesenmissionar (745-808), s.
Kochs, aaO. 25ff.
54 Gegen Ausgang des 15. Jh.s behandeln verschiedene
Urkunden die Priesterschaft der Großen Kirche in
Emden mit Einschluß der Pastoren für die beiden
Faldern als Einheit in vermögensrechtlicher Hin-
sicht (vgl. Anm. 53). Im 16. Jh. erscheint mehrfach
für die Priesterschaft der Ausdruck „Gremium“;
vgl. E. Beninga, Chronyk, 513. 516; JbE 2,1
(1875), 118; JbE 11 (1895), 175; Urkundenbuch II,
Nr. 1294, Anm. 1 (Transfix vom 26. Juni 1560). Da-
mit verband sich die Vorstellung, daß es sich bei dem
Gremium um eine Gemeinschaft in vermögensrecht-
licher Hinsicht handelte. Vgl. J. Weerda II, 13f.;
ebd. 14: „Das Gremium ist eine Art Anteilhaber-
schaft an den Einkünften, die der Gesamtpriester-
schaft zustanden, es ist die Pfarrkasse.“ Ebd. 17
über die reformatorische Neuordnung der Pfarrbesol-
dung durch die Errichtung der Gesamtpfarrkasse
am 30. April 15 47 . 55 Meiners: hyrop.
56 Verschrieben aus „vorhennen“ ? Meiners: vorheer.
25*
387