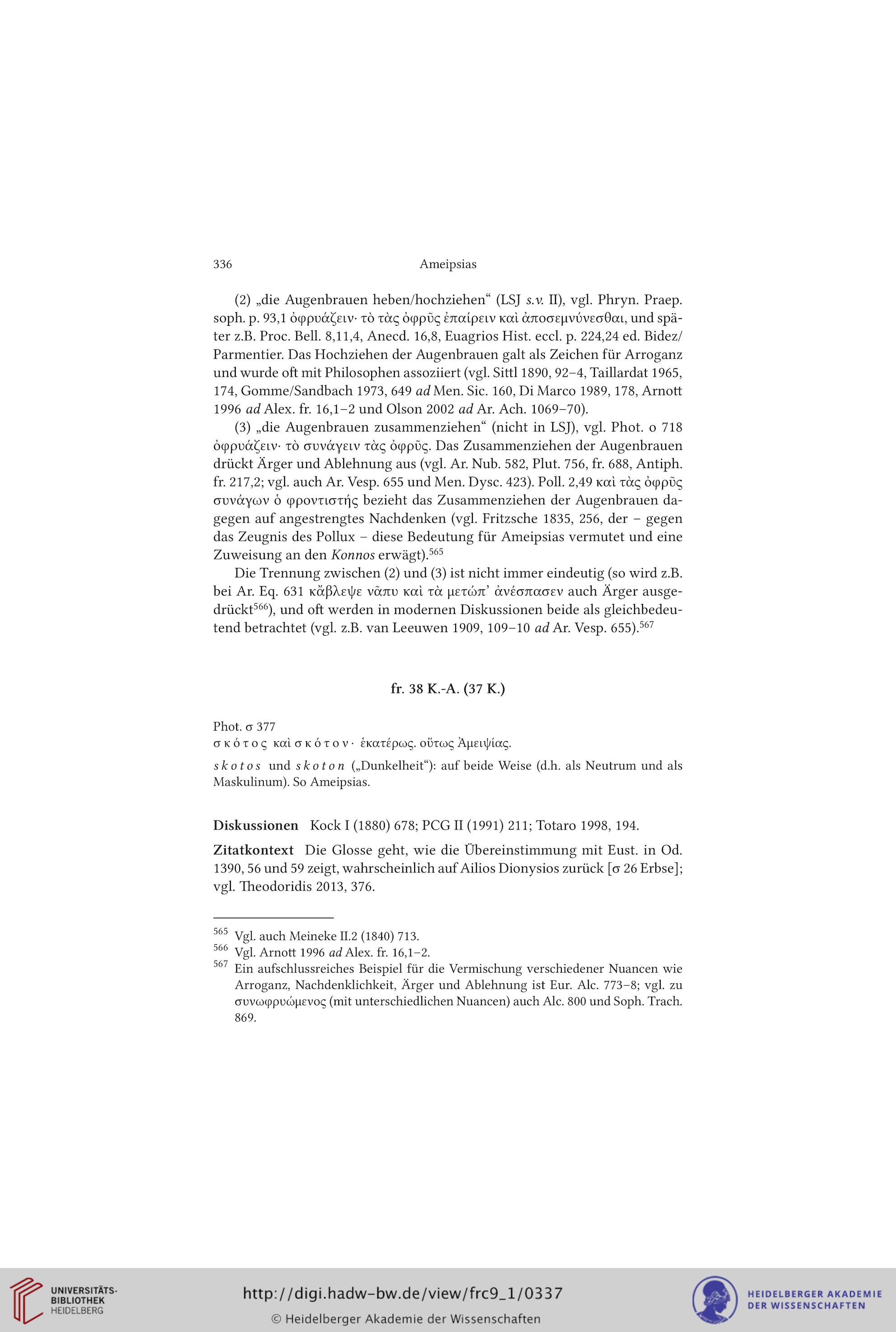336
Ameipsias
(2) „die Augenbrauen heben/hochziehen“ (LSJ s.v. II), vgl. Phryn. Praep.
soph. p. 93,1 όφρυάζειν· τό τάς όφρϋς έπαίρειν και άποσεμνύνεσθαι, und spä-
ter z.B. Proc. Bell. 8,11,4, Anecd. 16,8, Euagrios Hist. eccl. p. 224,24 ed. Bidez/
Parmentier. Das Hochziehen der Augenbrauen galt als Zeichen für Arroganz
und wurde oft mit Philosophen assoziiert (vgl. Sittl 1890, 92-4, Taillardat 1965,
174, Gomme/Sandbach 1973, 649 ad Men. Sic. 160, Di Marco 1989, 178, Arnott
1996 ad Alex. fr. 16,1-2 und Olson 2002 ad Ar. Ach. 1069-70).
(3) „die Augenbrauen zusammenziehen“ (nicht in LSJ), vgl. Phot, o 718
όφρυάζειν· τό συνάγειν τάς όφρϋς. Das Zusammenziehen der Augenbrauen
drückt Ärger und Ablehnung aus (vgl. Ar. Nub. 582, Plut. 756, fr. 688, Antiph.
fr. 217,2; vgl. auch Ar. Vesp. 655 und Men. Dysc. 423). Poll. 2,49 και τάς όφρϋς
συνάγων ό φροντιστής bezieht das Zusammenziehen der Augenbrauen da-
gegen auf angestrengtes Nachdenken (vgl. Fritzsche 1835, 256, der - gegen
das Zeugnis des Pollux - diese Bedeutung für Ameipsias vermutet und eine
Zuweisung an den Konnos erwägt).565
Die Trennung zwischen (2) und (3) ist nicht immer eindeutig (so wird z.B.
bei Ar. Eq. 631 κάβλεψε νάπυ και τά μετώπ’ άνέσπασεν auch Ärger ausge-
drückt566), und oft werden in modernen Diskussionen beide als gleichbedeu-
tend betrachtet (vgl. z.B. van Leeuwen 1909, 109-10 ad Ar. Vesp. 6 55).567
fr. 38 K.-A. (37 K.)
Phot, σ 377
σκότος κάι σ κ ό τ ο v · έκατέρως. οϋτως Άμειψίας.
sko t ο s und sko t ο n („Dunkelheit“): auf beide Weise (d.h. als Neutrum und als
Maskulinum). So Ameipsias.
Diskussionen Kock I (1880) 678; PCG II (1991) 211; Totaro 1998, 194.
Zitatkontext Die Glosse geht, wie die Übereinstimmung mit Eust. in Od.
1390, 56 und 59 zeigt, wahrscheinlich auf Ailios Dionysios zurück [σ 26 Erbse];
vgl. Theodoridis 2013, 376.
565 Vgl. auch Meineke II.2 (1840) 713.
566 Vgl. Arnott 1996 ad Alex. fr. 16,1-2.
567 Ein aufschlussreiches Beispiel für die Vermischung verschiedener Nuancen wie
Arroganz, Nachdenklichkeit, Ärger und Ablehnung ist Eur. Ale. 773-8; vgl. zu
συνωφρυώμενος (mit unterschiedlichen Nuancen) auch Ale. 800 und Soph. Trach.
869.
Ameipsias
(2) „die Augenbrauen heben/hochziehen“ (LSJ s.v. II), vgl. Phryn. Praep.
soph. p. 93,1 όφρυάζειν· τό τάς όφρϋς έπαίρειν και άποσεμνύνεσθαι, und spä-
ter z.B. Proc. Bell. 8,11,4, Anecd. 16,8, Euagrios Hist. eccl. p. 224,24 ed. Bidez/
Parmentier. Das Hochziehen der Augenbrauen galt als Zeichen für Arroganz
und wurde oft mit Philosophen assoziiert (vgl. Sittl 1890, 92-4, Taillardat 1965,
174, Gomme/Sandbach 1973, 649 ad Men. Sic. 160, Di Marco 1989, 178, Arnott
1996 ad Alex. fr. 16,1-2 und Olson 2002 ad Ar. Ach. 1069-70).
(3) „die Augenbrauen zusammenziehen“ (nicht in LSJ), vgl. Phot, o 718
όφρυάζειν· τό συνάγειν τάς όφρϋς. Das Zusammenziehen der Augenbrauen
drückt Ärger und Ablehnung aus (vgl. Ar. Nub. 582, Plut. 756, fr. 688, Antiph.
fr. 217,2; vgl. auch Ar. Vesp. 655 und Men. Dysc. 423). Poll. 2,49 και τάς όφρϋς
συνάγων ό φροντιστής bezieht das Zusammenziehen der Augenbrauen da-
gegen auf angestrengtes Nachdenken (vgl. Fritzsche 1835, 256, der - gegen
das Zeugnis des Pollux - diese Bedeutung für Ameipsias vermutet und eine
Zuweisung an den Konnos erwägt).565
Die Trennung zwischen (2) und (3) ist nicht immer eindeutig (so wird z.B.
bei Ar. Eq. 631 κάβλεψε νάπυ και τά μετώπ’ άνέσπασεν auch Ärger ausge-
drückt566), und oft werden in modernen Diskussionen beide als gleichbedeu-
tend betrachtet (vgl. z.B. van Leeuwen 1909, 109-10 ad Ar. Vesp. 6 55).567
fr. 38 K.-A. (37 K.)
Phot, σ 377
σκότος κάι σ κ ό τ ο v · έκατέρως. οϋτως Άμειψίας.
sko t ο s und sko t ο n („Dunkelheit“): auf beide Weise (d.h. als Neutrum und als
Maskulinum). So Ameipsias.
Diskussionen Kock I (1880) 678; PCG II (1991) 211; Totaro 1998, 194.
Zitatkontext Die Glosse geht, wie die Übereinstimmung mit Eust. in Od.
1390, 56 und 59 zeigt, wahrscheinlich auf Ailios Dionysios zurück [σ 26 Erbse];
vgl. Theodoridis 2013, 376.
565 Vgl. auch Meineke II.2 (1840) 713.
566 Vgl. Arnott 1996 ad Alex. fr. 16,1-2.
567 Ein aufschlussreiches Beispiel für die Vermischung verschiedener Nuancen wie
Arroganz, Nachdenklichkeit, Ärger und Ablehnung ist Eur. Ale. 773-8; vgl. zu
συνωφρυώμενος (mit unterschiedlichen Nuancen) auch Ale. 800 und Soph. Trach.
869.