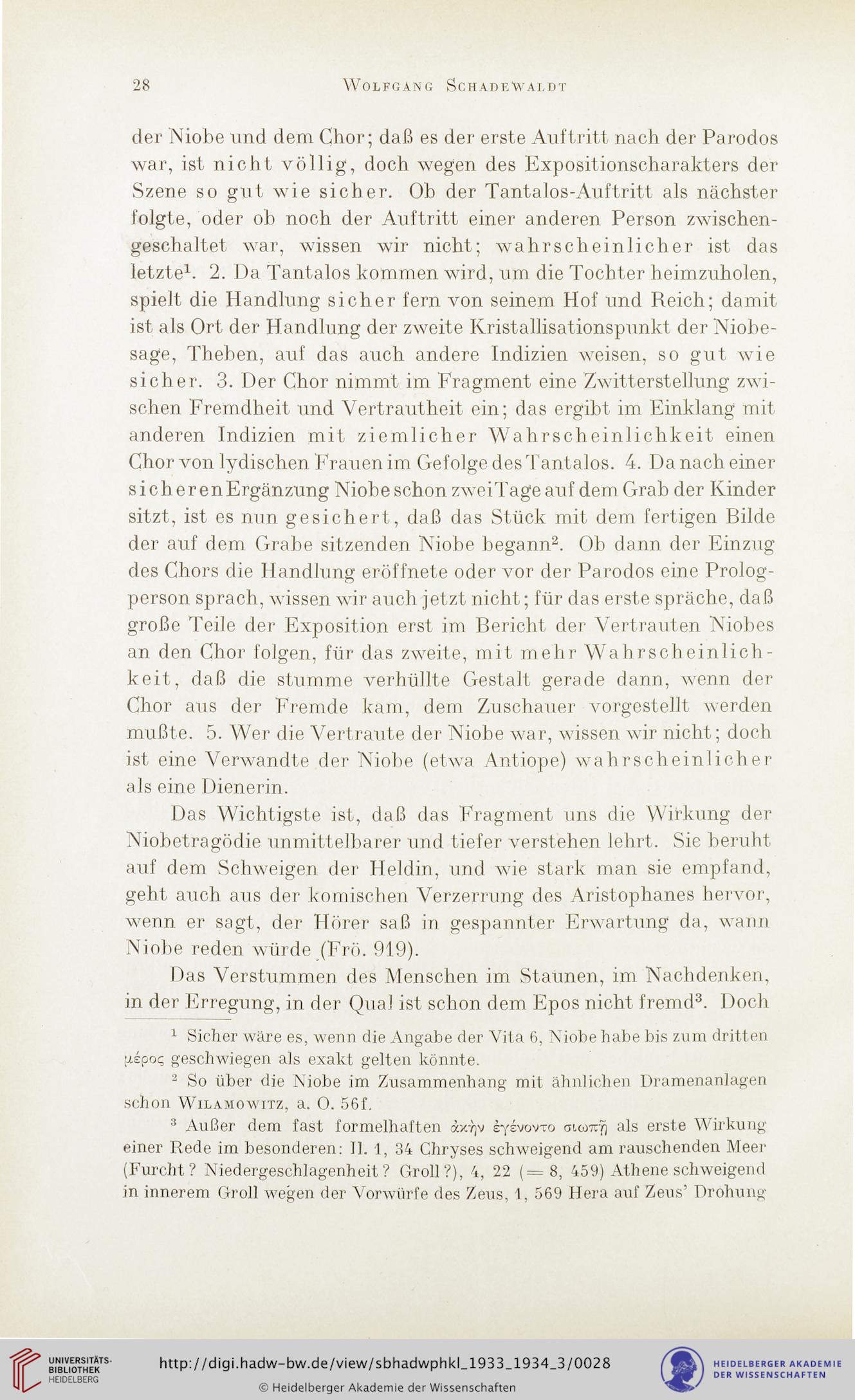28
Wolfgang SchadeWaldt
der Niobe und dem Chor; daß es der erste Auftritt nach der Parodos
war, ist nicht völlig, doch wegen des Expositionscharakters der
Szene so gut wie sicher. Ob der Tantalos-Auftritt als nächster
folgte, oder oh noch der Auftritt einer anderen Person zwischen-
geschaltet war, wissen wir nicht; wahrscheinlicher ist das
letzte1. 2. Da Tantalos kommen wird, um die Tochter heimzuholen,
spielt die Handlung sicher fern von seinem Hof und Reich; damit
ist als Ort der Handlung der zweite Kristallisationspnnkt der Niobe-
sage, Theben, auf das auch andere Indizien weisen, so gut wie
sicher. 3. Der Chor nimmt im Fragment eine Zwitterstellung zwi-
schen Fremdheit und Vertrautheit ein; das ergibt im Einklang mit
anderen Indizien mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen
Chor von lydischen Frauen im Gefolge des Tantalos. 4. Da nach einer
sicheren Ergänzung Niobe schon zwei Tage auf dem Grab der Kinder
sitzt, ist es nun gesichert, daß das Stück mit dem fertigen Bilde
der auf dem Grabe sitzenden Niobe begann2. Ob dann der Einzug
des Chors die Handlung eröffnete oder vor der Parodos eine Prolog-
person sprach, wissen wir auch jetzt nicht; für das erste spräche, daß
große Teile der Exposition erst im Bericht der Vertrauten Niobes
an den Chor folgen, für das zweite, mit mehr Wahrscheinlich-
keit, daß die stumme verhüllte Gestalt gerade dann, wenn der
Chor aus der Fremde kam, dem Zuschauer vorgestellt werden
mußte. 5. Wer die Vertraute der Niobe war, wissen wir nicht; doch
ist eine Wrwandte der Niobe (etwa Antiope) wahrscheinlicher
als eine Dienerin.
Das Wichtigste ist, daß das Fragment uns die Wirkung der
Niobetragödie unmittelbarer und tiefer verstehen lehrt. Sie beruht
auf dem Schweigen der Heldin, und wie stark man sie empfand,
geht auch aus der komischen Verzerrung des Aristophanes hervor,
wenn er sagt, der Hörer saß in gespannter Erwartung da, wann
Niobe reden würde (Frö. 919).
Das Verstummen des Menschen im Staunen, im Nachdenken,
in der Erregung, in der Qual ist schon dem Epos nicht fremd3. Doch
1 Sicher wäre es, wenn die Angabe der Vita 6, Niobe habe bis zum dritten
μέρος geschwiegen als exakt gelten könnte.
2 So über die Niobe im Zusammenhang mit ähnlichen Dramenanlagen
schon Wilamowitz, a. Ο. 56Γ.
3 Außer dem fast formelhaften άκήν έγένοντο σιωπή als erste Wirkung
einer Rede im besonderen: II. 1, 34 Chryses schweigend am rauschenden Meer
(Furcht? Niedergeschlagenheit? Groll?), 4, 22 (= 8, 459) Athene schweigend
in innerem Groll wegen der Vorwürfe des Zeus, 1, 569 Hera auf Zeus’ Drohung
Wolfgang SchadeWaldt
der Niobe und dem Chor; daß es der erste Auftritt nach der Parodos
war, ist nicht völlig, doch wegen des Expositionscharakters der
Szene so gut wie sicher. Ob der Tantalos-Auftritt als nächster
folgte, oder oh noch der Auftritt einer anderen Person zwischen-
geschaltet war, wissen wir nicht; wahrscheinlicher ist das
letzte1. 2. Da Tantalos kommen wird, um die Tochter heimzuholen,
spielt die Handlung sicher fern von seinem Hof und Reich; damit
ist als Ort der Handlung der zweite Kristallisationspnnkt der Niobe-
sage, Theben, auf das auch andere Indizien weisen, so gut wie
sicher. 3. Der Chor nimmt im Fragment eine Zwitterstellung zwi-
schen Fremdheit und Vertrautheit ein; das ergibt im Einklang mit
anderen Indizien mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen
Chor von lydischen Frauen im Gefolge des Tantalos. 4. Da nach einer
sicheren Ergänzung Niobe schon zwei Tage auf dem Grab der Kinder
sitzt, ist es nun gesichert, daß das Stück mit dem fertigen Bilde
der auf dem Grabe sitzenden Niobe begann2. Ob dann der Einzug
des Chors die Handlung eröffnete oder vor der Parodos eine Prolog-
person sprach, wissen wir auch jetzt nicht; für das erste spräche, daß
große Teile der Exposition erst im Bericht der Vertrauten Niobes
an den Chor folgen, für das zweite, mit mehr Wahrscheinlich-
keit, daß die stumme verhüllte Gestalt gerade dann, wenn der
Chor aus der Fremde kam, dem Zuschauer vorgestellt werden
mußte. 5. Wer die Vertraute der Niobe war, wissen wir nicht; doch
ist eine Wrwandte der Niobe (etwa Antiope) wahrscheinlicher
als eine Dienerin.
Das Wichtigste ist, daß das Fragment uns die Wirkung der
Niobetragödie unmittelbarer und tiefer verstehen lehrt. Sie beruht
auf dem Schweigen der Heldin, und wie stark man sie empfand,
geht auch aus der komischen Verzerrung des Aristophanes hervor,
wenn er sagt, der Hörer saß in gespannter Erwartung da, wann
Niobe reden würde (Frö. 919).
Das Verstummen des Menschen im Staunen, im Nachdenken,
in der Erregung, in der Qual ist schon dem Epos nicht fremd3. Doch
1 Sicher wäre es, wenn die Angabe der Vita 6, Niobe habe bis zum dritten
μέρος geschwiegen als exakt gelten könnte.
2 So über die Niobe im Zusammenhang mit ähnlichen Dramenanlagen
schon Wilamowitz, a. Ο. 56Γ.
3 Außer dem fast formelhaften άκήν έγένοντο σιωπή als erste Wirkung
einer Rede im besonderen: II. 1, 34 Chryses schweigend am rauschenden Meer
(Furcht? Niedergeschlagenheit? Groll?), 4, 22 (= 8, 459) Athene schweigend
in innerem Groll wegen der Vorwürfe des Zeus, 1, 569 Hera auf Zeus’ Drohung