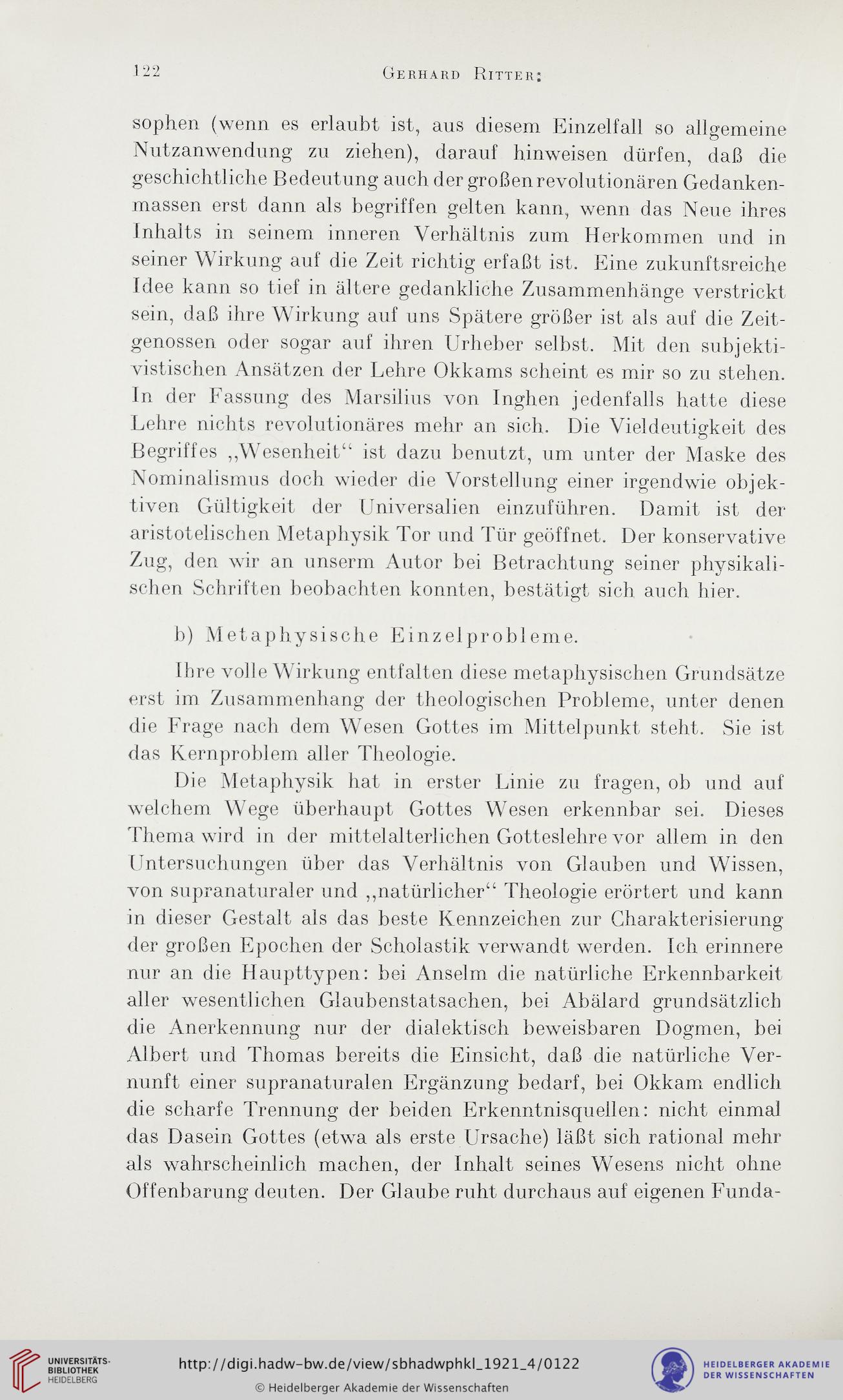122
Gerhard Ritter;
sophen (wenn es erlaubt ist, aus diesem Einzelfall so allgemeine
Nutzanwendung zu ziehen), darauf hinweisen dürfen, daß die
geschichtliche Bedeutung auch der großen revolutionären Gedanken-
massen erst dann als begriffen gelten kann, wenn das Neue ihres
Inhalts in seinem inneren Verhältnis zum Herkommen und in
seiner Wirkung auf die Zeit richtig erfaßt ist. Eine zukunftsreiche
Idee kann so tief in ältere gedankliche Zusammenhänge verstrickt
sein, daß ihre Wirkung auf uns Spätere größer ist als auf die Zeit-
genossen oder sogar auf ihren Urheber selbst. Mit den subjekti-
vistischen Ansätzen der Lehre Okkams scheint es mir so zu stehen.
In der Fassung des Marsilius von Inghen jedenfalls hatte diese
Lehre nichts revolutionäres mehr an sich. Die Vieldeutigkeit des
Begriffes „Wesenheit“ ist dazu benutzt, um unter der Maske des
Nominalismus doch wieder die Vorstellung einer irgendwie objek-
tiven Gültigkeit der Universalien einzuführen. Damit ist der
aristotelischen Metaphysik Tor und Tür geöffnet. Der konservative
Zug, den wir an unserm Autor bei Betrachtung seiner physikali-
schen Schriften beobachten konnten, bestätigt sich auch hier.
b) Metaphysische Einzelprobleme.
Ihre volle Wirkung entfalten diese metaphysischen Grundsätze
erst im Zusammenhang der theologischen Probleme, unter denen
die Frage nach dem Wesen Gottes im Mittelpunkt steht. Sie ist
das Kernproblem aller Theologie.
Die Metaphysik hat in erster Linie zu fragen, ob und auf
welchem Wege überhaupt Gottes Wesen erkennbar sei. Dieses
Thema wird in der mittelalterlichen Gotteslehre vor allem in den
Untersuchungen über das Verhältnis von Glauben und Wissen,
von supranaturaler und „natürlicher“ Theologie erörtert und kann
in dieser Gestalt als das beste Kennzeichen zur Charakterisierung
der großen Epochen der Scholastik verwandt werden. Ich erinnere
nur an die Haupttypen: bei Anselm die natürliche Erkennbarkeit
aller wesentlichen Glaubenstatsachen, bei Abälard grundsätzlich
die Anerkennung nur der dialektisch beweisbaren Dogmen, bei
Albert und Thomas bereits die Einsicht, daß die natürliche Ver-
nunft einer supranaturalen Ergänzung bedarf, bei Okkam endlich
die scharfe Trennung der beiden Erkenntnisquellen: nicht einmal
das Dasein Gottes (etwa als erste Ursache) läßt sich rational mehr
als wahrscheinlich machen, der Inhalt seines Wesens nicht ohne
Offenbarung deuten. Der Glaube ruht durchaus auf eigenen Funda-
Gerhard Ritter;
sophen (wenn es erlaubt ist, aus diesem Einzelfall so allgemeine
Nutzanwendung zu ziehen), darauf hinweisen dürfen, daß die
geschichtliche Bedeutung auch der großen revolutionären Gedanken-
massen erst dann als begriffen gelten kann, wenn das Neue ihres
Inhalts in seinem inneren Verhältnis zum Herkommen und in
seiner Wirkung auf die Zeit richtig erfaßt ist. Eine zukunftsreiche
Idee kann so tief in ältere gedankliche Zusammenhänge verstrickt
sein, daß ihre Wirkung auf uns Spätere größer ist als auf die Zeit-
genossen oder sogar auf ihren Urheber selbst. Mit den subjekti-
vistischen Ansätzen der Lehre Okkams scheint es mir so zu stehen.
In der Fassung des Marsilius von Inghen jedenfalls hatte diese
Lehre nichts revolutionäres mehr an sich. Die Vieldeutigkeit des
Begriffes „Wesenheit“ ist dazu benutzt, um unter der Maske des
Nominalismus doch wieder die Vorstellung einer irgendwie objek-
tiven Gültigkeit der Universalien einzuführen. Damit ist der
aristotelischen Metaphysik Tor und Tür geöffnet. Der konservative
Zug, den wir an unserm Autor bei Betrachtung seiner physikali-
schen Schriften beobachten konnten, bestätigt sich auch hier.
b) Metaphysische Einzelprobleme.
Ihre volle Wirkung entfalten diese metaphysischen Grundsätze
erst im Zusammenhang der theologischen Probleme, unter denen
die Frage nach dem Wesen Gottes im Mittelpunkt steht. Sie ist
das Kernproblem aller Theologie.
Die Metaphysik hat in erster Linie zu fragen, ob und auf
welchem Wege überhaupt Gottes Wesen erkennbar sei. Dieses
Thema wird in der mittelalterlichen Gotteslehre vor allem in den
Untersuchungen über das Verhältnis von Glauben und Wissen,
von supranaturaler und „natürlicher“ Theologie erörtert und kann
in dieser Gestalt als das beste Kennzeichen zur Charakterisierung
der großen Epochen der Scholastik verwandt werden. Ich erinnere
nur an die Haupttypen: bei Anselm die natürliche Erkennbarkeit
aller wesentlichen Glaubenstatsachen, bei Abälard grundsätzlich
die Anerkennung nur der dialektisch beweisbaren Dogmen, bei
Albert und Thomas bereits die Einsicht, daß die natürliche Ver-
nunft einer supranaturalen Ergänzung bedarf, bei Okkam endlich
die scharfe Trennung der beiden Erkenntnisquellen: nicht einmal
das Dasein Gottes (etwa als erste Ursache) läßt sich rational mehr
als wahrscheinlich machen, der Inhalt seines Wesens nicht ohne
Offenbarung deuten. Der Glaube ruht durchaus auf eigenen Funda-