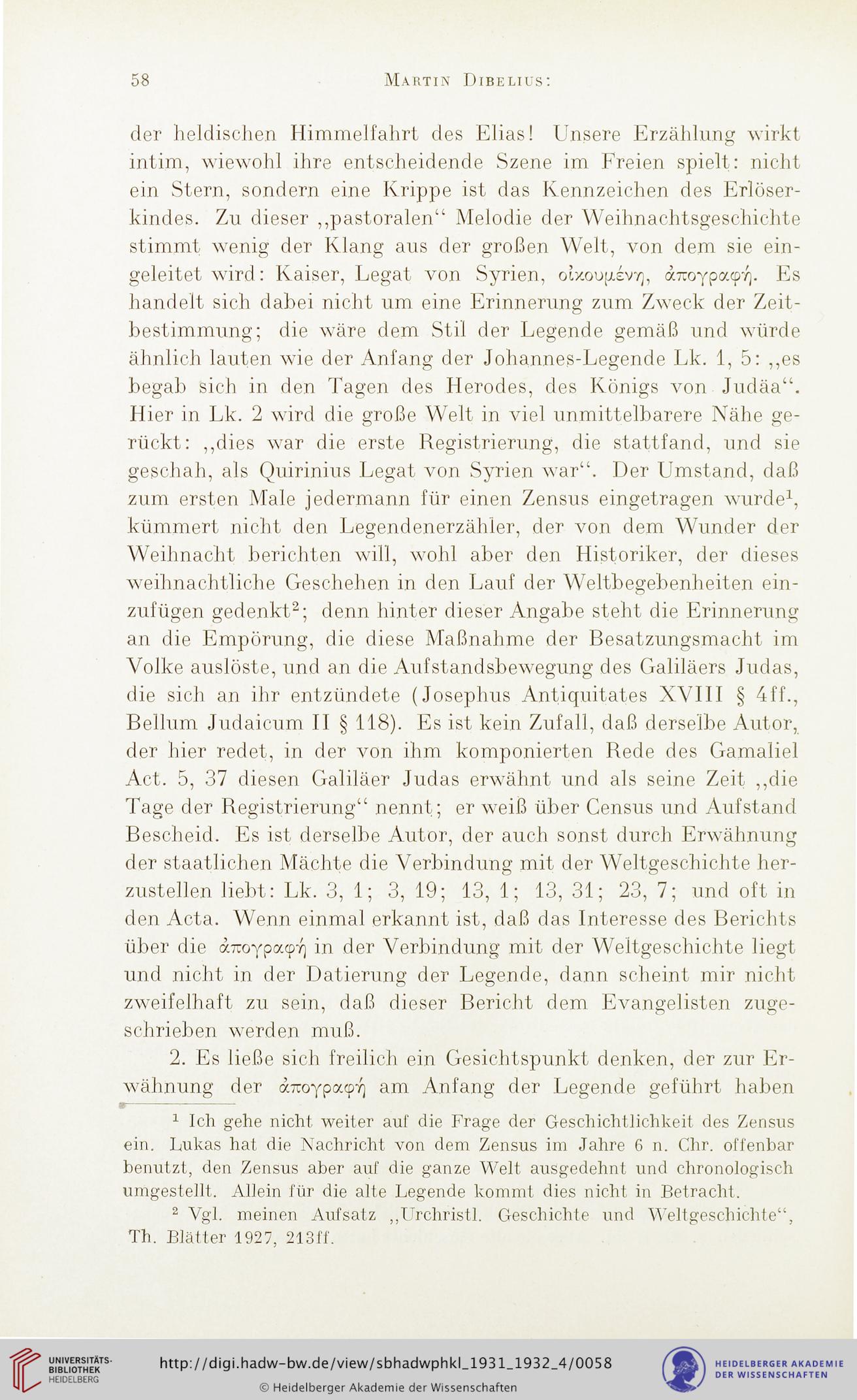58
Martin Dibeliüs:
der heldischen Himmelfahrt des Elias! Unsere Erzählung wirkt
intim, wiewohl ihre entscheidende Szene im Freien spielt: nicht
ein Stern, sondern eine Krippe ist das Kennzeichen des Erlöser-
kindes. Zu dieser „pastoralen“ Melodie der Weihnachtsgeschichte
stimmt wenig der Klang aus der großen Welt, von dem sie ein-
geleitet wird: Kaiser, Legat von Syrien, οικουμένη, άπογραφή. Es
handelt sich dabei nicht um eine Erinnerung zum Zweck der Zeit-
bestimmung; die wäre dem Stil der Legende gemäß und würde
ähnlich lauten wie der Anfang der Johannes-Legencle Lk. 1, 5: ,,es
begab sich in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa“.
Hier in Lk. 2 wird die große Welt in viel unmittelbarere Nähe ge-
rückt: „dies war die erste Registrierung, die stattfand, und sie
geschah, als Quirinius Legat von Syrien war“. Der Umstand, daß
zum ersten Male jedermann für einen Zensus eingetragen wurde1,
kümmert nicht den Legendenerzähler, der von dem Wunder der
Weihnacht berichten will, wohl aber den Historiker, der dieses
weihnachtliche Geschehen in den Lauf der Weltbegebenheiten ein-
zufügen gedenkt2; denn hinter dieser Angabe steht die Erinnerung
an die Empörung, die diese Maßnahme der Besatzungsmacht im
Volke auslöste, und an die Aufstandsbewegung des Galiläers Judas,
die sich an ihr entzündete (Josephus Antiquitates XVIII § 4ff.,
Bellum Judaicum II § 118). Es ist kein Zufall, daß derselbe Autor,
der hier redet, in der von ihm komponierten Rede des Gamaliel
Act. 5, 37 diesen Galiläer Judas erwähnt und als seine Zeit „die
Tage der Registrierung“ nennt; er weiß über Census und Aufstand
Bescheid. Es ist derselbe Autor, der auch sonst durch Erwähnung
der staatlichen Mächte die Verbindung mit der Weltgeschichte her-
zustellen liebt: Lk. 3, 1; 3, 19; 13, 1; 13, 31; 23, 7; und oft in
den Acta. Wenn einmal erkannt ist, daß das Interesse des Berichts
über die άπογραφή in der Verbindung mit der Weltgeschichte liegt
und nicht in der Datierung der Legende, dann scheint mir nicht
zweifelhaft zu sein, daß dieser Bericht dem Evangelisten zuge-
schrieben werden muß.
2. Es ließe sich freilich ein Gesichtspunkt denken, der zur Er-
wähnung der άπογραφή am Anfang der Legende geführt haben
1 Ich gehe nicht weiter aut' die Frage der Geschichtlichkeit des Zensus
ein. Lukas hat die Nachricht von dem Zensus im Jahre 6 n. Chr. offenbar
benutzt, den Zensus aber auf die ganze Welt ausgedehnt und chronologisch
umgestellt. Allein für die alte Legende kommt dies nicht in Betracht.
2 Vgl. meinen Aufsatz „Urchristl. Geschichte und Weltgeschichte“,
Th. Blätter 1927, 213ff.
Martin Dibeliüs:
der heldischen Himmelfahrt des Elias! Unsere Erzählung wirkt
intim, wiewohl ihre entscheidende Szene im Freien spielt: nicht
ein Stern, sondern eine Krippe ist das Kennzeichen des Erlöser-
kindes. Zu dieser „pastoralen“ Melodie der Weihnachtsgeschichte
stimmt wenig der Klang aus der großen Welt, von dem sie ein-
geleitet wird: Kaiser, Legat von Syrien, οικουμένη, άπογραφή. Es
handelt sich dabei nicht um eine Erinnerung zum Zweck der Zeit-
bestimmung; die wäre dem Stil der Legende gemäß und würde
ähnlich lauten wie der Anfang der Johannes-Legencle Lk. 1, 5: ,,es
begab sich in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa“.
Hier in Lk. 2 wird die große Welt in viel unmittelbarere Nähe ge-
rückt: „dies war die erste Registrierung, die stattfand, und sie
geschah, als Quirinius Legat von Syrien war“. Der Umstand, daß
zum ersten Male jedermann für einen Zensus eingetragen wurde1,
kümmert nicht den Legendenerzähler, der von dem Wunder der
Weihnacht berichten will, wohl aber den Historiker, der dieses
weihnachtliche Geschehen in den Lauf der Weltbegebenheiten ein-
zufügen gedenkt2; denn hinter dieser Angabe steht die Erinnerung
an die Empörung, die diese Maßnahme der Besatzungsmacht im
Volke auslöste, und an die Aufstandsbewegung des Galiläers Judas,
die sich an ihr entzündete (Josephus Antiquitates XVIII § 4ff.,
Bellum Judaicum II § 118). Es ist kein Zufall, daß derselbe Autor,
der hier redet, in der von ihm komponierten Rede des Gamaliel
Act. 5, 37 diesen Galiläer Judas erwähnt und als seine Zeit „die
Tage der Registrierung“ nennt; er weiß über Census und Aufstand
Bescheid. Es ist derselbe Autor, der auch sonst durch Erwähnung
der staatlichen Mächte die Verbindung mit der Weltgeschichte her-
zustellen liebt: Lk. 3, 1; 3, 19; 13, 1; 13, 31; 23, 7; und oft in
den Acta. Wenn einmal erkannt ist, daß das Interesse des Berichts
über die άπογραφή in der Verbindung mit der Weltgeschichte liegt
und nicht in der Datierung der Legende, dann scheint mir nicht
zweifelhaft zu sein, daß dieser Bericht dem Evangelisten zuge-
schrieben werden muß.
2. Es ließe sich freilich ein Gesichtspunkt denken, der zur Er-
wähnung der άπογραφή am Anfang der Legende geführt haben
1 Ich gehe nicht weiter aut' die Frage der Geschichtlichkeit des Zensus
ein. Lukas hat die Nachricht von dem Zensus im Jahre 6 n. Chr. offenbar
benutzt, den Zensus aber auf die ganze Welt ausgedehnt und chronologisch
umgestellt. Allein für die alte Legende kommt dies nicht in Betracht.
2 Vgl. meinen Aufsatz „Urchristl. Geschichte und Weltgeschichte“,
Th. Blätter 1927, 213ff.