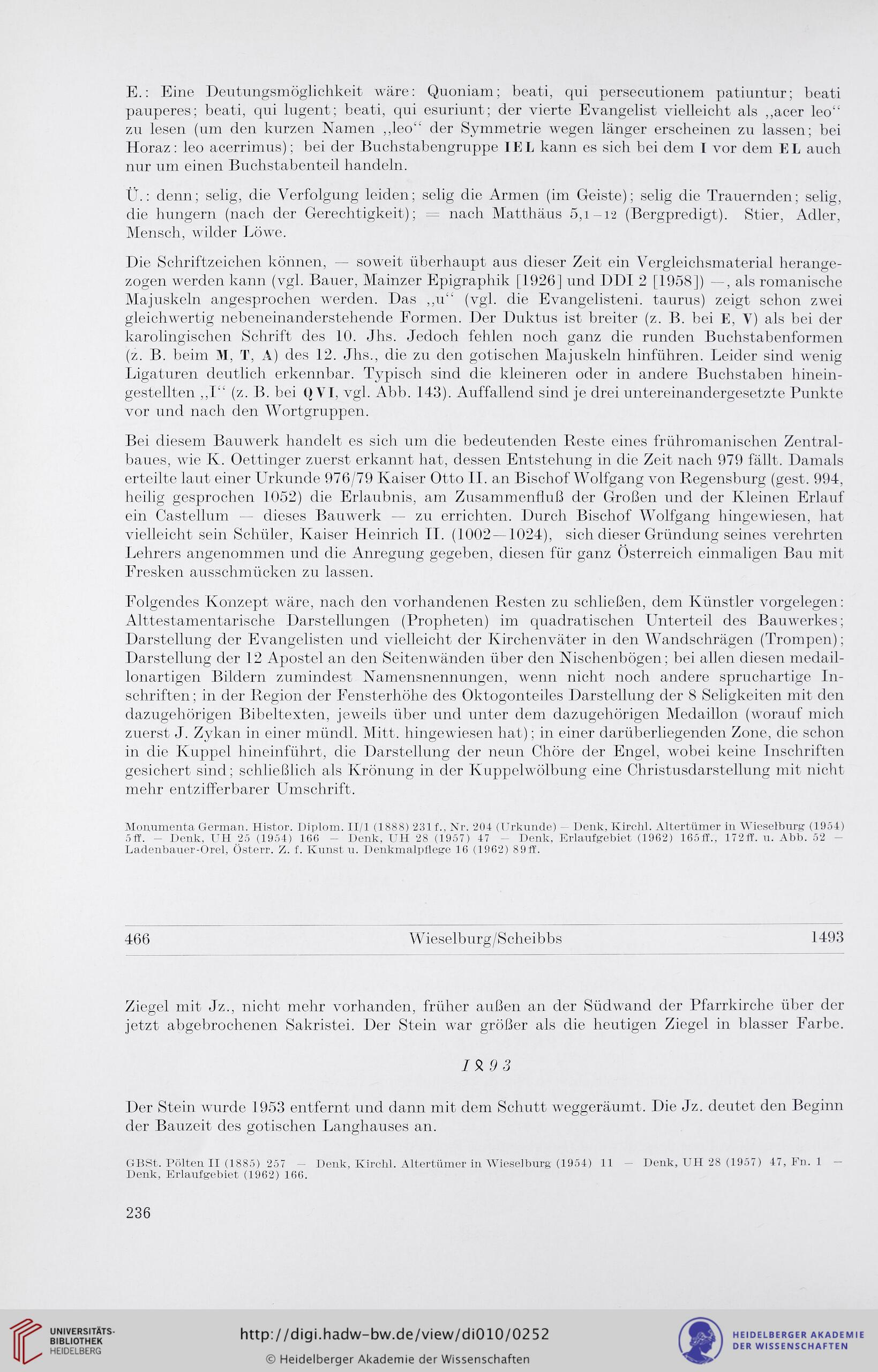E.: Eine Deutungsmöglichkeit wäre: Quoniam; beati. qui persecutionem patiuntur; beati
pauperes; beati, qui lugent; beati, qui esuriunt; der vierte Evangelist vielleicht als „acer leo“
zu lesen (um den kurzen Namen „leo“ der Symmetrie wegen länger erscheinen zu lassen; bei
Horaz: leo acerrimus); bei der Buchstabengruppe IEL kann es sich bei dem I vor dem EL auch
nur um einen Buchstabenteil handeln.
Ü.: denn; selig, die Verfolgung leiden; selig die Armen (im Geiste); selig die Trauernden; selig,
die hungern (nach der Gerechtigkeit); = nach Matthäus 5,1-12 (Bergpredigt). Stier, Adler,
Mensch, wilder Löwe.
Die Schriftzeichen können, — soweit überhaupt aus dieser Zeit ein Vergleichsmaterial herange-
zogen werden kann (vgl. Bauer, Mainzer Epigraphik [1926] und DDI 2 [1958]) —, als romanische
Majuskeln angesprochen werden. Das ,,u“ (vgl. die Evangelisten!. taurus) zeigt schon zwei
gleichwertig nebeneinanderstehende Formen. Der Duktus ist breiter (z. B. bei E, V) als bei der
karolingischen Schrift des 10. Jhs. Jedoch fehlen noch ganz die runden Buchstabenformen
(z. B. beim M, T, A) des 12. Jhs., die zu den gotischen Majuskeln hinführen. Leider sind wenig
Ligaturen deutlich erkennbar. Typisch sind die kleineren oder in andere Buchstaben hinein-
gestellten „I“ (z. B. bei Q VI, vgl. Abb. 143). Auffallend sind je drei untereinandergesetzte Punkte
vor und nach den Wortgruppen.
Bei diesem Bauwerk handelt es sich um die bedeutenden Reste eines frühromanischen Zentral-
baues, wie K. Oettinger zuerst erkannt hat, dessen Entstehung in die Zeit nach 979 fällt. Damals
erteilte laut einer Urkunde 976/79 Kaiser Otto II. an Bischof Wolfgang von Regensburg (gest. 994,
heilig gesprochen 1052) die Erlaubnis, am Zusammenfluß der Großen und der Kleinen Erlauf
ein Casteilum — dieses Bauwerk — zu errichten. Durch Bischof Wolfgang hingewiesen, hat
vielleicht sein Schüler, Kaiser Heinrich II. (1002 —1024), sich dieser Gründung seines verehrten
Lehrers angenommen und die Anregung gegeben, diesen für ganz Österreich einmaligen Bau mit
Fresken ausschmücken zu lassen.
Folgendes Konzept wäre, nach den vorhandenen Resten zu schließen, dem Künstler vorgelegen:
Alttestamentarische Darstellungen (Propheten) im quadratischen Unterteil des Bauwerkes;
Darstellung der Evangelisten und vielleicht der Kirchenväter in den Wandschrägen (Trompen);
Darstellung der 12 Apostel an den Seiten wänden über den Nischenbögen; bei allen diesen medail-
lonartigen Bildern zumindest Namensnennungen, wenn nicht noch andere spruchartige In-
schriften; in der Region der Fensterhöhe des Oktogonteiles Darstellung der 8 Seligkeiten mit den
dazugehörigen Bibeltexten, jeweils über und unter dem dazugehörigen Medaillon (worauf mich
zuerst J. Zykan in einer mündl. Mitt, hingewiesen hat); in einer darüberliegenden Zone, die schon
in die Kuppel hineinführt, die Darstellung der neun Chöre der Engel, wobei keine Inschriften
gesichert sind: schließlich als Krönung in der Kuppelwölbung eine Christusdarstellung mit nicht
mehr entzifferbarer Umschrift.
Monumenta German. Histor. Diplom. II/l (1888) 231 f., Nr. 204 (Urkunde) — Denk. Kirchl. Altertümer in Wieselburg (1954)
5ff. - Denk. UH 25 (1954) 166 - Denk, UH 28 (1957) 47 - Denk. Erlaufgebiet (1962) 165ff.. 172ff. u. Abb. 52 -
Ladenbauer-Orel, Österr. Z. f. Kunst u. Denkmalpflege 16 (1962) 89ff.
466
Wieselburg/Scheibbs
1493
Ziegel mit Jz„ nicht mehr vorhanden, früher außen an der Südwand der Pfarrkirche über der
jetzt abgebrochenen Sakristei. Der Stein war größer als die heutigen Ziegel in blasser Farbe.
JS 9 3
Der Stein wurde 1953 entfernt und dann mit dem Schutt weggeräumt. Die Jz. deutet den Beginn
der Bauzeit des gotischen Langhauses an.
GBSt. Pölten II (1885) 257 — Denk, Kirchl. Altertümer in Wieselburg (1954) 11
Denk, Erlaufgebiet (1962) 166.
Denk, UH 28 (1957) 47, En. 1 -
236
pauperes; beati, qui lugent; beati, qui esuriunt; der vierte Evangelist vielleicht als „acer leo“
zu lesen (um den kurzen Namen „leo“ der Symmetrie wegen länger erscheinen zu lassen; bei
Horaz: leo acerrimus); bei der Buchstabengruppe IEL kann es sich bei dem I vor dem EL auch
nur um einen Buchstabenteil handeln.
Ü.: denn; selig, die Verfolgung leiden; selig die Armen (im Geiste); selig die Trauernden; selig,
die hungern (nach der Gerechtigkeit); = nach Matthäus 5,1-12 (Bergpredigt). Stier, Adler,
Mensch, wilder Löwe.
Die Schriftzeichen können, — soweit überhaupt aus dieser Zeit ein Vergleichsmaterial herange-
zogen werden kann (vgl. Bauer, Mainzer Epigraphik [1926] und DDI 2 [1958]) —, als romanische
Majuskeln angesprochen werden. Das ,,u“ (vgl. die Evangelisten!. taurus) zeigt schon zwei
gleichwertig nebeneinanderstehende Formen. Der Duktus ist breiter (z. B. bei E, V) als bei der
karolingischen Schrift des 10. Jhs. Jedoch fehlen noch ganz die runden Buchstabenformen
(z. B. beim M, T, A) des 12. Jhs., die zu den gotischen Majuskeln hinführen. Leider sind wenig
Ligaturen deutlich erkennbar. Typisch sind die kleineren oder in andere Buchstaben hinein-
gestellten „I“ (z. B. bei Q VI, vgl. Abb. 143). Auffallend sind je drei untereinandergesetzte Punkte
vor und nach den Wortgruppen.
Bei diesem Bauwerk handelt es sich um die bedeutenden Reste eines frühromanischen Zentral-
baues, wie K. Oettinger zuerst erkannt hat, dessen Entstehung in die Zeit nach 979 fällt. Damals
erteilte laut einer Urkunde 976/79 Kaiser Otto II. an Bischof Wolfgang von Regensburg (gest. 994,
heilig gesprochen 1052) die Erlaubnis, am Zusammenfluß der Großen und der Kleinen Erlauf
ein Casteilum — dieses Bauwerk — zu errichten. Durch Bischof Wolfgang hingewiesen, hat
vielleicht sein Schüler, Kaiser Heinrich II. (1002 —1024), sich dieser Gründung seines verehrten
Lehrers angenommen und die Anregung gegeben, diesen für ganz Österreich einmaligen Bau mit
Fresken ausschmücken zu lassen.
Folgendes Konzept wäre, nach den vorhandenen Resten zu schließen, dem Künstler vorgelegen:
Alttestamentarische Darstellungen (Propheten) im quadratischen Unterteil des Bauwerkes;
Darstellung der Evangelisten und vielleicht der Kirchenväter in den Wandschrägen (Trompen);
Darstellung der 12 Apostel an den Seiten wänden über den Nischenbögen; bei allen diesen medail-
lonartigen Bildern zumindest Namensnennungen, wenn nicht noch andere spruchartige In-
schriften; in der Region der Fensterhöhe des Oktogonteiles Darstellung der 8 Seligkeiten mit den
dazugehörigen Bibeltexten, jeweils über und unter dem dazugehörigen Medaillon (worauf mich
zuerst J. Zykan in einer mündl. Mitt, hingewiesen hat); in einer darüberliegenden Zone, die schon
in die Kuppel hineinführt, die Darstellung der neun Chöre der Engel, wobei keine Inschriften
gesichert sind: schließlich als Krönung in der Kuppelwölbung eine Christusdarstellung mit nicht
mehr entzifferbarer Umschrift.
Monumenta German. Histor. Diplom. II/l (1888) 231 f., Nr. 204 (Urkunde) — Denk. Kirchl. Altertümer in Wieselburg (1954)
5ff. - Denk. UH 25 (1954) 166 - Denk, UH 28 (1957) 47 - Denk. Erlaufgebiet (1962) 165ff.. 172ff. u. Abb. 52 -
Ladenbauer-Orel, Österr. Z. f. Kunst u. Denkmalpflege 16 (1962) 89ff.
466
Wieselburg/Scheibbs
1493
Ziegel mit Jz„ nicht mehr vorhanden, früher außen an der Südwand der Pfarrkirche über der
jetzt abgebrochenen Sakristei. Der Stein war größer als die heutigen Ziegel in blasser Farbe.
JS 9 3
Der Stein wurde 1953 entfernt und dann mit dem Schutt weggeräumt. Die Jz. deutet den Beginn
der Bauzeit des gotischen Langhauses an.
GBSt. Pölten II (1885) 257 — Denk, Kirchl. Altertümer in Wieselburg (1954) 11
Denk, Erlaufgebiet (1962) 166.
Denk, UH 28 (1957) 47, En. 1 -
236