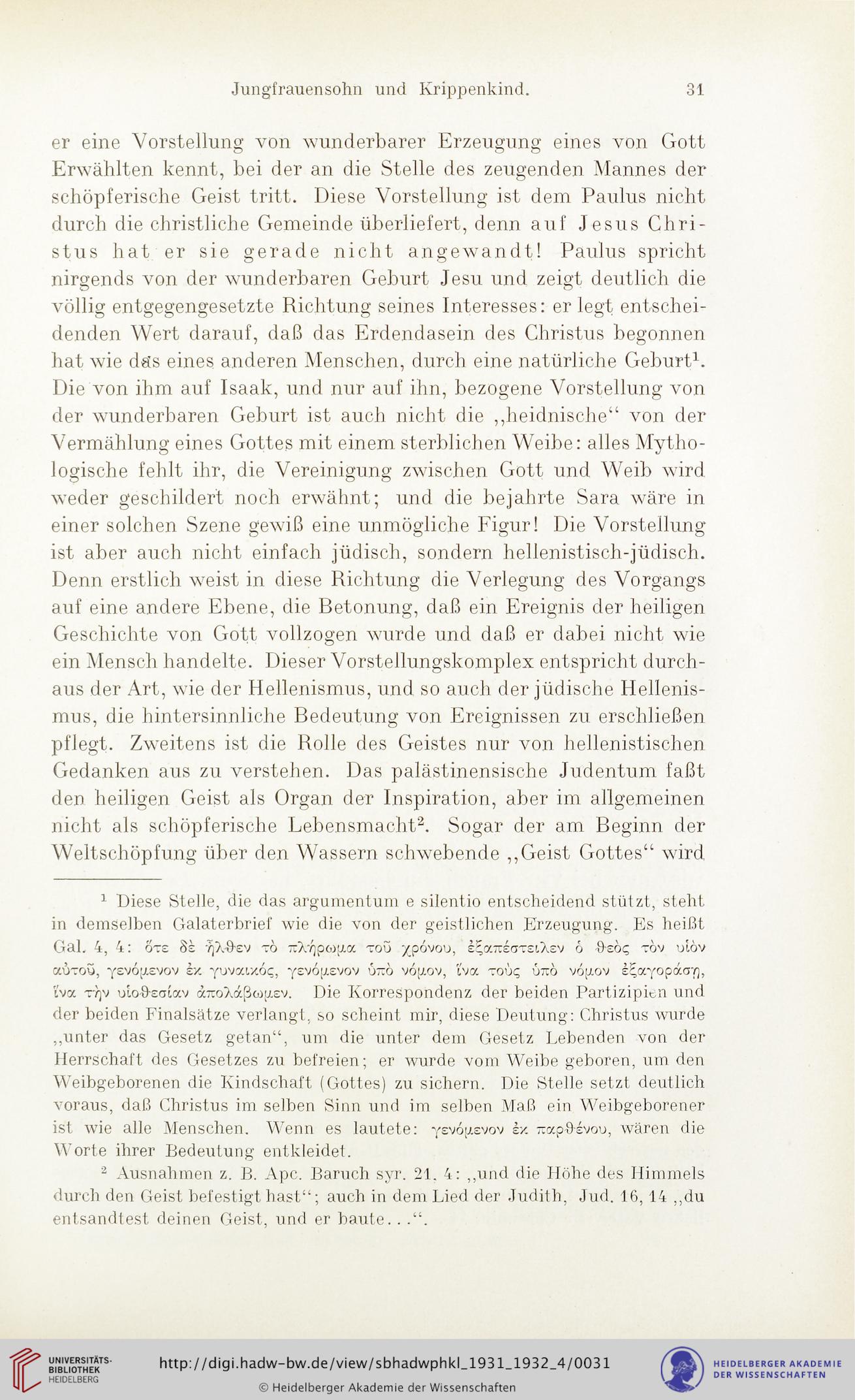Jun gf rauen sohn und Krippenkind.
31
er eine Vorstellung von wunderbarer Erzeugung eines von Gott
Erwählten kennt, bei der an die Stelle des zeugenden Mannes der
schöpferische Geist tritt. Diese Vorstellung ist dem Paulus nicht
durch die christliche Gemeinde überliefert, denn auf Jesus Chri-
stus hat er sie gerade nicht angewandt! Paulus spricht
nirgends von der wunderbaren Geburt Jesu und zeigt deutlich die
völlig entgegengesetzte Richtung seines Interesses: er legt entschei-
denden Wert darauf, daß das Erdendasein des Christus begonnen
hat wie das eines anderen Menschen, durch eine natürliche Geburt1.
Die von ihm auf Isaak, und nur auf ihn, bezogene Vorstellung von
der wunderbaren Geburt ist auch nicht die „heidnische“ von der
Vermählung eines Gottes mit einem sterblichen Weibe: alles Mytho-
logische fehlt ihr, die Vereinigung zwischen Gott und Weib wird
weder geschildert noch erwähnt; und die bejahrte Sara wäre in
einer solchen Szene gewiß eine unmögliche Figur! Die Vorstellung
ist aber auch nicht einfach jüdisch, sondern hellenistisch-jüdisch.
Denn erstlich weist in diese Richtung die Verlegung des Vorgangs
auf eine andere Ebene, die Retonung, daß ein Ereignis der heiligen
Geschichte von Gott vollzogen wurde und daß er dabei nicht wie
ein Mensch handelte. Dieser Vorstellungskomplex entspricht durch-
aus der Art, wie der Hellenismus, und so auch der jüdische Hellenis-
mus, die hintersinnliche Bedeutung von Ereignissen zu erschließen
pflegt. Zweitens ist die Rolle des Geistes nur von hellenistischen
Gedanken aus zu verstehen. Das palästinensische Judentum faßt
den heiligen Geist als Organ der Inspiration, aber im allgemeinen
nicht als schöpferische Lebensmacht2. Sogar der am Beginn der
Weltschöpfung über den Wassern schwebende „Geist Gottes“ wird
1 Diese Stelle, die das argumentum e silentio entscheidend stützt, steht
in demselben Galaterbrief wie die von der geistlichen Erzeugung. Es heißt
Gal. 4, 4: δτε δέ ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, έξαπέστειλεν ό θεός τον υιόν
αύτοΰ, γενόμενον έκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ί'να τούς ύπό νόμον έξαγοράση,
ϊνα την υιοθεσίαν άπολάβωμεν. Die Korrespondenz der beiden Partizipien und
der beiden Finalsätze verlangt, so scheint mir, diese Deutung: Christus wurde
„unter das Gesetz getan“, um die unter dem Gesetz Lebenden von der
Herrschaft des Gesetzes zu befreien; er wurde vom Weibe geboren, um den
Weibgeborenen die Kindschaft (Gottes) zu sichern. Die Stelle setzt deutlich
voraus, daß Christus im selben Sinn und im selben Maß ein Weibgeborener
ist wie alle Menschen. Wenn es lautete: γενόμενον έκ παρθένου, wären die
Worte ihrer Bedeutung entkleidet.
2 Ausnahmen z. B. Apc. Baruch syr. 21. 4: „und die Höhe des Himmels
durch den Geist befestigt hast“; auch in dem Lied der Judith, Jud. 16,14 „du
entsandtest deinen Geist, und er baute.. .“.
31
er eine Vorstellung von wunderbarer Erzeugung eines von Gott
Erwählten kennt, bei der an die Stelle des zeugenden Mannes der
schöpferische Geist tritt. Diese Vorstellung ist dem Paulus nicht
durch die christliche Gemeinde überliefert, denn auf Jesus Chri-
stus hat er sie gerade nicht angewandt! Paulus spricht
nirgends von der wunderbaren Geburt Jesu und zeigt deutlich die
völlig entgegengesetzte Richtung seines Interesses: er legt entschei-
denden Wert darauf, daß das Erdendasein des Christus begonnen
hat wie das eines anderen Menschen, durch eine natürliche Geburt1.
Die von ihm auf Isaak, und nur auf ihn, bezogene Vorstellung von
der wunderbaren Geburt ist auch nicht die „heidnische“ von der
Vermählung eines Gottes mit einem sterblichen Weibe: alles Mytho-
logische fehlt ihr, die Vereinigung zwischen Gott und Weib wird
weder geschildert noch erwähnt; und die bejahrte Sara wäre in
einer solchen Szene gewiß eine unmögliche Figur! Die Vorstellung
ist aber auch nicht einfach jüdisch, sondern hellenistisch-jüdisch.
Denn erstlich weist in diese Richtung die Verlegung des Vorgangs
auf eine andere Ebene, die Retonung, daß ein Ereignis der heiligen
Geschichte von Gott vollzogen wurde und daß er dabei nicht wie
ein Mensch handelte. Dieser Vorstellungskomplex entspricht durch-
aus der Art, wie der Hellenismus, und so auch der jüdische Hellenis-
mus, die hintersinnliche Bedeutung von Ereignissen zu erschließen
pflegt. Zweitens ist die Rolle des Geistes nur von hellenistischen
Gedanken aus zu verstehen. Das palästinensische Judentum faßt
den heiligen Geist als Organ der Inspiration, aber im allgemeinen
nicht als schöpferische Lebensmacht2. Sogar der am Beginn der
Weltschöpfung über den Wassern schwebende „Geist Gottes“ wird
1 Diese Stelle, die das argumentum e silentio entscheidend stützt, steht
in demselben Galaterbrief wie die von der geistlichen Erzeugung. Es heißt
Gal. 4, 4: δτε δέ ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, έξαπέστειλεν ό θεός τον υιόν
αύτοΰ, γενόμενον έκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ί'να τούς ύπό νόμον έξαγοράση,
ϊνα την υιοθεσίαν άπολάβωμεν. Die Korrespondenz der beiden Partizipien und
der beiden Finalsätze verlangt, so scheint mir, diese Deutung: Christus wurde
„unter das Gesetz getan“, um die unter dem Gesetz Lebenden von der
Herrschaft des Gesetzes zu befreien; er wurde vom Weibe geboren, um den
Weibgeborenen die Kindschaft (Gottes) zu sichern. Die Stelle setzt deutlich
voraus, daß Christus im selben Sinn und im selben Maß ein Weibgeborener
ist wie alle Menschen. Wenn es lautete: γενόμενον έκ παρθένου, wären die
Worte ihrer Bedeutung entkleidet.
2 Ausnahmen z. B. Apc. Baruch syr. 21. 4: „und die Höhe des Himmels
durch den Geist befestigt hast“; auch in dem Lied der Judith, Jud. 16,14 „du
entsandtest deinen Geist, und er baute.. .“.