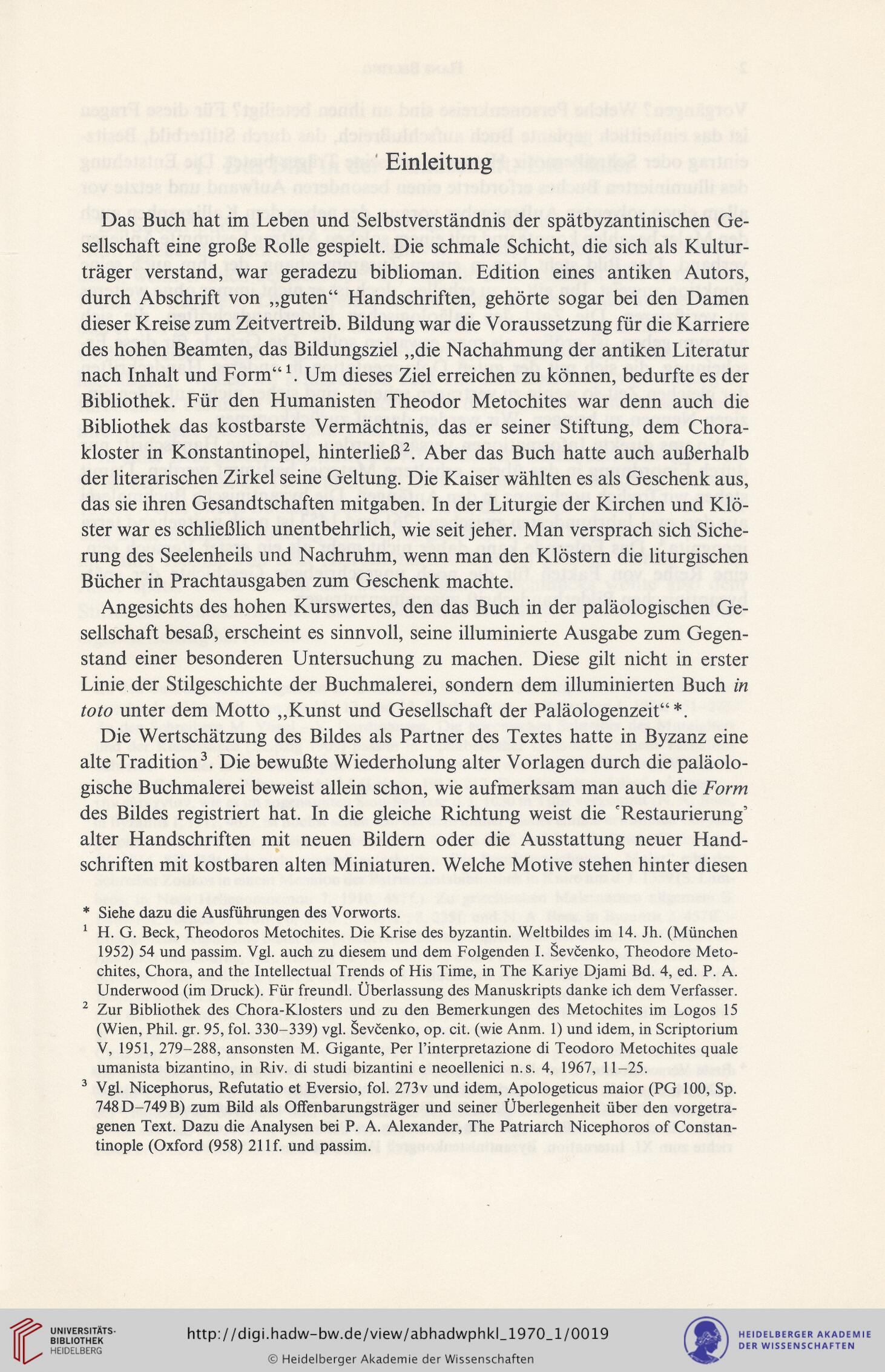Einleitung
Das Buch hat im Leben und Selbstverständnis der spätbyzantinischen Ge-
sellschaft eine große Rolle gespielt. Die schmale Schicht, die sich als Kultur-
träger verstand, war geradezu biblioman. Edition eines antiken Autors,
durch Abschrift von „guten" Handschriften, gehörte sogar bei den Damen
dieser Kreise zum Zeitvertreib. Bildung war die Voraussetzung für die Karriere
des hohen Beamten, das Bildungsziel „die Nachahmung der antiken Literatur
nach Inhalt und Form"1. Um dieses Ziel erreichen zu können, bedurfte es der
Bibliothek. Für den Humanisten Theodor Metochites war denn auch die
Bibliothek das kostbarste Vermächtnis, das er seiner Stiftung, dem Chora-
kloster in Konstantinopel, hinterließ2. Aber das Buch hatte auch außerhalb
der literarischen Zirkel seine Geltung. Die Kaiser wählten es als Geschenk aus,
das sie ihren Gesandtschaften mitgaben. In der Liturgie der Kirchen und Klö-
ster war es schließlich unentbehrlich, wie seit jeher. Man versprach sich Siche-
rung des Seelenheils und Nachruhm, wenn man den Klöstern die liturgischen
Bücher in Prachtausgaben zum Geschenk machte.
Angesichts des hohen Kurswertes, den das Buch in der paläologischen Ge-
sellschaft besaß, erscheint es sinnvoll, seine illuminierte Ausgabe zum Gegen-
stand einer besonderen Untersuchung zu machen. Diese gilt nicht in erster
Linie der Stilgeschichte der Buchmalerei, sondern dem illuminierten Buch in
toto unter dem Motto „Kunst und Gesellschaft der Paläologenzeit" *.
Die Wertschätzung des Bildes als Partner des Textes hatte in Byzanz eine
alte Tradition3. Die bewußte Wiederholung alter Vorlagen durch die paläolo-
gische Buchmalerei beweist allein schon, wie aufmerksam man auch die Form
des Bildes registriert hat. In die gleiche Richtung weist die 'Restaurierung'
alter Handschriften mit neuen Bildern oder die Ausstattung neuer Hand-
schriften mit kostbaren alten Miniaturen. Welche Motive stehen hinter diesen
* Siehe dazu die Ausführungen des Vorworts.
1 H. G. Beck, Theodoros Metochites. Die Krise des byzantin. Weltbildes im 14. Jh. (München
1952) 54 und passim. Vgl. auch zu diesem und dem Folgenden I. Sevcenko, Theodore Meto-
chites, Chora, and the Intellectual Trends of His Time, in The Kariye Djami Bd. 4, ed. P. A.
Underwood (im Druck). Für freundl. Überlassung des Manuskripts danke ich dem Verfasser.
2 Zur Bibliothek des Chora-Klosters und zu den Bemerkungen des Metochites im Logos 15
(Wien, Phil. gr. 95, fol. 330-339) vgl. Sevcenko, op. cit. (wie Anm. 1) und idem, in Scriptorium
V, 1951, 279-288, ansonsten M. Gigante, Per l'interpretazione di Teodoro Metochites quale
umanista bizantino, in Riv. di studi bizantini e neoellenici n.s. 4, 1967, 11-25.
3 Vgl. Nicephorus, Refutatio et Eversio, fol. 273v und idem, Apologeticus maior (PG 100, Sp.
748 D-749 B) zum Bild als Offenbarungsträger und seiner Überlegenheit über den vorgetra-
genen Text. Dazu die Analysen bei P. A. Alexander, The Patriarch Nicephoros of Constan-
tinople (Oxford (958) 211f. und passim.
Das Buch hat im Leben und Selbstverständnis der spätbyzantinischen Ge-
sellschaft eine große Rolle gespielt. Die schmale Schicht, die sich als Kultur-
träger verstand, war geradezu biblioman. Edition eines antiken Autors,
durch Abschrift von „guten" Handschriften, gehörte sogar bei den Damen
dieser Kreise zum Zeitvertreib. Bildung war die Voraussetzung für die Karriere
des hohen Beamten, das Bildungsziel „die Nachahmung der antiken Literatur
nach Inhalt und Form"1. Um dieses Ziel erreichen zu können, bedurfte es der
Bibliothek. Für den Humanisten Theodor Metochites war denn auch die
Bibliothek das kostbarste Vermächtnis, das er seiner Stiftung, dem Chora-
kloster in Konstantinopel, hinterließ2. Aber das Buch hatte auch außerhalb
der literarischen Zirkel seine Geltung. Die Kaiser wählten es als Geschenk aus,
das sie ihren Gesandtschaften mitgaben. In der Liturgie der Kirchen und Klö-
ster war es schließlich unentbehrlich, wie seit jeher. Man versprach sich Siche-
rung des Seelenheils und Nachruhm, wenn man den Klöstern die liturgischen
Bücher in Prachtausgaben zum Geschenk machte.
Angesichts des hohen Kurswertes, den das Buch in der paläologischen Ge-
sellschaft besaß, erscheint es sinnvoll, seine illuminierte Ausgabe zum Gegen-
stand einer besonderen Untersuchung zu machen. Diese gilt nicht in erster
Linie der Stilgeschichte der Buchmalerei, sondern dem illuminierten Buch in
toto unter dem Motto „Kunst und Gesellschaft der Paläologenzeit" *.
Die Wertschätzung des Bildes als Partner des Textes hatte in Byzanz eine
alte Tradition3. Die bewußte Wiederholung alter Vorlagen durch die paläolo-
gische Buchmalerei beweist allein schon, wie aufmerksam man auch die Form
des Bildes registriert hat. In die gleiche Richtung weist die 'Restaurierung'
alter Handschriften mit neuen Bildern oder die Ausstattung neuer Hand-
schriften mit kostbaren alten Miniaturen. Welche Motive stehen hinter diesen
* Siehe dazu die Ausführungen des Vorworts.
1 H. G. Beck, Theodoros Metochites. Die Krise des byzantin. Weltbildes im 14. Jh. (München
1952) 54 und passim. Vgl. auch zu diesem und dem Folgenden I. Sevcenko, Theodore Meto-
chites, Chora, and the Intellectual Trends of His Time, in The Kariye Djami Bd. 4, ed. P. A.
Underwood (im Druck). Für freundl. Überlassung des Manuskripts danke ich dem Verfasser.
2 Zur Bibliothek des Chora-Klosters und zu den Bemerkungen des Metochites im Logos 15
(Wien, Phil. gr. 95, fol. 330-339) vgl. Sevcenko, op. cit. (wie Anm. 1) und idem, in Scriptorium
V, 1951, 279-288, ansonsten M. Gigante, Per l'interpretazione di Teodoro Metochites quale
umanista bizantino, in Riv. di studi bizantini e neoellenici n.s. 4, 1967, 11-25.
3 Vgl. Nicephorus, Refutatio et Eversio, fol. 273v und idem, Apologeticus maior (PG 100, Sp.
748 D-749 B) zum Bild als Offenbarungsträger und seiner Überlegenheit über den vorgetra-
genen Text. Dazu die Analysen bei P. A. Alexander, The Patriarch Nicephoros of Constan-
tinople (Oxford (958) 211f. und passim.