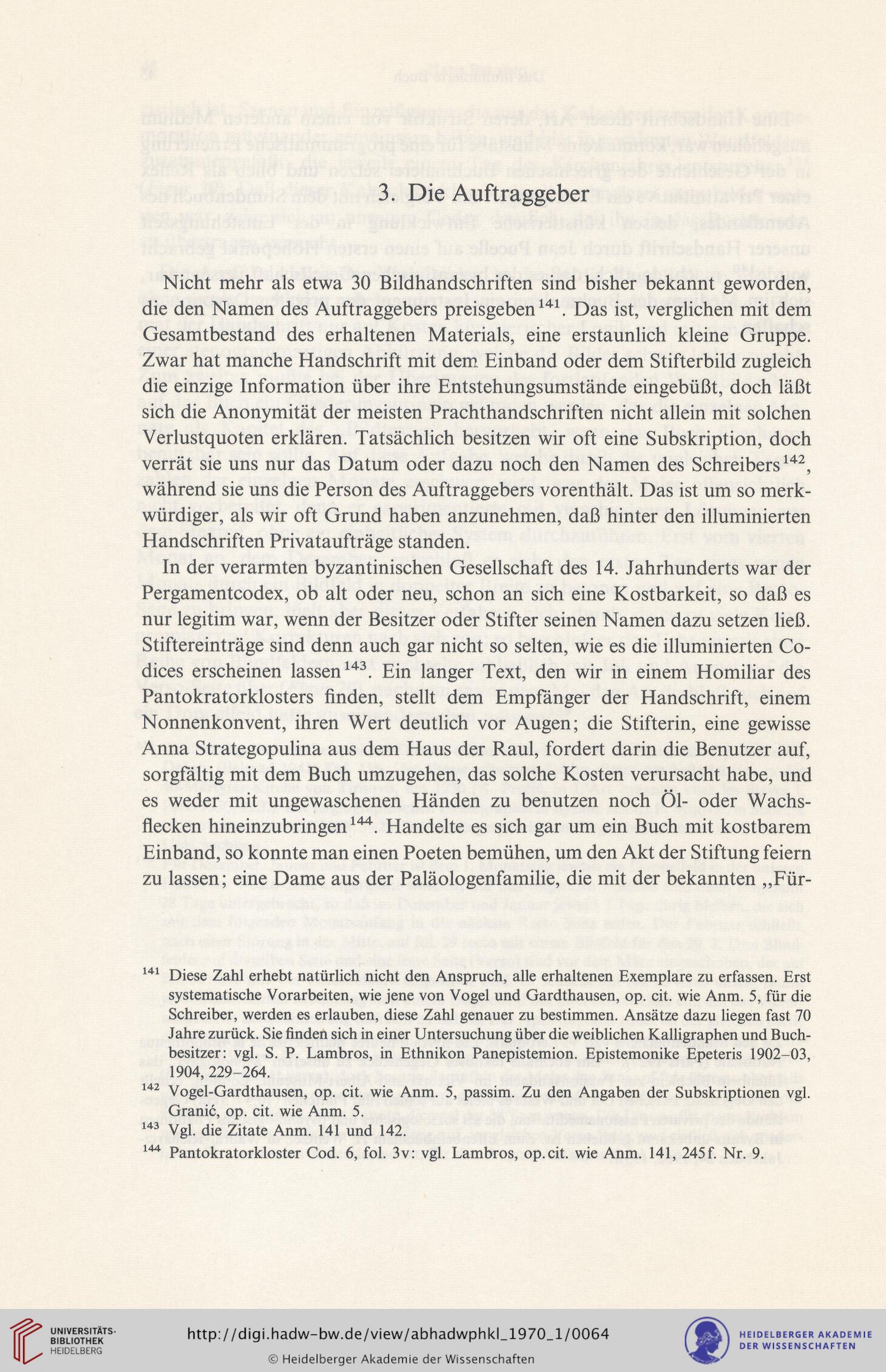3. Die Auftraggeber
Nicht mehr als etwa 30 Bildhandschriften sind bisher bekannt geworden,
die den Namen des Auftraggebers preisgeben 141. Das ist, verglichen mit dem
Gesamtbestand des erhaltenen Materials, eine erstaunlich kleine Gruppe.
Zwar hat manche Handschrift mit dem Einband oder dem Stifterbild zugleich
die einzige Information über ihre Entstehungsumstände eingebüßt, doch läßt
sich die Anonymität der meisten Prachthandschriften nicht allein mit solchen
Verlustquoten erklären. Tatsächlich besitzen wir oft eine Subskription, doch
verrät sie uns nur das Datum oder dazu noch den Namen des Schreibers142,
während sie uns die Person des Auftraggebers vorenthält. Das ist um so merk-
würdiger, als wir oft Grund haben anzunehmen, daß hinter den illuminierten
Handschriften Privataufträge standen.
In der verarmten byzantinischen Gesellschaft des 14. Jahrhunderts war der
Pergamentcodex, ob alt oder neu, schon an sich eine Kostbarkeit, so daß es
nur legitim war, wenn der Besitzer oder Stifter seinen Namen dazu setzen ließ.
Stiftereinträge sind denn auch gar nicht so selten, wie es die illuminierten Co-
dices erscheinen lassen143. Ein langer Text, den wir in einem Homiliar des
Pantokratorklosters finden, stellt dem Empfänger der Handschrift, einem
Nonnenkonvent, ihren Wert deutlich vor Augen; die Stifterin, eine gewisse
Anna Strategopulina aus dem Haus der Raul, fordert darin die Benutzer auf,
sorgfältig mit dem Buch umzugehen, das solche Kosten verursacht habe, und
es weder mit ungewaschenen Händen zu benutzen noch Öl- oder Wachs-
flecken hineinzubringen144. Handelte es sich gar um ein Buch mit kostbarem
Einband, so konnte man einen Poeten bemühen, um den Akt der Stiftung feiern
zu lassen; eine Dame aus der Paläologenfamilie, die mit der bekannten „Für-
141 Diese Zahl erhebt natürlich nicht den Anspruch, alle erhaltenen Exemplare zu erfassen. Erst
systematische Vorarbeiten, wie jene von Vogel und Gardthausen, op. cit. wie Anm. 5, für die
Schreiber, werden es erlauben, diese Zahl genauer zu bestimmen. Ansätze dazu liegen fast 70
Jahre zurück. Sie finden sich in einer Untersuchung über die weiblichen Kalligraphen und Buch-
besitzer: vgl. S. P. Lambros, in Ethnikon Panepistemion. Epistemonike Epeteris 1902-03,
1904, 229-264.
142 Vogel-Gardthausen, op. cit. wie Anm. 5, passim. Zu den Angaben der Subskriptionen vgl.
Granic, op. cit. wie Anm. 5.
143 Vgl. die Zitate Anm. 141 und 142.
144 Pantokratorkloster Cod. 6, fol. 3v: vgl. Lambros, op.cit. wie Anm. 141, 245f. Nr. 9.
Nicht mehr als etwa 30 Bildhandschriften sind bisher bekannt geworden,
die den Namen des Auftraggebers preisgeben 141. Das ist, verglichen mit dem
Gesamtbestand des erhaltenen Materials, eine erstaunlich kleine Gruppe.
Zwar hat manche Handschrift mit dem Einband oder dem Stifterbild zugleich
die einzige Information über ihre Entstehungsumstände eingebüßt, doch läßt
sich die Anonymität der meisten Prachthandschriften nicht allein mit solchen
Verlustquoten erklären. Tatsächlich besitzen wir oft eine Subskription, doch
verrät sie uns nur das Datum oder dazu noch den Namen des Schreibers142,
während sie uns die Person des Auftraggebers vorenthält. Das ist um so merk-
würdiger, als wir oft Grund haben anzunehmen, daß hinter den illuminierten
Handschriften Privataufträge standen.
In der verarmten byzantinischen Gesellschaft des 14. Jahrhunderts war der
Pergamentcodex, ob alt oder neu, schon an sich eine Kostbarkeit, so daß es
nur legitim war, wenn der Besitzer oder Stifter seinen Namen dazu setzen ließ.
Stiftereinträge sind denn auch gar nicht so selten, wie es die illuminierten Co-
dices erscheinen lassen143. Ein langer Text, den wir in einem Homiliar des
Pantokratorklosters finden, stellt dem Empfänger der Handschrift, einem
Nonnenkonvent, ihren Wert deutlich vor Augen; die Stifterin, eine gewisse
Anna Strategopulina aus dem Haus der Raul, fordert darin die Benutzer auf,
sorgfältig mit dem Buch umzugehen, das solche Kosten verursacht habe, und
es weder mit ungewaschenen Händen zu benutzen noch Öl- oder Wachs-
flecken hineinzubringen144. Handelte es sich gar um ein Buch mit kostbarem
Einband, so konnte man einen Poeten bemühen, um den Akt der Stiftung feiern
zu lassen; eine Dame aus der Paläologenfamilie, die mit der bekannten „Für-
141 Diese Zahl erhebt natürlich nicht den Anspruch, alle erhaltenen Exemplare zu erfassen. Erst
systematische Vorarbeiten, wie jene von Vogel und Gardthausen, op. cit. wie Anm. 5, für die
Schreiber, werden es erlauben, diese Zahl genauer zu bestimmen. Ansätze dazu liegen fast 70
Jahre zurück. Sie finden sich in einer Untersuchung über die weiblichen Kalligraphen und Buch-
besitzer: vgl. S. P. Lambros, in Ethnikon Panepistemion. Epistemonike Epeteris 1902-03,
1904, 229-264.
142 Vogel-Gardthausen, op. cit. wie Anm. 5, passim. Zu den Angaben der Subskriptionen vgl.
Granic, op. cit. wie Anm. 5.
143 Vgl. die Zitate Anm. 141 und 142.
144 Pantokratorkloster Cod. 6, fol. 3v: vgl. Lambros, op.cit. wie Anm. 141, 245f. Nr. 9.