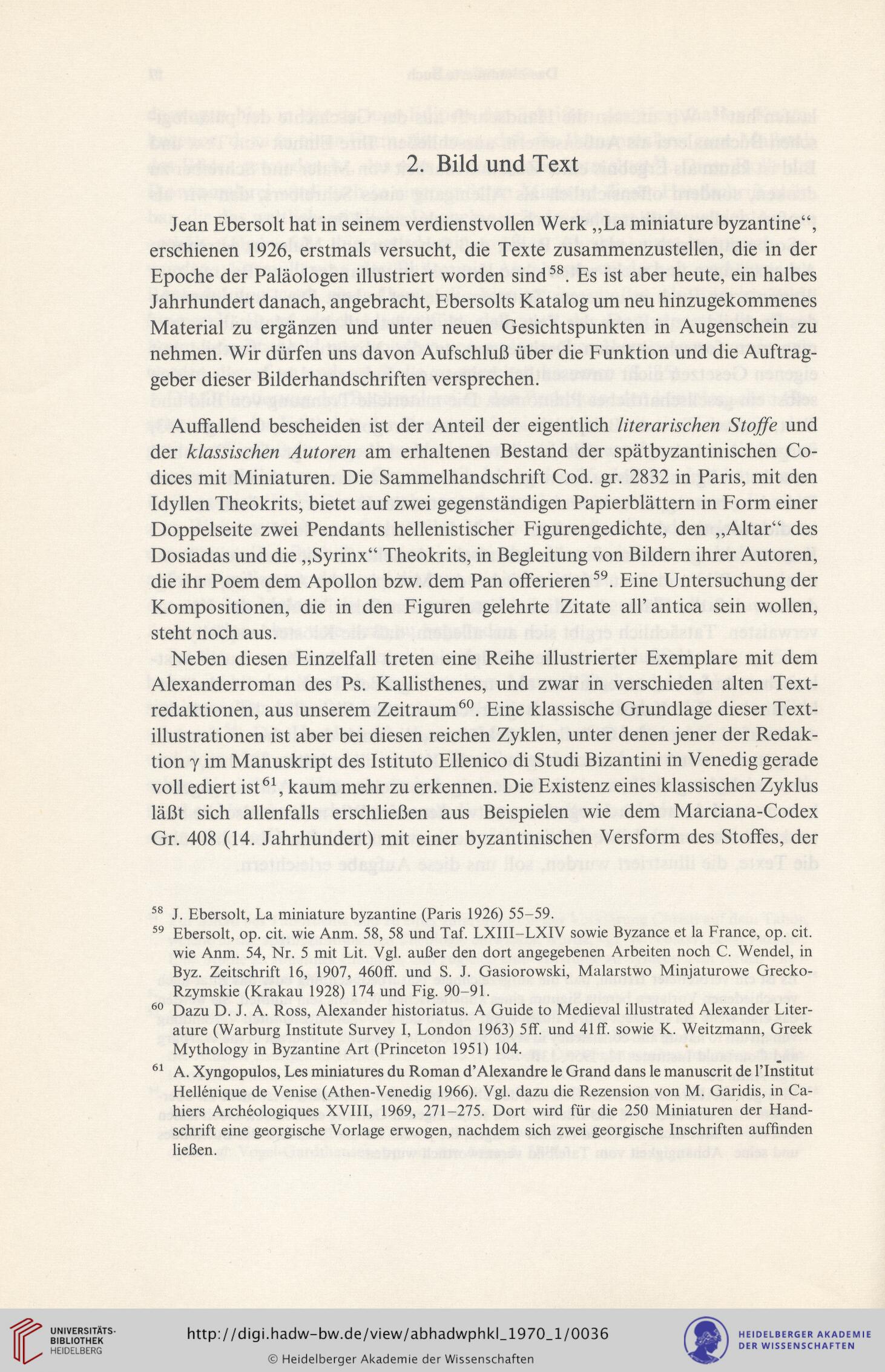2. Bild und Text
Jean Ebersolt hat in seinem verdienstvollen Werk „La miniature byzantine",
erschienen 1926, erstmals versucht, die Texte zusammenzustellen, die in der
Epoche der Paläologen illustriert worden sind58. Es ist aber heute, ein halbes
Jahrhundert danach, angebracht, Ebersolts Katalog um neu hinzugekommenes
Material zu ergänzen und unter neuen Gesichtspunkten in Augenschein zu
nehmen. Wir dürfen uns davon Aufschluß über die Funktion und die Auftrag-
geber dieser Bilderhandschriften versprechen.
Auffallend bescheiden ist der Anteil der eigentlich literarischen Stoffe und
der klassischen Autoren am erhaltenen Bestand der spätbyzantinischen Co-
dices mit Miniaturen. Die Sammelhandschrift Cod. gr. 2832 in Paris, mit den
Idyllen Theokrits, bietet auf zwei gegenständigen Papierblättern in Form einer
Doppelseite zwei Pendants hellenistischer Figurengedichte, den „Altar" des
Dosiadas und die „Syrinx" Theokrits, in Begleitung von Bildern ihrer Autoren,
die ihr Poem dem Apollon bzw. dem Pan offerieren59. Eine Untersuchung der
Kompositionen, die in den Figuren gelehrte Zitate all' antica sein wollen,
steht noch aus.
Neben diesen Einzelfall treten eine Reihe illustrierter Exemplare mit dem
Alexanderroman des Ps. Kallisthenes, und zwar in verschieden alten Text-
redaktionen, aus unserem Zeitraum60. Eine klassische Grundlage dieser Text-
illustrationen ist aber bei diesen reichen Zyklen, unter denen jener der Redak-
tion y im Manuskript des Istituto Ellenico di Studi Bizantini in Venedig gerade
voll ediert ist61, kaum mehr zu erkennen. Die Existenz eines klassischen Zyklus
läßt sich allenfalls erschließen aus Beispielen wie dem Marciana-Codex
Gr. 408 (14. Jahrhundert) mit einer byzantinischen Versform des Stoffes, der
58 J. Ebersolt, La miniature byzantine (Paris 1926) 55-59.
59 Ebersolt, op. cit. wie Anm. 58, 58 und Taf. LXIII-LXIV sowie Byzance et la France, op. cit.
wie Anm. 54, Nr. 5 mit Lit. Vgl. außer den dort angegebenen Arbeiten noch C. Wendel, in
Byz. Zeitschrift 16, 1907, 460ff. und S. J. Gasiorowski, Malarstwo Minjaturowe Grecko-
Rzymskie (Krakau 1928) 174 und Fig. 90-91.
60 Dazu D. J. A. Ross, Alexander historiatus. A Guide to Medieval illustrated Alexander Liter-
ature (Warburg Institute Survey I, London 1963) 5ff. und 41ff. sowie K. Weitzmann, Greek
Mythology in Byzantine Art (Princeton 1951) 104.
61 A. Xyngopulos, Les miniatures du Roman d'Alexandre le Grand dans le manuscrit de l'Institut
Hellenique de Venise (Athen-Venedig 1966). Vgl. dazu die Rezension von M. Garidis, in Ca-
hiers Archeologiques XVIII, 1969, 271-275. Dort wird für die 250 Miniaturen der Hand-
schrift eine georgische Vorlage erwogen, nachdem sich zwei georgische Inschriften auffinden
ließen.
Jean Ebersolt hat in seinem verdienstvollen Werk „La miniature byzantine",
erschienen 1926, erstmals versucht, die Texte zusammenzustellen, die in der
Epoche der Paläologen illustriert worden sind58. Es ist aber heute, ein halbes
Jahrhundert danach, angebracht, Ebersolts Katalog um neu hinzugekommenes
Material zu ergänzen und unter neuen Gesichtspunkten in Augenschein zu
nehmen. Wir dürfen uns davon Aufschluß über die Funktion und die Auftrag-
geber dieser Bilderhandschriften versprechen.
Auffallend bescheiden ist der Anteil der eigentlich literarischen Stoffe und
der klassischen Autoren am erhaltenen Bestand der spätbyzantinischen Co-
dices mit Miniaturen. Die Sammelhandschrift Cod. gr. 2832 in Paris, mit den
Idyllen Theokrits, bietet auf zwei gegenständigen Papierblättern in Form einer
Doppelseite zwei Pendants hellenistischer Figurengedichte, den „Altar" des
Dosiadas und die „Syrinx" Theokrits, in Begleitung von Bildern ihrer Autoren,
die ihr Poem dem Apollon bzw. dem Pan offerieren59. Eine Untersuchung der
Kompositionen, die in den Figuren gelehrte Zitate all' antica sein wollen,
steht noch aus.
Neben diesen Einzelfall treten eine Reihe illustrierter Exemplare mit dem
Alexanderroman des Ps. Kallisthenes, und zwar in verschieden alten Text-
redaktionen, aus unserem Zeitraum60. Eine klassische Grundlage dieser Text-
illustrationen ist aber bei diesen reichen Zyklen, unter denen jener der Redak-
tion y im Manuskript des Istituto Ellenico di Studi Bizantini in Venedig gerade
voll ediert ist61, kaum mehr zu erkennen. Die Existenz eines klassischen Zyklus
läßt sich allenfalls erschließen aus Beispielen wie dem Marciana-Codex
Gr. 408 (14. Jahrhundert) mit einer byzantinischen Versform des Stoffes, der
58 J. Ebersolt, La miniature byzantine (Paris 1926) 55-59.
59 Ebersolt, op. cit. wie Anm. 58, 58 und Taf. LXIII-LXIV sowie Byzance et la France, op. cit.
wie Anm. 54, Nr. 5 mit Lit. Vgl. außer den dort angegebenen Arbeiten noch C. Wendel, in
Byz. Zeitschrift 16, 1907, 460ff. und S. J. Gasiorowski, Malarstwo Minjaturowe Grecko-
Rzymskie (Krakau 1928) 174 und Fig. 90-91.
60 Dazu D. J. A. Ross, Alexander historiatus. A Guide to Medieval illustrated Alexander Liter-
ature (Warburg Institute Survey I, London 1963) 5ff. und 41ff. sowie K. Weitzmann, Greek
Mythology in Byzantine Art (Princeton 1951) 104.
61 A. Xyngopulos, Les miniatures du Roman d'Alexandre le Grand dans le manuscrit de l'Institut
Hellenique de Venise (Athen-Venedig 1966). Vgl. dazu die Rezension von M. Garidis, in Ca-
hiers Archeologiques XVIII, 1969, 271-275. Dort wird für die 250 Miniaturen der Hand-
schrift eine georgische Vorlage erwogen, nachdem sich zwei georgische Inschriften auffinden
ließen.