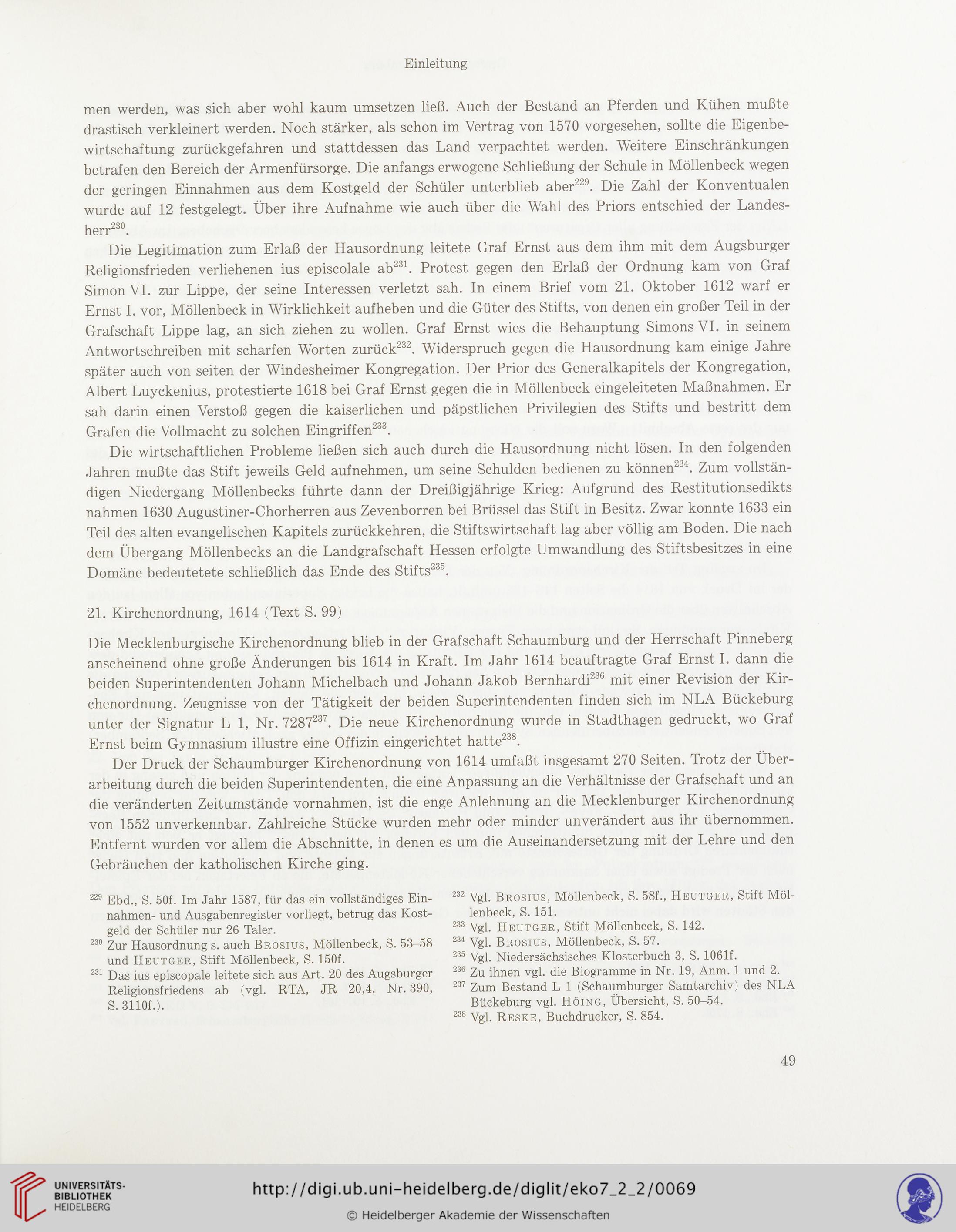Einleitung
men werden, was sich aber wohl kaum umsetzen ließ. Auch der Bestand an Pferden und Kühen mußte
drastisch verkleinert werden. Noch stärker, als schon im Vertrag von 1570 vorgesehen, sollte die Eigenbe-
wirtschaftung zurückgefahren und stattdessen das Land verpachtet werden. Weitere Einschränkungen
betrafen den Bereich der Armenfürsorge. Die anfangs erwogene Schließung der Schule in Möllenbeck wegen
der geringen Einnahmen aus dem Kostgeld der Schüler unterblieb aber229. Die Zahl der Konventualen
wurde auf 12 festgelegt. Über ihre Aufnahme wie auch über die Wahl des Priors entschied der Landes-
herr230.
Die Legitimation zum Erlaß der Hausordnung leitete Graf Ernst aus dem ihm mit dem Augsburger
Religionsfrieden verliehenen ius episcopale ab231. Protest gegen den Erlaß der Ordnung kam von Graf
Simon VI. zur Lippe, der seine Interessen verletzt sah. In einem Brief vom 21. Oktober 1612 warf er
Ernst I. vor, Möllenbeck in Wirklichkeit aufheben und die Güter des Stifts, von denen ein großer Teil in der
Grafschaft Lippe lag, an sich ziehen zu wollen. Graf Ernst wies die Behauptung Simons VI. in seinem
Antwortschreiben mit scharfen Worten zurück232. Widerspruch gegen die Hausordnung kam einige Jahre
später auch von seiten der Windesheimer Kongregation. Der Prior des Generalkapitels der Kongregation,
Albert Luyckenius, protestierte 1618 bei Graf Ernst gegen die in Möllenbeck eingeleiteten Maßnahmen. Er
sah darin einen Verstoß gegen die kaiserlichen und päpstlichen Privilegien des Stifts und bestritt dem
Grafen die Vollmacht zu solchen Eingriffen233.
Die wirtschaftlichen Probleme ließen sich auch durch die Hausordnung nicht lösen. In den folgenden
Jahren mußte das Stift jeweils Geld aufnehmen, um seine Schulden bedienen zu können234. Zum vollstän-
digen Niedergang Möllenbecks führte dann der Dreißigjährige Krieg: Aufgrund des Restitutionsedikts
nahmen 1630 Augustiner-Chorherren aus Zevenborren bei Brüssel das Stift in Besitz. Zwar konnte 1633 ein
Teil des alten evangelischen Kapitels zurückkehren, die Stiftswirtschaft lag aber völlig am Boden. Die nach
dem Übergang Möllenbecks an die Landgrafschaft Hessen erfolgte Umwandlung des Stiftsbesitzes in eine
Domäne bedeutetete schließlich das Ende des Stifts235.
21. Kirchenordnung, 1614 (Text S. 99)
Die Mecklenburgische Kirchenordnung blieb in der Grafschaft Schaumburg und der Herrschaft Pinneberg
anscheinend ohne große Änderungen bis 1614 in Kraft. Im Jahr 1614 beauftragte Graf Ernst I. dann die
beiden Superintendenten Johann Michelbach und Johann Jakob Bernhardi236 mit einer Revision der Kir-
chenordnung. Zeugnisse von der Tätigkeit der beiden Superintendenten finden sich im NLA Bückeburg
unter der Signatur L 1, Nr. 7287237. Die neue Kirchenordnung wurde in Stadthagen gedruckt, wo Graf
Ernst beim Gymnasium illustre eine Offizin eingerichtet hatte238.
Der Druck der Schaumburger Kirchenordnung von 1614 umfaßt insgesamt 270 Seiten. Trotz der Über-
arbeitung durch die beiden Superintendenten, die eine Anpassung an die Verhältnisse der Grafschaft und an
die veränderten Zeitumstände vornahmen, ist die enge Anlehnung an die Mecklenburger Kirchenordnung
von 1552 unverkennbar. Zahlreiche Stücke wurden mehr oder minder unverändert aus ihr übernommen.
Entfernt wurden vor allem die Abschnitte, in denen es um die Auseinandersetzung mit der Lehre und den
Gebräuchen der katholischen Kirche ging.
229 Ebd., S. 50f. Im Jahr 1587, für das ein vollständiges Ein-
nahmen- und Ausgabenregister vorliegt, betrug das Kost-
geld der Schüler nur 26 Taler.
230 Zur Hausordnung s. auch Brosius, Möllenbeck, S. 53-58
und Heutger, Stift Möllenbeck, S. 150f.
231 Das ius episcopale leitete sich aus Art. 20 des Augsburger
Religionsfriedens ab (vgl. RTA, JR 20,4, Nr. 390,
S. 3110f.).
232 Vgl. Brosius, Möllenbeck, S. 58f., Heutger, Stift Möl-
lenbeck, S. 151.
233 Vgl. Heutger, Stift Möllenbeck, S. 142.
234 Vgl. Brosius, Möllenbeck, S. 57.
235 Vgl. Niedersächsisches Klosterbuch 3, S. 1061f.
236 Zu ihnen vgl. die Biogramme in Nr. 19, Anm. 1 und 2.
237 Zum Bestand L 1 (Schaumburger Samtarchiv) des NLA
Bückeburg vgl. Höing, Übersicht, S. 50-54.
238 Vgl. Reske, Buchdrucker, S. 854.
49
men werden, was sich aber wohl kaum umsetzen ließ. Auch der Bestand an Pferden und Kühen mußte
drastisch verkleinert werden. Noch stärker, als schon im Vertrag von 1570 vorgesehen, sollte die Eigenbe-
wirtschaftung zurückgefahren und stattdessen das Land verpachtet werden. Weitere Einschränkungen
betrafen den Bereich der Armenfürsorge. Die anfangs erwogene Schließung der Schule in Möllenbeck wegen
der geringen Einnahmen aus dem Kostgeld der Schüler unterblieb aber229. Die Zahl der Konventualen
wurde auf 12 festgelegt. Über ihre Aufnahme wie auch über die Wahl des Priors entschied der Landes-
herr230.
Die Legitimation zum Erlaß der Hausordnung leitete Graf Ernst aus dem ihm mit dem Augsburger
Religionsfrieden verliehenen ius episcopale ab231. Protest gegen den Erlaß der Ordnung kam von Graf
Simon VI. zur Lippe, der seine Interessen verletzt sah. In einem Brief vom 21. Oktober 1612 warf er
Ernst I. vor, Möllenbeck in Wirklichkeit aufheben und die Güter des Stifts, von denen ein großer Teil in der
Grafschaft Lippe lag, an sich ziehen zu wollen. Graf Ernst wies die Behauptung Simons VI. in seinem
Antwortschreiben mit scharfen Worten zurück232. Widerspruch gegen die Hausordnung kam einige Jahre
später auch von seiten der Windesheimer Kongregation. Der Prior des Generalkapitels der Kongregation,
Albert Luyckenius, protestierte 1618 bei Graf Ernst gegen die in Möllenbeck eingeleiteten Maßnahmen. Er
sah darin einen Verstoß gegen die kaiserlichen und päpstlichen Privilegien des Stifts und bestritt dem
Grafen die Vollmacht zu solchen Eingriffen233.
Die wirtschaftlichen Probleme ließen sich auch durch die Hausordnung nicht lösen. In den folgenden
Jahren mußte das Stift jeweils Geld aufnehmen, um seine Schulden bedienen zu können234. Zum vollstän-
digen Niedergang Möllenbecks führte dann der Dreißigjährige Krieg: Aufgrund des Restitutionsedikts
nahmen 1630 Augustiner-Chorherren aus Zevenborren bei Brüssel das Stift in Besitz. Zwar konnte 1633 ein
Teil des alten evangelischen Kapitels zurückkehren, die Stiftswirtschaft lag aber völlig am Boden. Die nach
dem Übergang Möllenbecks an die Landgrafschaft Hessen erfolgte Umwandlung des Stiftsbesitzes in eine
Domäne bedeutetete schließlich das Ende des Stifts235.
21. Kirchenordnung, 1614 (Text S. 99)
Die Mecklenburgische Kirchenordnung blieb in der Grafschaft Schaumburg und der Herrschaft Pinneberg
anscheinend ohne große Änderungen bis 1614 in Kraft. Im Jahr 1614 beauftragte Graf Ernst I. dann die
beiden Superintendenten Johann Michelbach und Johann Jakob Bernhardi236 mit einer Revision der Kir-
chenordnung. Zeugnisse von der Tätigkeit der beiden Superintendenten finden sich im NLA Bückeburg
unter der Signatur L 1, Nr. 7287237. Die neue Kirchenordnung wurde in Stadthagen gedruckt, wo Graf
Ernst beim Gymnasium illustre eine Offizin eingerichtet hatte238.
Der Druck der Schaumburger Kirchenordnung von 1614 umfaßt insgesamt 270 Seiten. Trotz der Über-
arbeitung durch die beiden Superintendenten, die eine Anpassung an die Verhältnisse der Grafschaft und an
die veränderten Zeitumstände vornahmen, ist die enge Anlehnung an die Mecklenburger Kirchenordnung
von 1552 unverkennbar. Zahlreiche Stücke wurden mehr oder minder unverändert aus ihr übernommen.
Entfernt wurden vor allem die Abschnitte, in denen es um die Auseinandersetzung mit der Lehre und den
Gebräuchen der katholischen Kirche ging.
229 Ebd., S. 50f. Im Jahr 1587, für das ein vollständiges Ein-
nahmen- und Ausgabenregister vorliegt, betrug das Kost-
geld der Schüler nur 26 Taler.
230 Zur Hausordnung s. auch Brosius, Möllenbeck, S. 53-58
und Heutger, Stift Möllenbeck, S. 150f.
231 Das ius episcopale leitete sich aus Art. 20 des Augsburger
Religionsfriedens ab (vgl. RTA, JR 20,4, Nr. 390,
S. 3110f.).
232 Vgl. Brosius, Möllenbeck, S. 58f., Heutger, Stift Möl-
lenbeck, S. 151.
233 Vgl. Heutger, Stift Möllenbeck, S. 142.
234 Vgl. Brosius, Möllenbeck, S. 57.
235 Vgl. Niedersächsisches Klosterbuch 3, S. 1061f.
236 Zu ihnen vgl. die Biogramme in Nr. 19, Anm. 1 und 2.
237 Zum Bestand L 1 (Schaumburger Samtarchiv) des NLA
Bückeburg vgl. Höing, Übersicht, S. 50-54.
238 Vgl. Reske, Buchdrucker, S. 854.
49