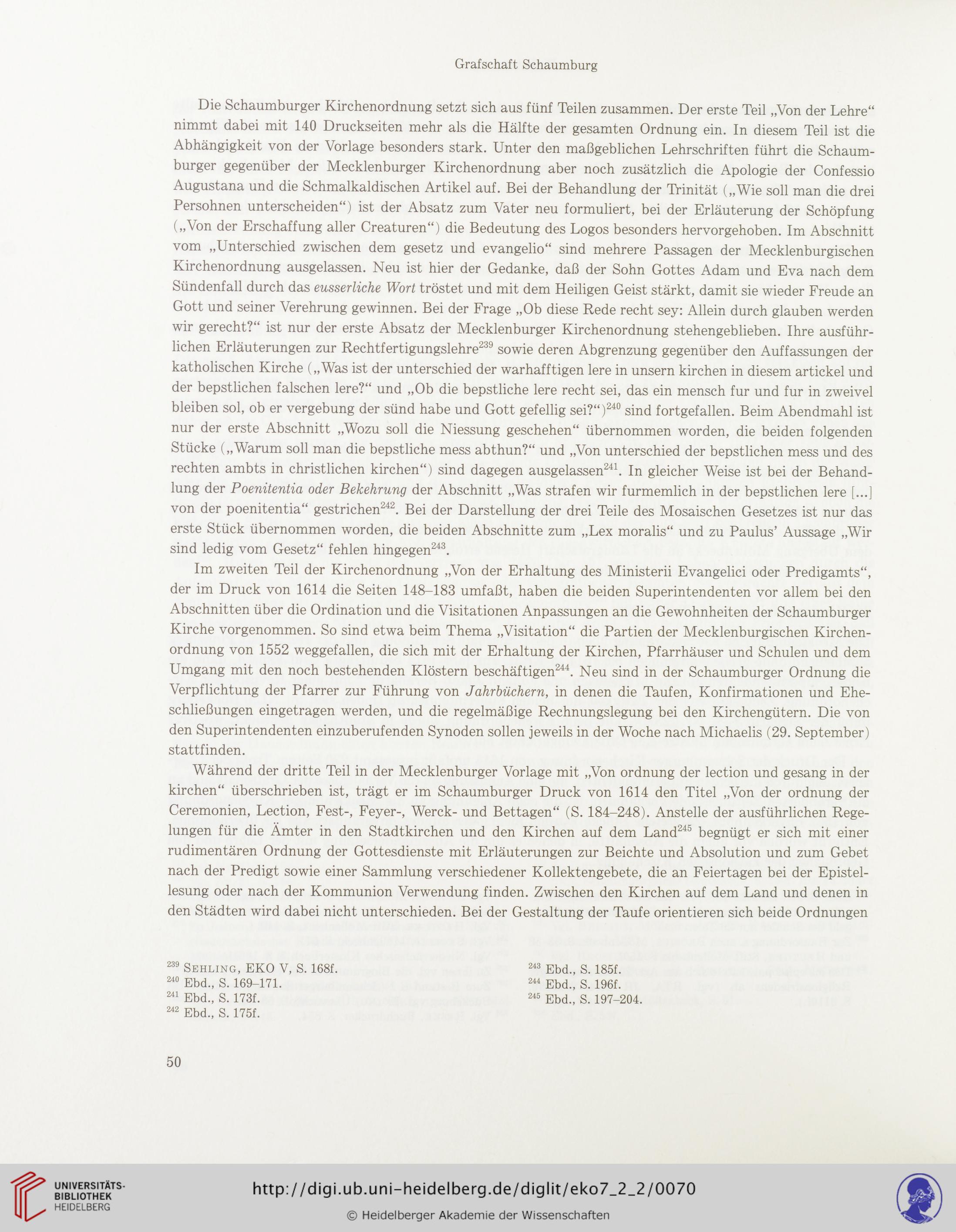Grafschaft Schaumburg
Die Schaumburger Kirchenordnung setzt sich aus fünf Teilen zusammen. Der erste Teil „Von der Lehre“
nimmt dabei mit 140 Druckseiten mehr als die Hälfte der gesamten Ordnung ein. In diesem Teil ist die
Abhängigkeit von der Vorlage besonders stark. Unter den maßgeblichen Lehrschriften führt die Schaum-
burger gegenüber der Mecklenburger Kirchenordnung aber noch zusätzlich die Apologie der Confessio
Augustana und die Schmalkaldischen Artikel auf. Bei der Behandlung der Trinität („Wie soll man die drei
Persohnen unterscheiden“) ist der Absatz zum Vater neu formuliert, bei der Erläuterung der Schöpfung
(„Von der Erschaffung aller Creaturen“) die Bedeutung des Logos besonders hervorgehoben. Im Abschnitt
vom „Unterschied zwischen dem gesetz und evangelio“ sind mehrere Passagen der Mecklenburgischen
Kirchenordnung ausgelassen. Neu ist hier der Gedanke, daß der Sohn Gottes Adam und Eva nach dem
Sündenfall durch das eusserliche Wort tröstet und mit dem Heiligen Geist stärkt, damit sie wieder Freude an
Gott und seiner Verehrung gewinnen. Bei der Frage „Ob diese Rede recht sey: Allein durch glauben werden
wir gerecht?“ ist nur der erste Absatz der Mecklenburger Kirchenordnung stehengeblieben. Ihre ausführ-
lichen Erläuterungen zur Rechtfertigungslehre239 sowie deren Abgrenzung gegenüber den Auffassungen der
katholischen Kirche („Was ist der unterschied der warhafftigen lere in unsern kirchen in diesem artickel und
der bepstlichen falschen lere?“ und „Ob die bepstliche lere recht sei, das ein mensch fur und fur in zweivel
bleiben sol, ob er vergebung der sünd habe und Gott gefellig sei?“)240 sind fortgefallen. Beim Abendmahl ist
nur der erste Abschnitt „Wozu soll die Niessung geschehen“ übernommen worden, die beiden folgenden
Stücke („Warum soll man die bepstliche mess abthun?“ und „Von unterschied der bepstlichen mess und des
rechten ambts in christlichen kirchen“) sind dagegen ausgelassen241. In gleicher Weise ist bei der Behand-
lung der Poenitentia oder Bekehrung der Abschnitt „Was strafen wir furmemlich in der bepstlichen lere [...]
von der poenitentia“ gestrichen242. Bei der Darstellung der drei Teile des Mosaischen Gesetzes ist nur das
erste Stück übernommen worden, die beiden Abschnitte zum „Lex moralis“ und zu Paulus’ Aussage „Wir
sind ledig vom Gesetz“ fehlen hingegen243.
Im zweiten Teil der Kirchenordnung „Von der Erhaltung des Ministerii Evangelici oder Predigamts“,
der im Druck von 1614 die Seiten 148-183 umfaßt, haben die beiden Superintendenten vor allem bei den
Abschnitten über die Ordination und die Visitationen Anpassungen an die Gewohnheiten der Schaumburger
Kirche vorgenommen. So sind etwa beim Thema „Visitation“ die Partien der Mecklenburgischen Kirchen-
ordnung von 1552 weggefallen, die sich mit der Erhaltung der Kirchen, Pfarrhäuser und Schulen und dem
Umgang mit den noch bestehenden Klöstern beschäftigen244. Neu sind in der Schaumburger Ordnung die
Verpflichtung der Pfarrer zur Führung von Jahrbüchern, in denen die Taufen, Konfirmationen und Ehe-
schließungen eingetragen werden, und die regelmäßige Rechnungslegung bei den Kirchengütern. Die von
den Superintendenten einzuberufenden Synoden sollen jeweils in der Woche nach Michaelis (29. September)
stattfinden.
Während der dritte Teil in der Mecklenburger Vorlage mit „Von ordnung der lection und gesang in der
kirchen“ überschrieben ist, trägt er im Schaumburger Druck von 1614 den Titel „Von der ordnung der
Ceremonien, Lection, Fest-, Feyer-, Werck- und Bettagen“ (S. 184-248). Anstelle der ausführlichen Rege-
lungen für die Ämter in den Stadtkirchen und den Kirchen auf dem Land245 begnügt er sich mit einer
rudimentären Ordnung der Gottesdienste mit Erläuterungen zur Beichte und Absolution und zum Gebet
nach der Predigt sowie einer Sammlung verschiedener Kollektengebete, die an Feiertagen bei der Epistel-
lesung oder nach der Kommunion Verwendung finden. Zwischen den Kirchen auf dem Land und denen in
den Städten wird dabei nicht unterschieden. Bei der Gestaltung der Taufe orientieren sich beide Ordnungen
239 Sehling, EKO V, S. 168f.
240 Ebd., S. 169-171.
241 Ebd., S. 173f.
242 Ebd., S. 175f.
243 Ebd., S. 185f.
244 Ebd., S. 196f.
245 Ebd., S. 197-204.
50
Die Schaumburger Kirchenordnung setzt sich aus fünf Teilen zusammen. Der erste Teil „Von der Lehre“
nimmt dabei mit 140 Druckseiten mehr als die Hälfte der gesamten Ordnung ein. In diesem Teil ist die
Abhängigkeit von der Vorlage besonders stark. Unter den maßgeblichen Lehrschriften führt die Schaum-
burger gegenüber der Mecklenburger Kirchenordnung aber noch zusätzlich die Apologie der Confessio
Augustana und die Schmalkaldischen Artikel auf. Bei der Behandlung der Trinität („Wie soll man die drei
Persohnen unterscheiden“) ist der Absatz zum Vater neu formuliert, bei der Erläuterung der Schöpfung
(„Von der Erschaffung aller Creaturen“) die Bedeutung des Logos besonders hervorgehoben. Im Abschnitt
vom „Unterschied zwischen dem gesetz und evangelio“ sind mehrere Passagen der Mecklenburgischen
Kirchenordnung ausgelassen. Neu ist hier der Gedanke, daß der Sohn Gottes Adam und Eva nach dem
Sündenfall durch das eusserliche Wort tröstet und mit dem Heiligen Geist stärkt, damit sie wieder Freude an
Gott und seiner Verehrung gewinnen. Bei der Frage „Ob diese Rede recht sey: Allein durch glauben werden
wir gerecht?“ ist nur der erste Absatz der Mecklenburger Kirchenordnung stehengeblieben. Ihre ausführ-
lichen Erläuterungen zur Rechtfertigungslehre239 sowie deren Abgrenzung gegenüber den Auffassungen der
katholischen Kirche („Was ist der unterschied der warhafftigen lere in unsern kirchen in diesem artickel und
der bepstlichen falschen lere?“ und „Ob die bepstliche lere recht sei, das ein mensch fur und fur in zweivel
bleiben sol, ob er vergebung der sünd habe und Gott gefellig sei?“)240 sind fortgefallen. Beim Abendmahl ist
nur der erste Abschnitt „Wozu soll die Niessung geschehen“ übernommen worden, die beiden folgenden
Stücke („Warum soll man die bepstliche mess abthun?“ und „Von unterschied der bepstlichen mess und des
rechten ambts in christlichen kirchen“) sind dagegen ausgelassen241. In gleicher Weise ist bei der Behand-
lung der Poenitentia oder Bekehrung der Abschnitt „Was strafen wir furmemlich in der bepstlichen lere [...]
von der poenitentia“ gestrichen242. Bei der Darstellung der drei Teile des Mosaischen Gesetzes ist nur das
erste Stück übernommen worden, die beiden Abschnitte zum „Lex moralis“ und zu Paulus’ Aussage „Wir
sind ledig vom Gesetz“ fehlen hingegen243.
Im zweiten Teil der Kirchenordnung „Von der Erhaltung des Ministerii Evangelici oder Predigamts“,
der im Druck von 1614 die Seiten 148-183 umfaßt, haben die beiden Superintendenten vor allem bei den
Abschnitten über die Ordination und die Visitationen Anpassungen an die Gewohnheiten der Schaumburger
Kirche vorgenommen. So sind etwa beim Thema „Visitation“ die Partien der Mecklenburgischen Kirchen-
ordnung von 1552 weggefallen, die sich mit der Erhaltung der Kirchen, Pfarrhäuser und Schulen und dem
Umgang mit den noch bestehenden Klöstern beschäftigen244. Neu sind in der Schaumburger Ordnung die
Verpflichtung der Pfarrer zur Führung von Jahrbüchern, in denen die Taufen, Konfirmationen und Ehe-
schließungen eingetragen werden, und die regelmäßige Rechnungslegung bei den Kirchengütern. Die von
den Superintendenten einzuberufenden Synoden sollen jeweils in der Woche nach Michaelis (29. September)
stattfinden.
Während der dritte Teil in der Mecklenburger Vorlage mit „Von ordnung der lection und gesang in der
kirchen“ überschrieben ist, trägt er im Schaumburger Druck von 1614 den Titel „Von der ordnung der
Ceremonien, Lection, Fest-, Feyer-, Werck- und Bettagen“ (S. 184-248). Anstelle der ausführlichen Rege-
lungen für die Ämter in den Stadtkirchen und den Kirchen auf dem Land245 begnügt er sich mit einer
rudimentären Ordnung der Gottesdienste mit Erläuterungen zur Beichte und Absolution und zum Gebet
nach der Predigt sowie einer Sammlung verschiedener Kollektengebete, die an Feiertagen bei der Epistel-
lesung oder nach der Kommunion Verwendung finden. Zwischen den Kirchen auf dem Land und denen in
den Städten wird dabei nicht unterschieden. Bei der Gestaltung der Taufe orientieren sich beide Ordnungen
239 Sehling, EKO V, S. 168f.
240 Ebd., S. 169-171.
241 Ebd., S. 173f.
242 Ebd., S. 175f.
243 Ebd., S. 185f.
244 Ebd., S. 196f.
245 Ebd., S. 197-204.
50