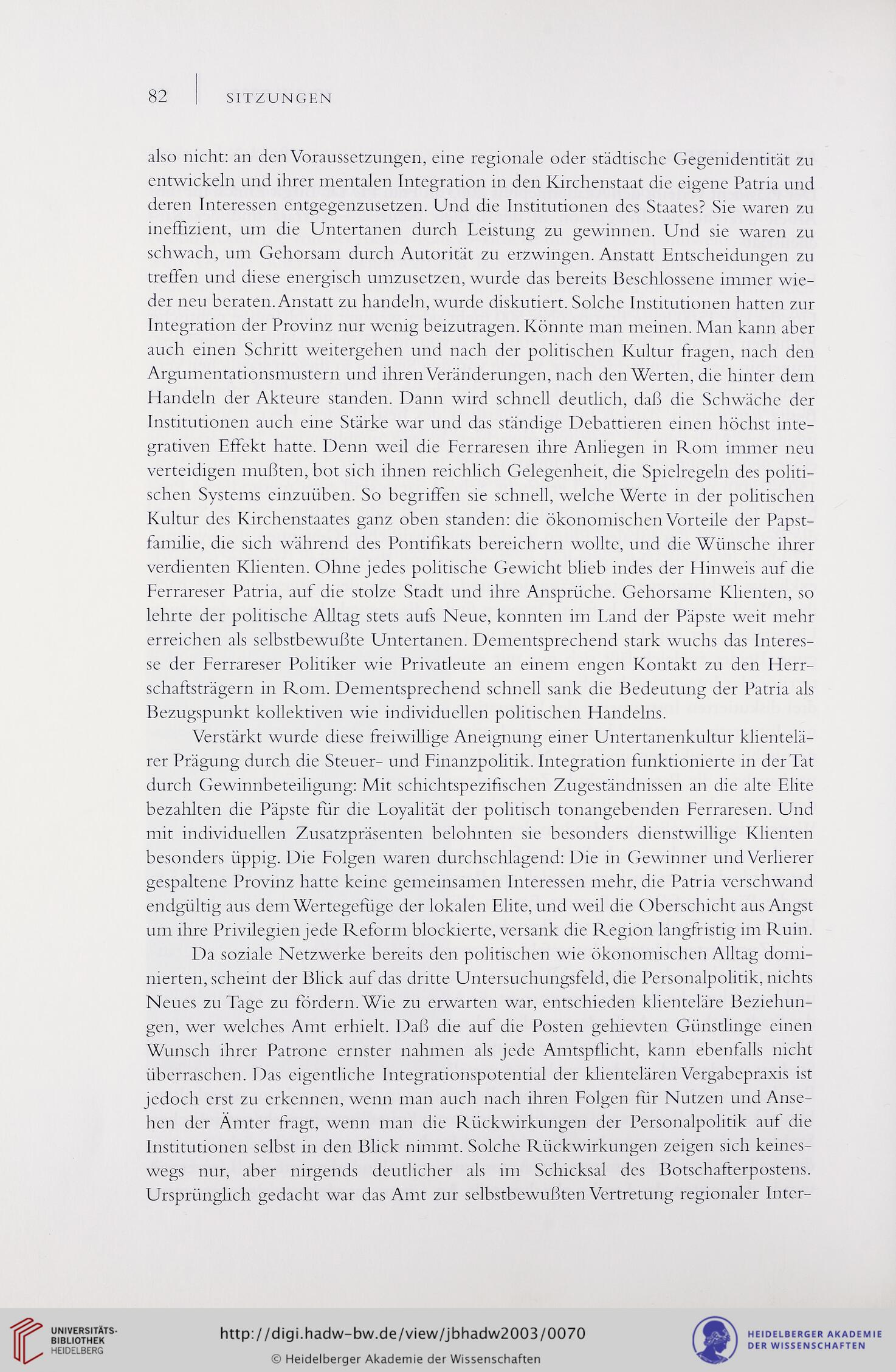82
SITZUNGEN
also nicht: an den Voraussetzungen, eine regionale oder städtische Gegenidentität zu
entwickeln und ihrer mentalen Integration in den Kirchenstaat die eigene Patria und
deren Interessen entgegenzusetzen. Und die Institutionen des Staates? Sie waren zu
ineffizient, um die Untertanen durch Leistung zu gewinnen. Und sie waren zu
schwach, um Gehorsam durch Autorität zu erzwingen. Anstatt Entscheidungen zu
treffen und diese energisch umzusetzen, wurde das bereits Beschlossene immer wie-
der neu beraten. Anstatt zu handeln, wurde diskutiert. Solche Institutionen hatten zur
Integration der Provinz nur wenig beizutragen. Könnte man meinen. Man kann aber
auch einen Schritt weitergehen und nach der politischen Kultur fragen, nach den
Argumentationsmustern und ihren Veränderungen, nach den Werten, die hinter dem
Handeln der Akteure standen. Dann wird schnell deutlich, daß die Schwäche der
Institutionen auch eine Stärke war und das ständige Debattieren einen höchst inte-
grativen Effekt hatte. Denn weil die Ferraresen ihre Anliegen in Rom immer neu
verteidigen mußten, bot sich ihnen reichlich Gelegenheit, die Spielregeln des politi-
schen Systems einzuüben. So begriffen sie schnell, welche Werte in der politischen
Kultur des Kirchenstaates ganz oben standen: die ökonomischen Vorteile der Papst-
familie, die sich während des Pontifikats bereichern wollte, und die Wünsche ihrer
verdienten Klienten. Ohne jedes politische Gewicht blieb indes der Hinweis auf die
Ferrareser Patria, auf die stolze Stadt und ihre Ansprüche. Gehorsame Klienten, so
lehrte der politische Alltag stets aufs Neue, konnten im Land der Päpste weit mehr
erreichen als selbstbewußte Untertanen. Dementsprechend stark wuchs das Interes-
se der Ferrareser Politiker wie Privatleute an einem engen Kontakt zu den Herr-
schaftsträgern in Rom. Dementsprechend schnell sank die Bedeutung der Patria als
Bezugspunkt kollektiven wie individuellen politischen Handelns.
Verstärkt wurde diese freiwillige Aneignung einer Untertanenkultur klientelä-
rer Prägung durch die Steuer- und Finanzpolitik. Integration funktionierte in der Tat
durch Gewinnbeteiligung: Mit schichtspezifischen Zugeständnissen an die alte Elite
bezahlten die Päpste für die Loyalität der politisch tonangebenden Ferraresen. Und
mit individuellen Zusatzpräsenten belohnten sie besonders dienstwillige Klienten
besonders üppig. Die Folgen waren durchschlagend: Die in Gewinner und Verlierer
gespaltene Provinz hatte keine gemeinsamen Interessen mehr, die Patria verschwand
endgültig aus demWertegefüge der lokalen Elite, und weil die Oberschicht aus Angst
um ihre Privilegien jede Reform blockierte, versank die Region langfristig im Rum.
Da soziale Netzwerke bereits den politischen wie ökonomischen Alltag domi-
nierten, scheint der Blick auf das dritte Untersuchungsfeld, die Personalpolitik, nichts
Neues zu Tage zu fordern. Wie zu erwarten war, entschieden klienteläre Beziehun-
gen, wer welches Amt erhielt. Daß die auf die Posten gehievten Günstlinge einen
Wunsch ihrer Patrone ernster nahmen als jede Amtspflicht, kann ebenfalls nicht
überraschen. Das eigentliche Integrationspotential der klientelären Vergabepraxis ist
jedoch erst zu erkennen, wenn man auch nach ihren Folgen für Nutzen und Anse-
hen der Ämter fragt, wenn man die Rückwirkungen der Personalpolitik auf die
Institutionen selbst in den Blick nimmt. Solche Rückwirkungen zeigen sich keines-
wegs nur, aber nirgends deutlicher als im Schicksal des Botschafterpostens.
Ursprünglich gedacht war das Amt zur selbstbewußten Vertretung regionaler Inter-
SITZUNGEN
also nicht: an den Voraussetzungen, eine regionale oder städtische Gegenidentität zu
entwickeln und ihrer mentalen Integration in den Kirchenstaat die eigene Patria und
deren Interessen entgegenzusetzen. Und die Institutionen des Staates? Sie waren zu
ineffizient, um die Untertanen durch Leistung zu gewinnen. Und sie waren zu
schwach, um Gehorsam durch Autorität zu erzwingen. Anstatt Entscheidungen zu
treffen und diese energisch umzusetzen, wurde das bereits Beschlossene immer wie-
der neu beraten. Anstatt zu handeln, wurde diskutiert. Solche Institutionen hatten zur
Integration der Provinz nur wenig beizutragen. Könnte man meinen. Man kann aber
auch einen Schritt weitergehen und nach der politischen Kultur fragen, nach den
Argumentationsmustern und ihren Veränderungen, nach den Werten, die hinter dem
Handeln der Akteure standen. Dann wird schnell deutlich, daß die Schwäche der
Institutionen auch eine Stärke war und das ständige Debattieren einen höchst inte-
grativen Effekt hatte. Denn weil die Ferraresen ihre Anliegen in Rom immer neu
verteidigen mußten, bot sich ihnen reichlich Gelegenheit, die Spielregeln des politi-
schen Systems einzuüben. So begriffen sie schnell, welche Werte in der politischen
Kultur des Kirchenstaates ganz oben standen: die ökonomischen Vorteile der Papst-
familie, die sich während des Pontifikats bereichern wollte, und die Wünsche ihrer
verdienten Klienten. Ohne jedes politische Gewicht blieb indes der Hinweis auf die
Ferrareser Patria, auf die stolze Stadt und ihre Ansprüche. Gehorsame Klienten, so
lehrte der politische Alltag stets aufs Neue, konnten im Land der Päpste weit mehr
erreichen als selbstbewußte Untertanen. Dementsprechend stark wuchs das Interes-
se der Ferrareser Politiker wie Privatleute an einem engen Kontakt zu den Herr-
schaftsträgern in Rom. Dementsprechend schnell sank die Bedeutung der Patria als
Bezugspunkt kollektiven wie individuellen politischen Handelns.
Verstärkt wurde diese freiwillige Aneignung einer Untertanenkultur klientelä-
rer Prägung durch die Steuer- und Finanzpolitik. Integration funktionierte in der Tat
durch Gewinnbeteiligung: Mit schichtspezifischen Zugeständnissen an die alte Elite
bezahlten die Päpste für die Loyalität der politisch tonangebenden Ferraresen. Und
mit individuellen Zusatzpräsenten belohnten sie besonders dienstwillige Klienten
besonders üppig. Die Folgen waren durchschlagend: Die in Gewinner und Verlierer
gespaltene Provinz hatte keine gemeinsamen Interessen mehr, die Patria verschwand
endgültig aus demWertegefüge der lokalen Elite, und weil die Oberschicht aus Angst
um ihre Privilegien jede Reform blockierte, versank die Region langfristig im Rum.
Da soziale Netzwerke bereits den politischen wie ökonomischen Alltag domi-
nierten, scheint der Blick auf das dritte Untersuchungsfeld, die Personalpolitik, nichts
Neues zu Tage zu fordern. Wie zu erwarten war, entschieden klienteläre Beziehun-
gen, wer welches Amt erhielt. Daß die auf die Posten gehievten Günstlinge einen
Wunsch ihrer Patrone ernster nahmen als jede Amtspflicht, kann ebenfalls nicht
überraschen. Das eigentliche Integrationspotential der klientelären Vergabepraxis ist
jedoch erst zu erkennen, wenn man auch nach ihren Folgen für Nutzen und Anse-
hen der Ämter fragt, wenn man die Rückwirkungen der Personalpolitik auf die
Institutionen selbst in den Blick nimmt. Solche Rückwirkungen zeigen sich keines-
wegs nur, aber nirgends deutlicher als im Schicksal des Botschafterpostens.
Ursprünglich gedacht war das Amt zur selbstbewußten Vertretung regionaler Inter-