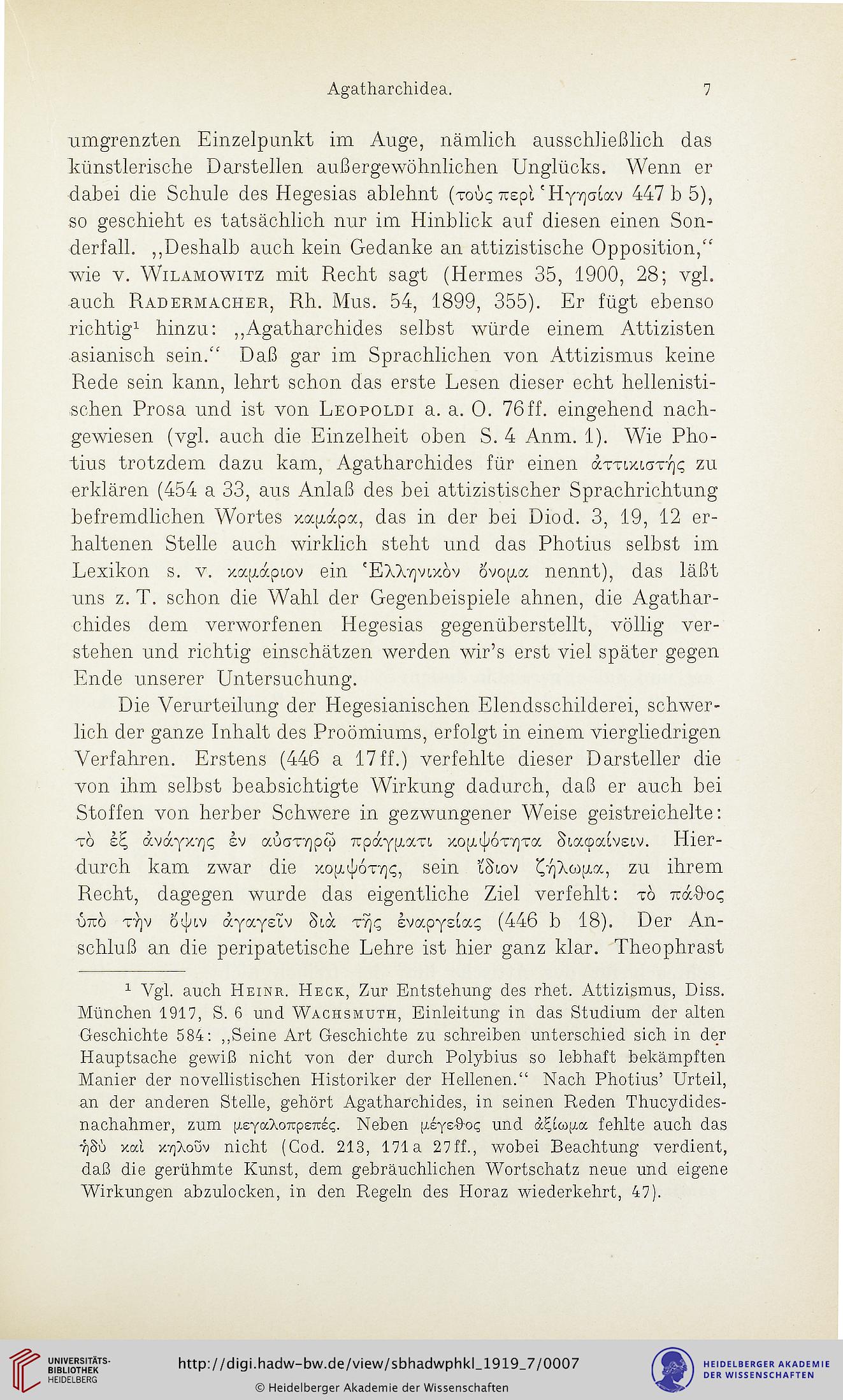Agatharchidea.
7
umgrenzten Einzelpunkt im Auge, nämlich ausschließlich das
künstlerische Darstellen außergewöhnlichen Unglücks. Wenn er
•dabei die Schule des Hegesias ablehnt |τούς περί'Ηγησίαν 447 b 5),
so geschieht es tatsächlich nur im Hinblick auf diesen einen Son-
derfall. „Deshalb auch kein Gedanke an attizistische Opposition,“
wie y. Wilamowitz mit Recht sagt (Hermes 35, 1900, 28; vgl.
auch Radermacher, Rh. Mus. 54, 1899, 355). Er fügt ebenso
richtig1 hinzu: „Agatharchides selbst würde einem Attizisten
asianisch sein.“ Daß gar im Sprachlichen von Attizismus keine
Rede sein kann, lehrt schon das erste Lesen dieser echt hellenisti-
schen Prosa und ist von Leopoldi a. a. 0. 76ff. eingehend nach-
gewiesen (vgl. auch die Einzelheit oben S. 4 Anm. 1). Wie Pho-
tius trotzdem dazu kam, Agatharchides für einen αττικιστής zu
erklären (454 a 33, aus Anlaß des bei attizistischer Sprachrichtung
befremdlichen Wortes καμάρα, das in der bei Diod. 3, 19, 12 er-
haltenen Stelle auch wirklich steht und das Photius selbst im
Lexikon s. v. καμάρων ein Ελληνικόν όνομα nennt), das läßt
uns z. T. schon die AVahl der Gegenbeispiele ahnen, die Agathar-
chides dem verworfenen Hegesias gegenüberstellt, völlig ver-
stehen und richtig einschätzen werden wir’s erst viel später gegen
Ende unserer Untersuchung.
Die Verurteilung der Hegesianischen Elendsschilderei, schwer-
lich der ganze Inhalt des Proömiums, erfolgt in einem viergliedrigen
Verfahren. Erstens (446 a 17ff.) verfehlte dieser Darsteller die
von ihm selbst beabsichtigte Wirkung dadurch, daß er auch bei
Stoffen von herber Schwere in gezwungener Weise geistreichelte:
τό έξ ανάγκης έν αύστηρω πράγματι κομψότητα διαψαίνειν. Hier-
durch kam zwar die κομψότης, sein ίδιον ζήλωμα, zu ihrem
Recht, dagegen wurde das eigentliche Ziel verfehlt: τό πάθος
υπό την οψιν άγαγεΐν διά τής έναργείας (446 b 18). Der An-
schluß an die peripatetische Lehre ist hier ganz klar. Theophrast
1 Vgl. auch Heinr. Heck, Zur Entstehung des rhet. Attizismus, Diss.
München 1917, S. 6 und Wachsmuth, Einleitung in das Studium der alten
Geschichte 584: „Seine Art Geschichte zu schreiben unterschied sich in der
Hauptsache gewiß nicht von der durch Polybius so lebhaft bekämpften
Manier der novellistischen Historiker der Hellenen.“ Nach Photius’ Urteil,
an der anderen Stelle, gehört Agatharchides, in seinen Paeden Thucydides-
nachahmer, zum μεγαλοπρεπές. Neben μέγεθος und άξίωμα fehlte auch das
■ήδύ καί κηλοΰν nicht (Cod. 213, 171a 27ff., wobei Beachtung verdient,
daß die gerühmte Kunst, dem gebräuchlichen Wortschatz neue und eigene
Wirkungen abzulocken, in den Regeln des Horaz wiederkehrt, 47).
7
umgrenzten Einzelpunkt im Auge, nämlich ausschließlich das
künstlerische Darstellen außergewöhnlichen Unglücks. Wenn er
•dabei die Schule des Hegesias ablehnt |τούς περί'Ηγησίαν 447 b 5),
so geschieht es tatsächlich nur im Hinblick auf diesen einen Son-
derfall. „Deshalb auch kein Gedanke an attizistische Opposition,“
wie y. Wilamowitz mit Recht sagt (Hermes 35, 1900, 28; vgl.
auch Radermacher, Rh. Mus. 54, 1899, 355). Er fügt ebenso
richtig1 hinzu: „Agatharchides selbst würde einem Attizisten
asianisch sein.“ Daß gar im Sprachlichen von Attizismus keine
Rede sein kann, lehrt schon das erste Lesen dieser echt hellenisti-
schen Prosa und ist von Leopoldi a. a. 0. 76ff. eingehend nach-
gewiesen (vgl. auch die Einzelheit oben S. 4 Anm. 1). Wie Pho-
tius trotzdem dazu kam, Agatharchides für einen αττικιστής zu
erklären (454 a 33, aus Anlaß des bei attizistischer Sprachrichtung
befremdlichen Wortes καμάρα, das in der bei Diod. 3, 19, 12 er-
haltenen Stelle auch wirklich steht und das Photius selbst im
Lexikon s. v. καμάρων ein Ελληνικόν όνομα nennt), das läßt
uns z. T. schon die AVahl der Gegenbeispiele ahnen, die Agathar-
chides dem verworfenen Hegesias gegenüberstellt, völlig ver-
stehen und richtig einschätzen werden wir’s erst viel später gegen
Ende unserer Untersuchung.
Die Verurteilung der Hegesianischen Elendsschilderei, schwer-
lich der ganze Inhalt des Proömiums, erfolgt in einem viergliedrigen
Verfahren. Erstens (446 a 17ff.) verfehlte dieser Darsteller die
von ihm selbst beabsichtigte Wirkung dadurch, daß er auch bei
Stoffen von herber Schwere in gezwungener Weise geistreichelte:
τό έξ ανάγκης έν αύστηρω πράγματι κομψότητα διαψαίνειν. Hier-
durch kam zwar die κομψότης, sein ίδιον ζήλωμα, zu ihrem
Recht, dagegen wurde das eigentliche Ziel verfehlt: τό πάθος
υπό την οψιν άγαγεΐν διά τής έναργείας (446 b 18). Der An-
schluß an die peripatetische Lehre ist hier ganz klar. Theophrast
1 Vgl. auch Heinr. Heck, Zur Entstehung des rhet. Attizismus, Diss.
München 1917, S. 6 und Wachsmuth, Einleitung in das Studium der alten
Geschichte 584: „Seine Art Geschichte zu schreiben unterschied sich in der
Hauptsache gewiß nicht von der durch Polybius so lebhaft bekämpften
Manier der novellistischen Historiker der Hellenen.“ Nach Photius’ Urteil,
an der anderen Stelle, gehört Agatharchides, in seinen Paeden Thucydides-
nachahmer, zum μεγαλοπρεπές. Neben μέγεθος und άξίωμα fehlte auch das
■ήδύ καί κηλοΰν nicht (Cod. 213, 171a 27ff., wobei Beachtung verdient,
daß die gerühmte Kunst, dem gebräuchlichen Wortschatz neue und eigene
Wirkungen abzulocken, in den Regeln des Horaz wiederkehrt, 47).