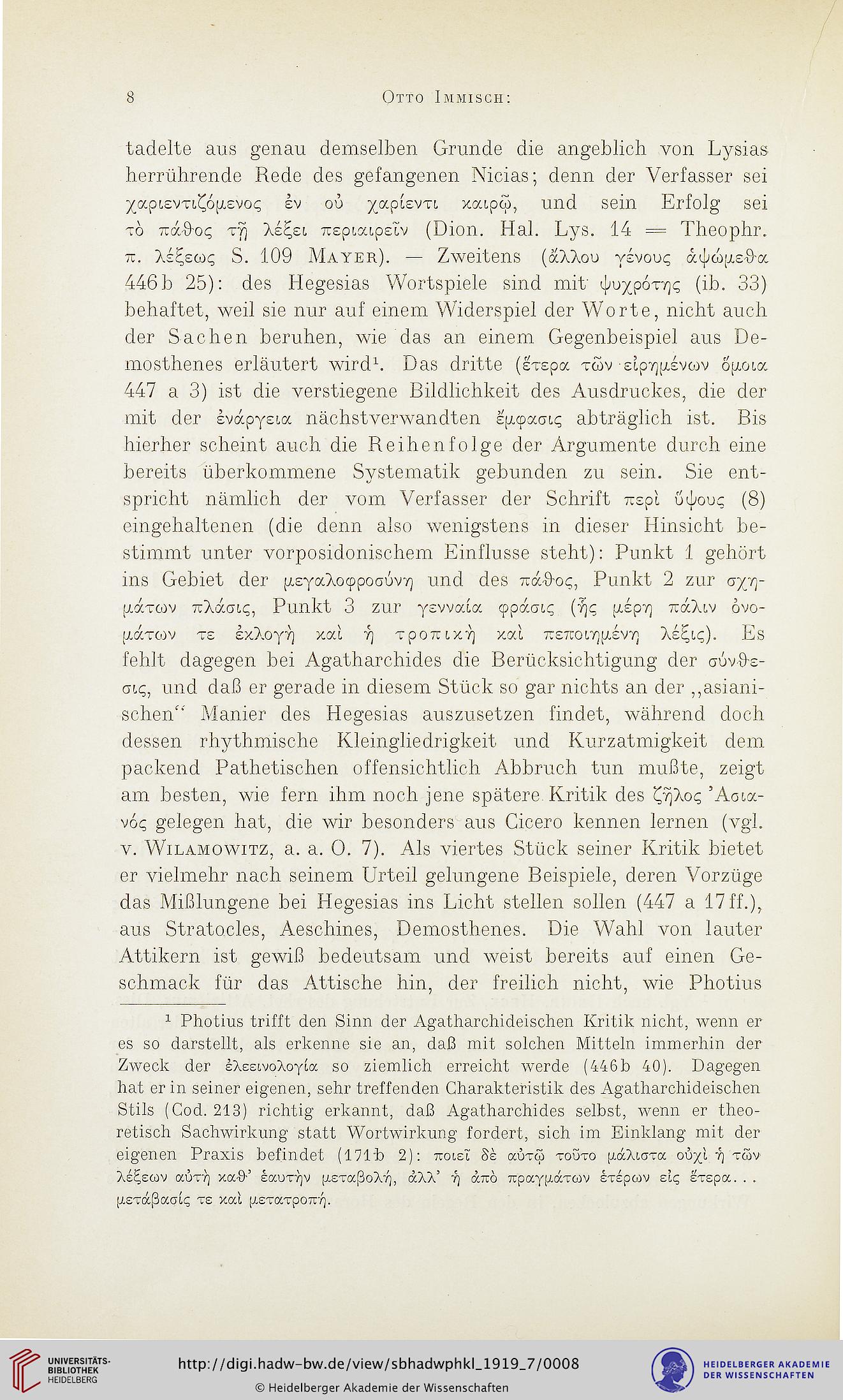8
Otto Immisch:
tadelte aus genau demselben Grunde die angeblich von Lysias
herrührende Rede des gefangenen Nicias; denn der Verfasser sei
χαριεντιζόμενος έν ού χαρίεντι κάψω, und sein Erfolg sei
τό πάθος τη λέξει περιαιρεΐν (Dion. Hai. Lys. 14 = Theophr.
π. λέξεως S. 109 Mayer). — Zweitens (άλλου γένους άψώμεθα.
446b 25): des Hegesias Wortspiele sind mit ψυχρότης (ib. 33)
behaftet, weil sie nur auf einem Widerspiel der Worte, nicht auch
der Sachen beruhen, wie das an einem Gegenbeispiel aus De-
mosthenes erläutert wird1. Das dritte (ετερα των εφημένων όμοια.
447 a 3) ist die verstiegene Bildlichkeit des Ausdruckes, die der
mit der ένάργεια nächstverwandten εμφασις abträglich ist. Bis
hierher scheint auch die Reihenfolge der Argumente durch eine
bereits überkommene Systematik gebunden zu sein. Sie ent-
spricht nämlich der vom Verfasser der Schrift περί υψους (8)
eingehaltenen (die denn also wenigstens in dieser Hinsicht be-
stimmt unter vorposidonischem Einflüsse steht): Punkt 1 gehört
ins Gebiet der μεγαλοφροσύνη und des πάθος, Punkt 2 zur σχη-
μάτων πλάσί,ς, Punkt 3 zur γενναία φράσις (ής μέρη πάλιν ονο-
μάτων τε εκλογή καί ή τροπική καί πεποιημένη λέξί,ς). Es
fehlt dagegen bei Agatharchides die Berücksichtigung der σύνθε-
σής, und daß er gerade in diesem Stück so gar nichts an der ,,asiani-
schen“ Manier des Hegesias auszusetzen findet, während doch
dessen rhythmische Kleingliedrigkeit und Kurzatmigkeit dem
packend Pathetischen offensichtlich Abbruch tun mußte, zeigt
am besten, wie fern ihm noch jene spätere. Kritik des ζήλος Ασια-
νός gelegen hat, die wir besonders aus Cicero kennen lernen (vgl.
v. Wilamowitz, a. a. 0. 7). Als viertes Stück seiner Kritik bietet
er vielmehr nach seinem Urteil gelungene Beispiele, deren Vorzüge
das Mißlungene bei Hegesias ins Licht stellen sollen (447 a 17 ff.),
aus Stratocles, Aeschines, Demosthenes. Die Wahl von lauter
Attikern ist gewiß bedeutsam und weist bereits auf einen Ge-
schmack für das Attische hin, der freilich nicht, wie Photius
1 Photius trifft den Sinn der Agatharchideischen Kritik nicht, wenn er
es so darstellt, als erkenne sie an, daß mit solchen Mitteln immerhin der
Zweck der έλεεινολογία so ziemlich erreicht werde (446b 40). Dagegen
hat er in seiner eigenen, sehr treffenden Charakteristik des Agatharchideischen
Stils (Cod. 213) richtig erkannt, daß Agatharchides selbst, wenn er theo-
retisch Sachwirkung statt Wortwirkung fordert, sich im Einklang mit der
eigenen Praxis befindet (171b 2): ποιεί δέ αύτω τούτο μάλιστα ούχί ή των
λέξεων αύτή κα-9·’ έαυτήν μεταβολή, άλλ’ ή άπό πραγμάτων ετέρων εις ετερα. . .
μετάβασίς τε καί μετατροπή.
Otto Immisch:
tadelte aus genau demselben Grunde die angeblich von Lysias
herrührende Rede des gefangenen Nicias; denn der Verfasser sei
χαριεντιζόμενος έν ού χαρίεντι κάψω, und sein Erfolg sei
τό πάθος τη λέξει περιαιρεΐν (Dion. Hai. Lys. 14 = Theophr.
π. λέξεως S. 109 Mayer). — Zweitens (άλλου γένους άψώμεθα.
446b 25): des Hegesias Wortspiele sind mit ψυχρότης (ib. 33)
behaftet, weil sie nur auf einem Widerspiel der Worte, nicht auch
der Sachen beruhen, wie das an einem Gegenbeispiel aus De-
mosthenes erläutert wird1. Das dritte (ετερα των εφημένων όμοια.
447 a 3) ist die verstiegene Bildlichkeit des Ausdruckes, die der
mit der ένάργεια nächstverwandten εμφασις abträglich ist. Bis
hierher scheint auch die Reihenfolge der Argumente durch eine
bereits überkommene Systematik gebunden zu sein. Sie ent-
spricht nämlich der vom Verfasser der Schrift περί υψους (8)
eingehaltenen (die denn also wenigstens in dieser Hinsicht be-
stimmt unter vorposidonischem Einflüsse steht): Punkt 1 gehört
ins Gebiet der μεγαλοφροσύνη und des πάθος, Punkt 2 zur σχη-
μάτων πλάσί,ς, Punkt 3 zur γενναία φράσις (ής μέρη πάλιν ονο-
μάτων τε εκλογή καί ή τροπική καί πεποιημένη λέξί,ς). Es
fehlt dagegen bei Agatharchides die Berücksichtigung der σύνθε-
σής, und daß er gerade in diesem Stück so gar nichts an der ,,asiani-
schen“ Manier des Hegesias auszusetzen findet, während doch
dessen rhythmische Kleingliedrigkeit und Kurzatmigkeit dem
packend Pathetischen offensichtlich Abbruch tun mußte, zeigt
am besten, wie fern ihm noch jene spätere. Kritik des ζήλος Ασια-
νός gelegen hat, die wir besonders aus Cicero kennen lernen (vgl.
v. Wilamowitz, a. a. 0. 7). Als viertes Stück seiner Kritik bietet
er vielmehr nach seinem Urteil gelungene Beispiele, deren Vorzüge
das Mißlungene bei Hegesias ins Licht stellen sollen (447 a 17 ff.),
aus Stratocles, Aeschines, Demosthenes. Die Wahl von lauter
Attikern ist gewiß bedeutsam und weist bereits auf einen Ge-
schmack für das Attische hin, der freilich nicht, wie Photius
1 Photius trifft den Sinn der Agatharchideischen Kritik nicht, wenn er
es so darstellt, als erkenne sie an, daß mit solchen Mitteln immerhin der
Zweck der έλεεινολογία so ziemlich erreicht werde (446b 40). Dagegen
hat er in seiner eigenen, sehr treffenden Charakteristik des Agatharchideischen
Stils (Cod. 213) richtig erkannt, daß Agatharchides selbst, wenn er theo-
retisch Sachwirkung statt Wortwirkung fordert, sich im Einklang mit der
eigenen Praxis befindet (171b 2): ποιεί δέ αύτω τούτο μάλιστα ούχί ή των
λέξεων αύτή κα-9·’ έαυτήν μεταβολή, άλλ’ ή άπό πραγμάτων ετέρων εις ετερα. . .
μετάβασίς τε καί μετατροπή.