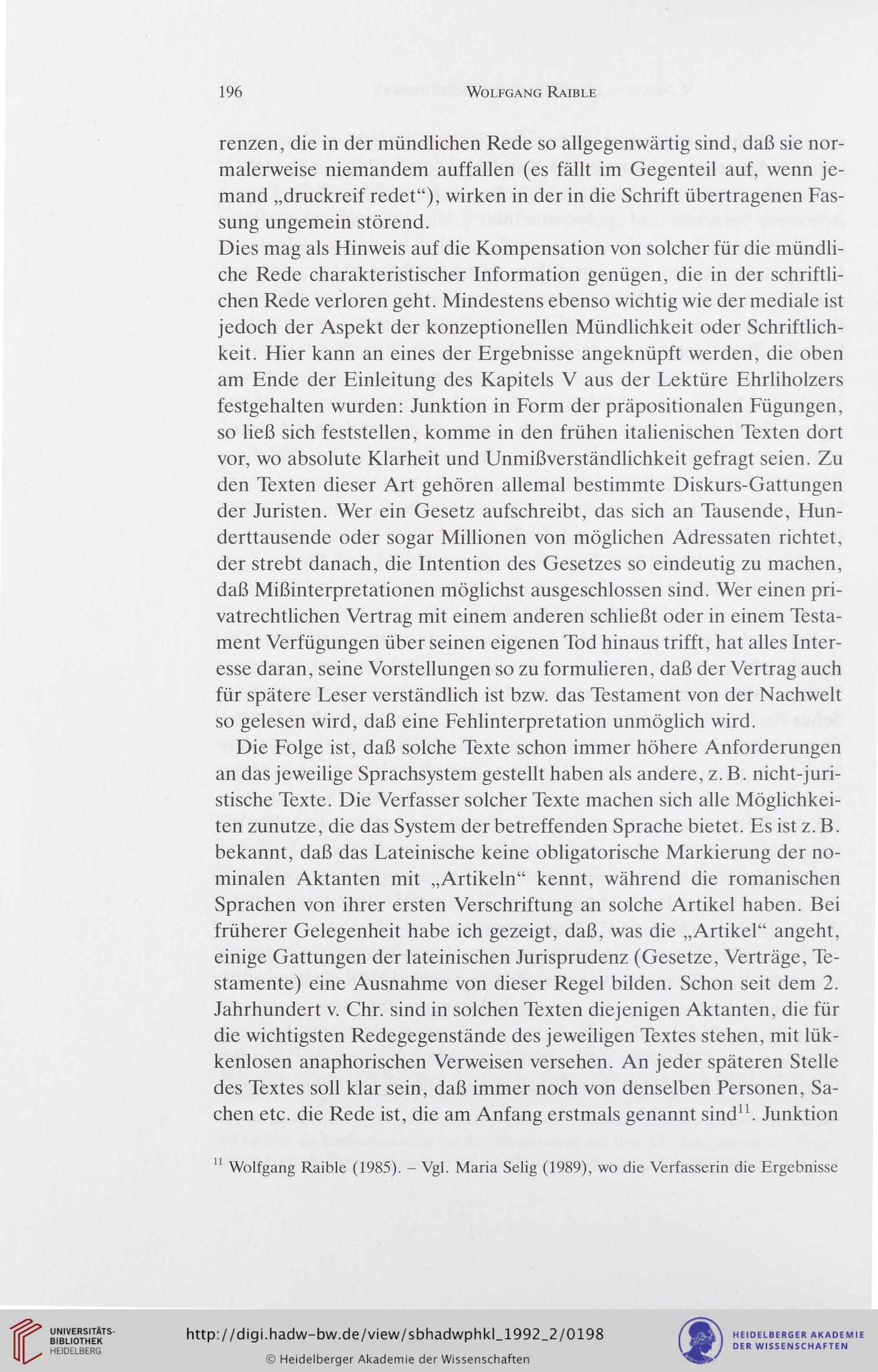196
Wolfgang Raible
renzen, die in der mündlichen Rede so allgegenwärtig sind, daß sie nor-
malerweise niemandem auffallen (es fällt im Gegenteil auf, wenn je-
mand „druckreif redet“), wirken in der in die Schrift übertragenen Fas-
sung ungemein störend.
Dies mag als Hinweis auf die Kompensation von solcher für die mündli-
che Rede charakteristischer Information genügen, die in der schriftli-
chen Rede verloren geht. Mindestens ebenso wichtig wie der mediale ist
jedoch der Aspekt der konzeptionellen Mündlichkeit oder Schriftlich-
keit. Hier kann an eines der Ergebnisse angeknüpft werden, die oben
am Ende der Einleitung des Kapitels V aus der Lektüre Ehrliholzers
festgehalten wurden: Junktion in Form der präpositionalen Fügungen,
so ließ sich feststellen, komme in den frühen italienischen Texten dort
vor, wo absolute Klarheit und Unmißverständlichkeit gefragt seien. Zu
den Texten dieser Art gehören allemal bestimmte Diskurs-Gattungen
der Juristen. Wer ein Gesetz aufschreibt, das sich an Tausende, Hun-
derttausende oder sogar Millionen von möglichen Adressaten richtet,
der strebt danach, die Intention des Gesetzes so eindeutig zu machen,
daß Mißinterpretationen möglichst ausgeschlossen sind. Wer einen pri-
vatrechtlichen Vertrag mit einem anderen schließt oder in einem Testa-
ment Verfügungen über seinen eigenen Tod hinaus trifft, hat alles Inter-
esse daran, seine Vorstellungen so zu formulieren, daß der Vertrag auch
für spätere Leser verständlich ist bzw. das Testament von der Nachwelt
so gelesen wird, daß eine Fehlinterpretation unmöglich wird.
Die Folge ist, daß solche Texte schon immer höhere Anforderungen
an das jeweilige Sprachsystem gestellt haben als andere, z. B. nicht-juri-
stische Texte. Die Verfasser solcher Texte machen sich alle Möglichkei-
ten zunutze, die das System der betreffenden Sprache bietet. Es ist z. B.
bekannt, daß das Lateinische keine obligatorische Markierung der no-
minalen Aktanten mit „Artikeln“ kennt, während die romanischen
Sprachen von ihrer ersten Verschriftung an solche Artikel haben. Bei
früherer Gelegenheit habe ich gezeigt, daß, was die „Artikel“ angeht,
einige Gattungen der lateinischen Jurisprudenz (Gesetze, Verträge, Te-
stamente) eine Ausnahme von dieser Regel bilden. Schon seit dem 2.
Jahrhundert v. Chr. sind in solchen Texten diejenigen Aktanten, die für
die wichtigsten Redegegenstände des jeweiligen Textes stehen, mit lük-
kenlosen anaphorischen Verweisen versehen. An jeder späteren Stelle
des Textes soll klar sein, daß immer noch von denselben Personen, Sa-
chen etc. die Rede ist, die am Anfang erstmals genannt sind11. Junktion
11 Wolfgang Raible (1985). - Vgl. Maria Selig (1989), wo die Verfasserin die Ergebnisse
Wolfgang Raible
renzen, die in der mündlichen Rede so allgegenwärtig sind, daß sie nor-
malerweise niemandem auffallen (es fällt im Gegenteil auf, wenn je-
mand „druckreif redet“), wirken in der in die Schrift übertragenen Fas-
sung ungemein störend.
Dies mag als Hinweis auf die Kompensation von solcher für die mündli-
che Rede charakteristischer Information genügen, die in der schriftli-
chen Rede verloren geht. Mindestens ebenso wichtig wie der mediale ist
jedoch der Aspekt der konzeptionellen Mündlichkeit oder Schriftlich-
keit. Hier kann an eines der Ergebnisse angeknüpft werden, die oben
am Ende der Einleitung des Kapitels V aus der Lektüre Ehrliholzers
festgehalten wurden: Junktion in Form der präpositionalen Fügungen,
so ließ sich feststellen, komme in den frühen italienischen Texten dort
vor, wo absolute Klarheit und Unmißverständlichkeit gefragt seien. Zu
den Texten dieser Art gehören allemal bestimmte Diskurs-Gattungen
der Juristen. Wer ein Gesetz aufschreibt, das sich an Tausende, Hun-
derttausende oder sogar Millionen von möglichen Adressaten richtet,
der strebt danach, die Intention des Gesetzes so eindeutig zu machen,
daß Mißinterpretationen möglichst ausgeschlossen sind. Wer einen pri-
vatrechtlichen Vertrag mit einem anderen schließt oder in einem Testa-
ment Verfügungen über seinen eigenen Tod hinaus trifft, hat alles Inter-
esse daran, seine Vorstellungen so zu formulieren, daß der Vertrag auch
für spätere Leser verständlich ist bzw. das Testament von der Nachwelt
so gelesen wird, daß eine Fehlinterpretation unmöglich wird.
Die Folge ist, daß solche Texte schon immer höhere Anforderungen
an das jeweilige Sprachsystem gestellt haben als andere, z. B. nicht-juri-
stische Texte. Die Verfasser solcher Texte machen sich alle Möglichkei-
ten zunutze, die das System der betreffenden Sprache bietet. Es ist z. B.
bekannt, daß das Lateinische keine obligatorische Markierung der no-
minalen Aktanten mit „Artikeln“ kennt, während die romanischen
Sprachen von ihrer ersten Verschriftung an solche Artikel haben. Bei
früherer Gelegenheit habe ich gezeigt, daß, was die „Artikel“ angeht,
einige Gattungen der lateinischen Jurisprudenz (Gesetze, Verträge, Te-
stamente) eine Ausnahme von dieser Regel bilden. Schon seit dem 2.
Jahrhundert v. Chr. sind in solchen Texten diejenigen Aktanten, die für
die wichtigsten Redegegenstände des jeweiligen Textes stehen, mit lük-
kenlosen anaphorischen Verweisen versehen. An jeder späteren Stelle
des Textes soll klar sein, daß immer noch von denselben Personen, Sa-
chen etc. die Rede ist, die am Anfang erstmals genannt sind11. Junktion
11 Wolfgang Raible (1985). - Vgl. Maria Selig (1989), wo die Verfasserin die Ergebnisse