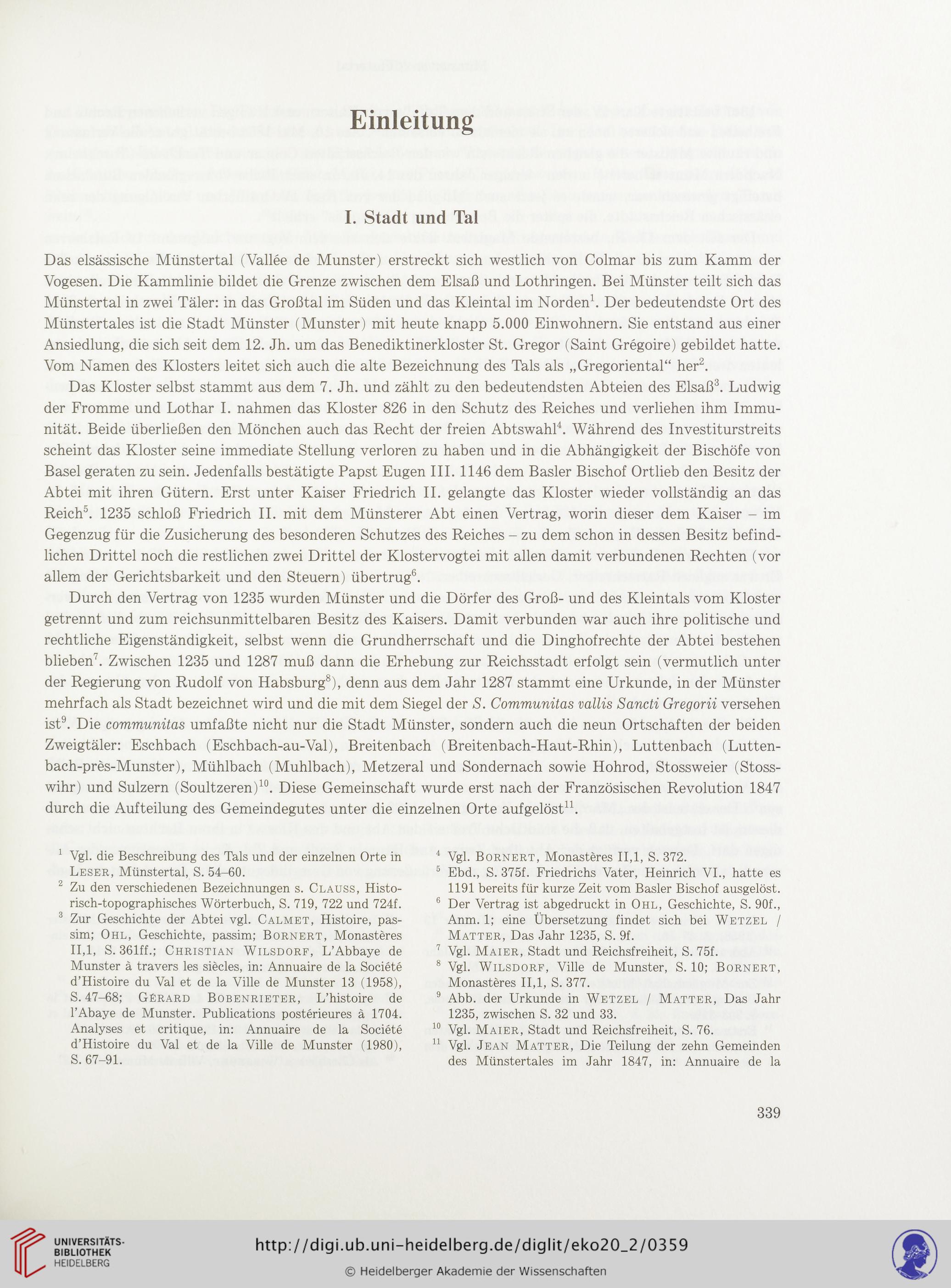Einleitung
I. Stadt und Tal
Das elsässische Münstertal (Vallée de Munster) erstreckt sich westlich von Colmar bis zum Kamm der
Vogesen. Die Kammlinie bildet die Grenze zwischen dem Elsaß und Lothringen. Bei Münster teilt sich das
Münstertal in zwei Täler: in das Großtal im Süden und das Kleintal im Norden1. Der bedeutendste Ort des
Münstertales ist die Stadt Münster (Munster) mit heute knapp 5.000 Einwohnern. Sie entstand aus einer
Ansiedlung, die sich seit dem 12. Jh. um das Benediktinerkloster St. Gregor (Saint Grégoire) gebildet hatte.
Vom Namen des Klosters leitet sich auch die alte Bezeichnung des Tals als „Gregoriental“ her2.
Das Kloster selbst stammt aus dem 7. Jh. und zählt zu den bedeutendsten Abteien des Elsaß3. Ludwig
der Fromme und Lothar I. nahmen das Kloster 826 in den Schutz des Reiches und verliehen ihm Immu-
nität. Beide überließen den Mönchen auch das Recht der freien Abtswahl4. Während des Investiturstreits
scheint das Kloster seine immediate Stellung verloren zu haben und in die Abhängigkeit der Bischöfe von
Basel geraten zu sein. Jedenfalls bestätigte Papst Eugen III. 1146 dem Basler Bischof Ortlieb den Besitz der
Abtei mit ihren Gütern. Erst unter Kaiser Friedrich II. gelangte das Kloster wieder vollständig an das
Reich5. 1235 schloß Friedrich II. mit dem Münsterer Abt einen Vertrag, worin dieser dem Kaiser - im
Gegenzug für die Zusicherung des besonderen Schutzes des Reiches - zu dem schon in dessen Besitz befind-
lichen Drittel noch die restlichen zwei Drittel der Klostervogtei mit allen damit verbundenen Rechten (vor
allem der Gerichtsbarkeit und den Steuern) übertrug6.
Durch den Vertrag von 1235 wurden Münster und die Dörfer des Groß- und des Kleintals vom Kloster
getrennt und zum reichsunmittelbaren Besitz des Kaisers. Damit verbunden war auch ihre politische und
rechtliche Eigenständigkeit, selbst wenn die Grundherrschaft und die Dinghofrechte der Abtei bestehen
blieben7. Zwischen 1235 und 1287 muß dann die Erhebung zur Reichsstadt erfolgt sein (vermutlich unter
der Regierung von Rudolf von Habsburg8), denn aus dem Jahr 1287 stammt eine Urkunde, in der Münster
mehrfach als Stadt bezeichnet wird und die mit dem Siegel der S. Communitas vallis Sancti Gregorii versehen
ist9. Die communitas umfaßte nicht nur die Stadt Münster, sondern auch die neun Ortschaften der beiden
Zweigtäler: Eschbach (Eschbach-au-Val), Breitenbach (Breitenbach-Haut-Rhin), Luttenbach (Lutten-
bach-pres-Munster), Mühlbach (Muhlbach), Metzeral und Sondernach sowie Hohrod, Stossweier (Stoss-
wihr) und Sulzern (Soultzeren)10. Diese Gemeinschaft wurde erst nach der Französischen Revolution 1847
durch die Aufteilung des Gemeindegutes unter die einzelnen Orte aufgelöst11.
1 Vgl. die Beschreibung des Tals und der einzelnen Orte in
Leser, Münstertal, S. 54-60.
2 Zu den verschiedenen Bezeichnungen s. Clauss, Histo-
risch-topographisches Wörterbuch, S. 719, 722 und 724f.
3 Zur Geschichte der Abtei vgl. Calmet, Histoire, pas-
sim; Ohl, Geschichte, passim; Bornert, Monastères
II,1, S. 361ff.; Christian Wilsdorf, L’Abbayede
Munster à travers les siècles, in: Annuaire de la Société
d’Histoire du Val et de la Ville de Munster 13 (1958),
S. 47-68; Gérard Bobenrieter, L’histoire de
l’Abaye de Munster. Publications postérieures à 1704.
Analyses et critique, in: Annuaire de la Société
d’Histoire du Val et de la Ville de Munster (1980),
S. 67-91.
4 Vgl. Bornert, Monastères II, 1, S. 372.
5 Ebd., S. 375f. Friedrichs Vater, Heinrich VI., hatte es
1191 bereits für kurze Zeit vom Basler Bischof ausgelöst.
6 Der Vertrag ist abgedruckt in Ohl, Geschichte, S. 90f.,
Anm. 1; eine Übersetzung findet sich bei Wetzel /
Matter, Das Jahr 1235, S. 9f.
7 Vgl. Maier, Stadt und Reichsfreiheit, S. 75f.
8 Vgl. Wilsdorf, Ville de Munster, S. 10; Bornert,
Monastères II, 1, S. 377.
9 Abb. der Urkunde in Wetzel / Matter, Das Jahr
1235, zwischen S. 32 und 33.
10 Vgl. Maier, Stadt und Reichsfreiheit, S. 76.
11 Vgl. Jean Matter, Die Teilung der zehn Gemeinden
des Münstertales im Jahr 1847, in: Annuaire de la
339
I. Stadt und Tal
Das elsässische Münstertal (Vallée de Munster) erstreckt sich westlich von Colmar bis zum Kamm der
Vogesen. Die Kammlinie bildet die Grenze zwischen dem Elsaß und Lothringen. Bei Münster teilt sich das
Münstertal in zwei Täler: in das Großtal im Süden und das Kleintal im Norden1. Der bedeutendste Ort des
Münstertales ist die Stadt Münster (Munster) mit heute knapp 5.000 Einwohnern. Sie entstand aus einer
Ansiedlung, die sich seit dem 12. Jh. um das Benediktinerkloster St. Gregor (Saint Grégoire) gebildet hatte.
Vom Namen des Klosters leitet sich auch die alte Bezeichnung des Tals als „Gregoriental“ her2.
Das Kloster selbst stammt aus dem 7. Jh. und zählt zu den bedeutendsten Abteien des Elsaß3. Ludwig
der Fromme und Lothar I. nahmen das Kloster 826 in den Schutz des Reiches und verliehen ihm Immu-
nität. Beide überließen den Mönchen auch das Recht der freien Abtswahl4. Während des Investiturstreits
scheint das Kloster seine immediate Stellung verloren zu haben und in die Abhängigkeit der Bischöfe von
Basel geraten zu sein. Jedenfalls bestätigte Papst Eugen III. 1146 dem Basler Bischof Ortlieb den Besitz der
Abtei mit ihren Gütern. Erst unter Kaiser Friedrich II. gelangte das Kloster wieder vollständig an das
Reich5. 1235 schloß Friedrich II. mit dem Münsterer Abt einen Vertrag, worin dieser dem Kaiser - im
Gegenzug für die Zusicherung des besonderen Schutzes des Reiches - zu dem schon in dessen Besitz befind-
lichen Drittel noch die restlichen zwei Drittel der Klostervogtei mit allen damit verbundenen Rechten (vor
allem der Gerichtsbarkeit und den Steuern) übertrug6.
Durch den Vertrag von 1235 wurden Münster und die Dörfer des Groß- und des Kleintals vom Kloster
getrennt und zum reichsunmittelbaren Besitz des Kaisers. Damit verbunden war auch ihre politische und
rechtliche Eigenständigkeit, selbst wenn die Grundherrschaft und die Dinghofrechte der Abtei bestehen
blieben7. Zwischen 1235 und 1287 muß dann die Erhebung zur Reichsstadt erfolgt sein (vermutlich unter
der Regierung von Rudolf von Habsburg8), denn aus dem Jahr 1287 stammt eine Urkunde, in der Münster
mehrfach als Stadt bezeichnet wird und die mit dem Siegel der S. Communitas vallis Sancti Gregorii versehen
ist9. Die communitas umfaßte nicht nur die Stadt Münster, sondern auch die neun Ortschaften der beiden
Zweigtäler: Eschbach (Eschbach-au-Val), Breitenbach (Breitenbach-Haut-Rhin), Luttenbach (Lutten-
bach-pres-Munster), Mühlbach (Muhlbach), Metzeral und Sondernach sowie Hohrod, Stossweier (Stoss-
wihr) und Sulzern (Soultzeren)10. Diese Gemeinschaft wurde erst nach der Französischen Revolution 1847
durch die Aufteilung des Gemeindegutes unter die einzelnen Orte aufgelöst11.
1 Vgl. die Beschreibung des Tals und der einzelnen Orte in
Leser, Münstertal, S. 54-60.
2 Zu den verschiedenen Bezeichnungen s. Clauss, Histo-
risch-topographisches Wörterbuch, S. 719, 722 und 724f.
3 Zur Geschichte der Abtei vgl. Calmet, Histoire, pas-
sim; Ohl, Geschichte, passim; Bornert, Monastères
II,1, S. 361ff.; Christian Wilsdorf, L’Abbayede
Munster à travers les siècles, in: Annuaire de la Société
d’Histoire du Val et de la Ville de Munster 13 (1958),
S. 47-68; Gérard Bobenrieter, L’histoire de
l’Abaye de Munster. Publications postérieures à 1704.
Analyses et critique, in: Annuaire de la Société
d’Histoire du Val et de la Ville de Munster (1980),
S. 67-91.
4 Vgl. Bornert, Monastères II, 1, S. 372.
5 Ebd., S. 375f. Friedrichs Vater, Heinrich VI., hatte es
1191 bereits für kurze Zeit vom Basler Bischof ausgelöst.
6 Der Vertrag ist abgedruckt in Ohl, Geschichte, S. 90f.,
Anm. 1; eine Übersetzung findet sich bei Wetzel /
Matter, Das Jahr 1235, S. 9f.
7 Vgl. Maier, Stadt und Reichsfreiheit, S. 75f.
8 Vgl. Wilsdorf, Ville de Munster, S. 10; Bornert,
Monastères II, 1, S. 377.
9 Abb. der Urkunde in Wetzel / Matter, Das Jahr
1235, zwischen S. 32 und 33.
10 Vgl. Maier, Stadt und Reichsfreiheit, S. 76.
11 Vgl. Jean Matter, Die Teilung der zehn Gemeinden
des Münstertales im Jahr 1847, in: Annuaire de la
339