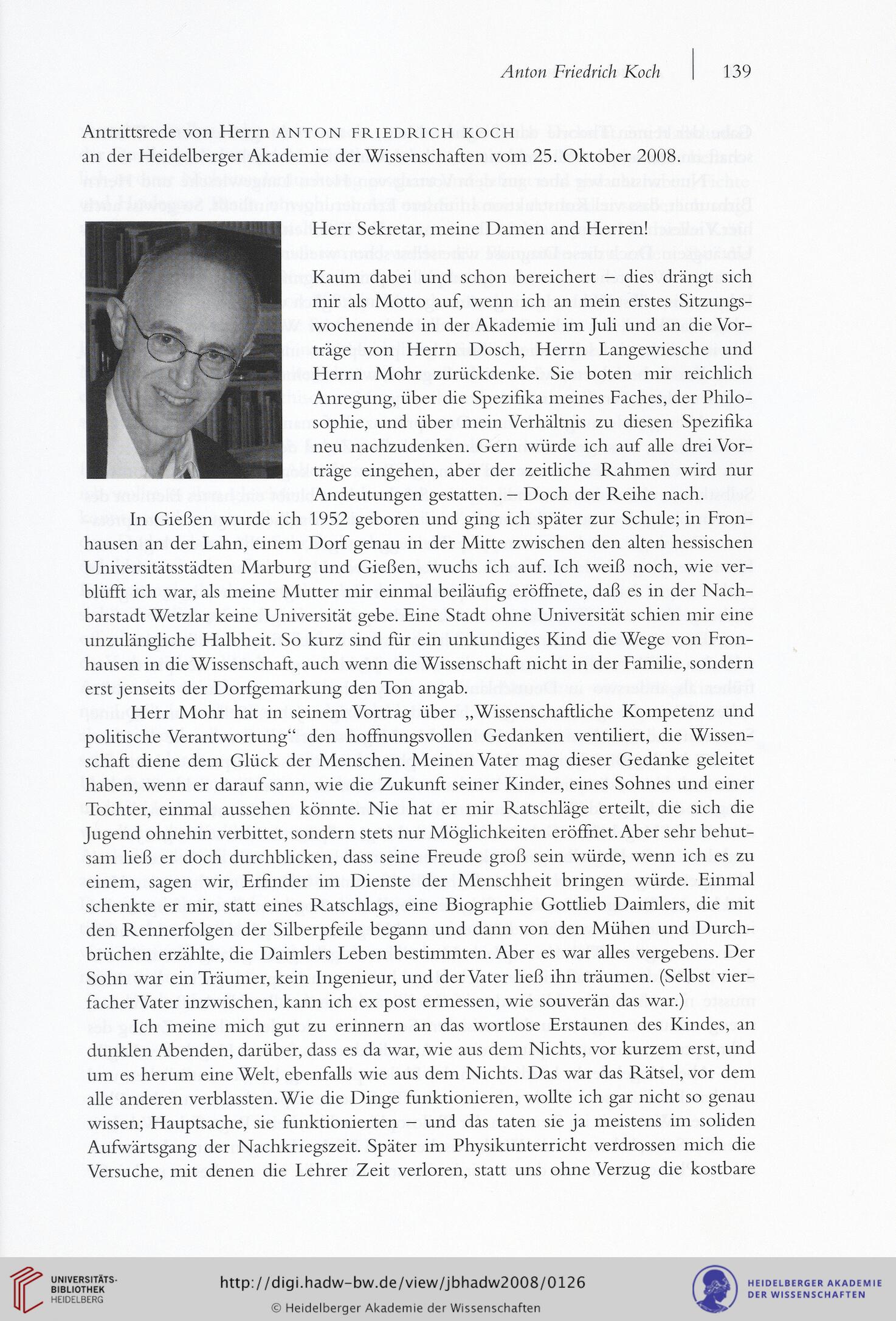Anton Friedrich Koch
139
Antrittsrede von Herrn ANTON FRIEDRICH KOCH
an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften vom 25. Oktober 2008.
Herr Sekretär, meine Damen and Herren!
Kaum dabei und schon bereichert — dies drängt sich
mir als Motto auf, wenn ich an mein erstes Sitzungs-
wochenende in der Akademie im Juli und an die Vor-
träge von Herrn Dosch, Herrn Langewiesche und
Herrn Mohr zurückdenke. Sie boten mir reichlich
Anregung, über die Spezifika meines Faches, der Philo-
sophie, und über mein Verhältnis zu diesen Spezifika
neu nachzudenken. Gern würde ich auf alle drei Vor-
träge eingehen, aber der zeitliche Rahmen wird nur
Andeutungen gestatten. - Doch der Reihe nach.
In Gießen wurde ich 1952 geboren und ging ich später zur Schule; in Fron-
hausen an der Lahn, einem Dorf genau in der Mitte zwischen den alten hessischen
Universitätsstädten Marburg und Gießen, wuchs ich auf. Ich weiß noch, wie ver-
blüfft ich war, als meine Mutter mir einmal beiläufig eröffnete, daß es in der Nach-
barstadt Wetzlar keine Universität gebe. Eine Stadt ohne Universität schien mir eine
unzulängliche Halbheit. So kurz sind für ein unkundiges Kind die Wege von Fron-
hausen in die Wissenschaft, auch wenn die Wissenschaft nicht in der Familie, sondern
erst jenseits der Dorfgemarkung den Ton angab.
Herr Mohr hat in seinem Vortrag über „Wissenschaftliche Kompetenz und
politische Verantwortung“ den hoffnungsvollen Gedanken ventiliert, die Wissen-
schaft diene dem Glück der Menschen. Meinen Vater mag dieser Gedanke geleitet
haben, wenn er darauf sann, wie die Zukunft seiner Kinder, eines Sohnes und einer
Tochter, einmal aussehen könnte. Nie hat er mir Ratschläge erteilt, die sich die
Jugend ohnehin verbittet, sondern stets nur Möglichkeiten eröffnet. Aber sehr behut-
sam ließ er doch durchblicken, dass seine Freude groß sein würde, wenn ich es zu
einem, sagen wir, Erfinder im Dienste der Menschheit bringen würde. Einmal
schenkte er mir, statt eines Ratschlags, eine Biographie Gottlieb Daimlers, die mit
den Rennerfolgen der Silberpfeile begann und dann von den Mühen und Durch-
brüchen erzählte, die Daimlers Leben bestimmten. Aber es war alles vergebens. Der
Sohn war ein Träumer, kein Ingenieur, und der Vater ließ ihn träumen. (Selbst vier-
facher Vater inzwischen, kann ich ex post ermessen, wie souverän das war.)
Ich meine mich gut zu erinnern an das wortlose Erstaunen des Kindes, an
dunklen Abenden, darüber, dass es da war, wie aus dem Nichts, vor kurzem erst, und
um es herum eine Welt, ebenfalls wie aus dem Nichts. Das war das Rätsel, vor dem
alle anderen verblassten. Wie die Dinge funktionieren, wollte ich gar nicht so genau
wissen; Hauptsache, sie funktionierten — und das taten sie ja meistens im soliden
Aufwärtsgang der Nachkriegszeit. Später im Physikunterricht verdrossen mich die
Versuche, mit denen die Lehrer Zeit verloren, statt uns ohne Verzug die kostbare
139
Antrittsrede von Herrn ANTON FRIEDRICH KOCH
an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften vom 25. Oktober 2008.
Herr Sekretär, meine Damen and Herren!
Kaum dabei und schon bereichert — dies drängt sich
mir als Motto auf, wenn ich an mein erstes Sitzungs-
wochenende in der Akademie im Juli und an die Vor-
träge von Herrn Dosch, Herrn Langewiesche und
Herrn Mohr zurückdenke. Sie boten mir reichlich
Anregung, über die Spezifika meines Faches, der Philo-
sophie, und über mein Verhältnis zu diesen Spezifika
neu nachzudenken. Gern würde ich auf alle drei Vor-
träge eingehen, aber der zeitliche Rahmen wird nur
Andeutungen gestatten. - Doch der Reihe nach.
In Gießen wurde ich 1952 geboren und ging ich später zur Schule; in Fron-
hausen an der Lahn, einem Dorf genau in der Mitte zwischen den alten hessischen
Universitätsstädten Marburg und Gießen, wuchs ich auf. Ich weiß noch, wie ver-
blüfft ich war, als meine Mutter mir einmal beiläufig eröffnete, daß es in der Nach-
barstadt Wetzlar keine Universität gebe. Eine Stadt ohne Universität schien mir eine
unzulängliche Halbheit. So kurz sind für ein unkundiges Kind die Wege von Fron-
hausen in die Wissenschaft, auch wenn die Wissenschaft nicht in der Familie, sondern
erst jenseits der Dorfgemarkung den Ton angab.
Herr Mohr hat in seinem Vortrag über „Wissenschaftliche Kompetenz und
politische Verantwortung“ den hoffnungsvollen Gedanken ventiliert, die Wissen-
schaft diene dem Glück der Menschen. Meinen Vater mag dieser Gedanke geleitet
haben, wenn er darauf sann, wie die Zukunft seiner Kinder, eines Sohnes und einer
Tochter, einmal aussehen könnte. Nie hat er mir Ratschläge erteilt, die sich die
Jugend ohnehin verbittet, sondern stets nur Möglichkeiten eröffnet. Aber sehr behut-
sam ließ er doch durchblicken, dass seine Freude groß sein würde, wenn ich es zu
einem, sagen wir, Erfinder im Dienste der Menschheit bringen würde. Einmal
schenkte er mir, statt eines Ratschlags, eine Biographie Gottlieb Daimlers, die mit
den Rennerfolgen der Silberpfeile begann und dann von den Mühen und Durch-
brüchen erzählte, die Daimlers Leben bestimmten. Aber es war alles vergebens. Der
Sohn war ein Träumer, kein Ingenieur, und der Vater ließ ihn träumen. (Selbst vier-
facher Vater inzwischen, kann ich ex post ermessen, wie souverän das war.)
Ich meine mich gut zu erinnern an das wortlose Erstaunen des Kindes, an
dunklen Abenden, darüber, dass es da war, wie aus dem Nichts, vor kurzem erst, und
um es herum eine Welt, ebenfalls wie aus dem Nichts. Das war das Rätsel, vor dem
alle anderen verblassten. Wie die Dinge funktionieren, wollte ich gar nicht so genau
wissen; Hauptsache, sie funktionierten — und das taten sie ja meistens im soliden
Aufwärtsgang der Nachkriegszeit. Später im Physikunterricht verdrossen mich die
Versuche, mit denen die Lehrer Zeit verloren, statt uns ohne Verzug die kostbare