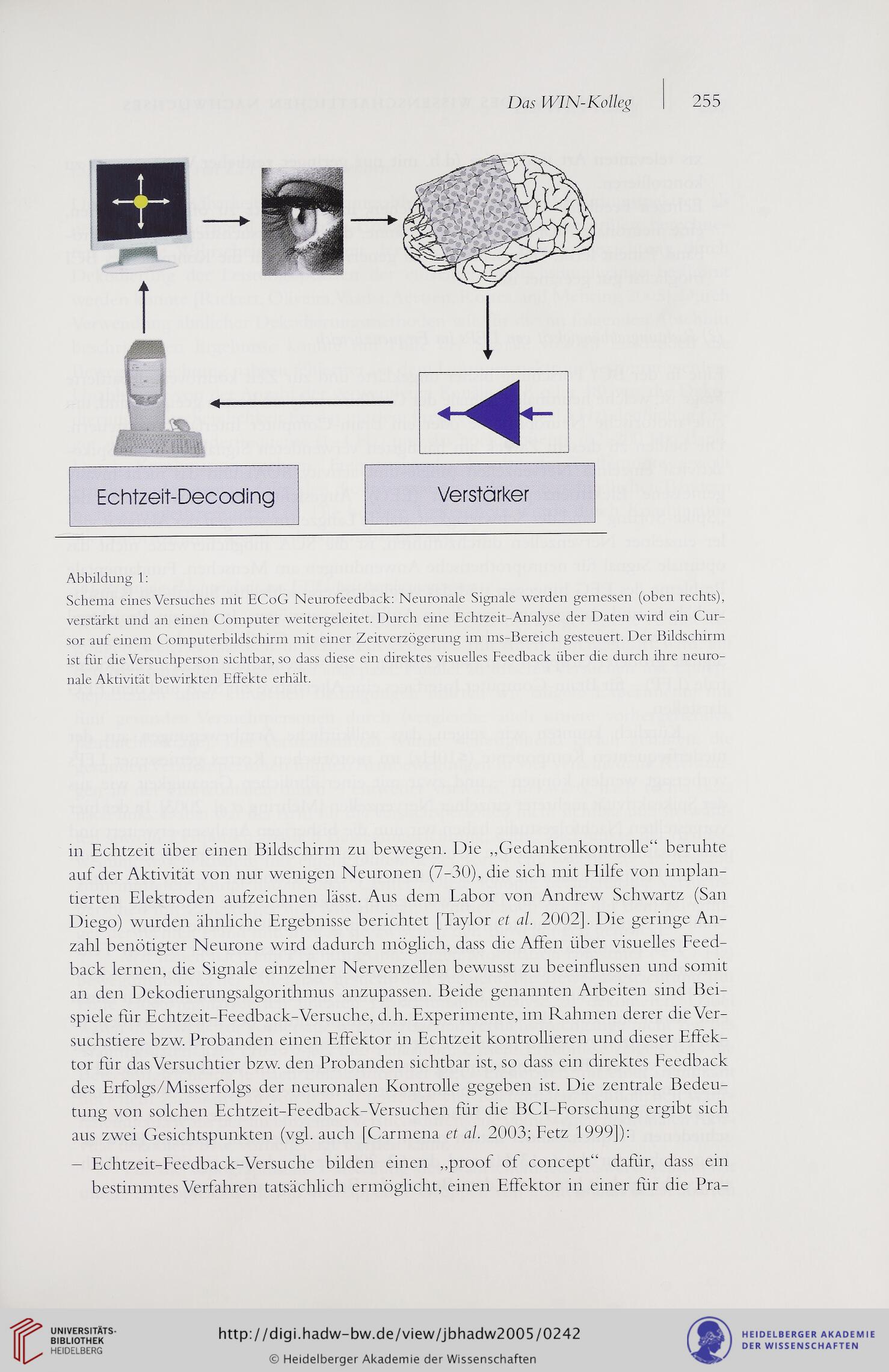Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Editor]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2005
— 2006
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.67593#0242
DOI chapter:
III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Das WIN-Kolleg
DOI chapter:1. Forschungsschwerpunkt "Gehirn und Geist: Physische und psychische Funktionen des Gehirns"
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.67593#0242
- Einband
- Schmutztitel
- Titelblatt
- 5-9 Inhaltsübersicht
- 10-11 Vorstand und Verwaltung der Akademie
- 12-29 Die Mitglieder der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
-
30-163
I. Das Geschäftsjahr 2005
- 30-48 Jahresfeier am 21. Mai 2005
- 49-53 Darstellung der Arbeiten der Preisträger
-
54-107
Wissenschaftliche Sitzungen
- 54-60 Öffentliche Gesamtsitzung in Ulm am 15. Januar 2005
- 60-61 Sitzung der Math.-nat. Klasse am 5. Februar 2005
-
61-64
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 18. Februar 2005
-
64-67
Gesamtsitzung am 19. Februar 2005
-
67-71
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 16. April 2005
-
71-73
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 29. April 2005
-
73-75
Gesamtsitzung am 30. April 2005
-
75-77
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 11. Juni 2005
-
77-79
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 2. Juli 2005
- 79-84 Gesamtsitzung am 16. Juli 2005
- 84-98 Öffentliche Gesamtsitzung in Freiburg am 22. Oktober 2005
-
98-100
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 12. November 2005
-
100-104
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 26. November 2005
-
104-107
Gesamtsitzung am 10. Dezember 2005
-
108-113
Öffentliche Veranstaltungen
- 108-109 Mitarbeitervortragsreihe "Wir forschen für Sie"
- 110 Symposium "Nicolai de Cusa Opera Omnia - Abschluß der Heidelberger Akademieausgabe"
- 110 Vortrag: "Warum braucht Europa ein Tsunami-Frühwarnsystem?"
- 111 Streitgespräch: "Wettbewerb - ein Prinzip auf dem Prüfstand"
- 111-112 Podiumsdiskussion "Wohin treibt Europa?"
- 112 Tag des offenen Denkmals
- 113 Vortrag: "Der Augsburger Religionsfriede von 1555"
- 113 Tagung "Das Charisma - Funktionen und symbolische Repräsentationen"
-
114-139
Antrittsreden
-
140-163
Nachrufe
-
164-234
II. Die Forschungsvorhaben
- 164-166 Verzeichnis der Forschungsvorhaben und der Arbeitsstellenleiter
- 167-168 Patristische Kommission
-
169-234
Berichte über die Tätigkeit der Forschungsvorhaben
-
169-231
Die Forschungsvorhaben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 169-170 1. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)
- 170-176 2. Archäometrie
- 176-184 3. Radiometrische Altersbestimmung von Wasser und Sedimenten
- 184-191 4. Weltkarte der tektonischen Spannungen (Karlsruhe)
- 191-192 5. Mathematische Kommission. Zentralblatt MATH
- 193-194 6. Deutsche Inschriften
- 194-195 7. Deutsches Rechtswörterbuch
- 195-196 8. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch/DEAF
- 197-198 9. Altokzitanisches und Altgaskognisches Wörterbuch/DAO/DAG
- 198-199 10. Spanisches Wörterbuch des Mittelalters/DEM
- 199-200 11. Melanchthon-Forschungsstelle
- 200-203 12. Martin Bucers Deutsche Schriften
- 203-206 13. Reuchlin-Briefwechsel (Pforzheim)
- 206-207 14. Luther-Register (Tübingen)
- 207-208 15. Evangelische Kirchenordnung des 16. Jahrhunderts
- 209-211 16. Europa Humanistica
- 211-214 17. Epigraphische Datenbank
- 215-216 18. Edition literarischer Keilschriftentexte aus Assur
- 216-218 19. Buddhistische Steinschriften aus China
- 219-220 20. Année Philologique
- 220-221 21. Lexikon der antiken Kulte und Riten (Heidelberg/Würzburg)
- 222-229 22. Felsbilder und Inschriften am Katakorum-Highway
- 229-231 23. Geschichte der Mannheimer Hofkapelle im 18. Jahrhundert
- 232-234 Der Akademie zugeordnete Forschungsvorhaben
-
169-231
Die Forschungsvorhaben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 235-279 III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Das WIN-Kolleg
- 280-290 IV. Gesamthaushalt 2005 der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- Einband
- Farbkeil/ Maßstab
Das WIN-Kolleg | 255
Abbildung 1:
Schema eines Versuches mit ECoG Neurofeedback: Neuronale Signale werden gemessen (oben rechts),
verstärkt und an einen Computer weitergeleitet. Durch eine Echtzeit-Analyse der Daten wird ein Cur-
sor auf einem Computerbildschirm mit einer Zeitverzögerung im ms-Bereich gesteuert. Der Bildschirm
ist für die Versuchperson sichtbar, so dass diese ein direktes visuelles Feedback über die durch ihre neuro-
nale Aktivität bewirkten Effekte erhält.
in Echtzeit über einen Bildschirm zu bewegen. Die „Gedankenkontrolle“ beruhte
auf der Aktivität von nur wenigen Neuronen (7-30), die sich mit Hilfe von implan-
tierten Elektroden aufzeichnen lässt. Aus dem Labor von Andrew Schwartz (San
Diego) wurden ähnliche Ergebnisse berichtet [Taylor et al. 2002], Die geringe An-
zahl benötigter Neurone wird dadurch möglich, dass die Affen über visuelles Feed-
back lernen, die Signale einzelner Nervenzellen bewusst zu beeinflussen und somit
an den Dekodierungsalgorithmus anzupassen. Beide genannten Arbeiten sind Bei-
spiele für Echtzeit-Feedback-Versuche, d.h. Experimente, im Rahmen derer die Ver-
suchstiere bzw. Probanden einen Effektor in Echtzeit kontrollieren und dieser Effek-
tor für das Versuchtier bzw. den Probanden sichtbar ist, so dass ein direktes Feedback
des Erfolgs/Misserfolgs der neuronalen Kontrolle gegeben ist. Die zentrale Bedeu-
tung von solchen Echtzeit-Feedback-Versuchen für die BCI-Forschung ergibt sich
aus zwei Gesichtspunkten (vgl. auch [Carmena et al. 2003; Fetz 1999]):
— Echtzeit-Feedback-Versuche bilden einen „proof of concept“ dafür, dass ein
bestimmtes Verfahren tatsächlich ermöglicht, einen Effektor in einer für die Pra-
Abbildung 1:
Schema eines Versuches mit ECoG Neurofeedback: Neuronale Signale werden gemessen (oben rechts),
verstärkt und an einen Computer weitergeleitet. Durch eine Echtzeit-Analyse der Daten wird ein Cur-
sor auf einem Computerbildschirm mit einer Zeitverzögerung im ms-Bereich gesteuert. Der Bildschirm
ist für die Versuchperson sichtbar, so dass diese ein direktes visuelles Feedback über die durch ihre neuro-
nale Aktivität bewirkten Effekte erhält.
in Echtzeit über einen Bildschirm zu bewegen. Die „Gedankenkontrolle“ beruhte
auf der Aktivität von nur wenigen Neuronen (7-30), die sich mit Hilfe von implan-
tierten Elektroden aufzeichnen lässt. Aus dem Labor von Andrew Schwartz (San
Diego) wurden ähnliche Ergebnisse berichtet [Taylor et al. 2002], Die geringe An-
zahl benötigter Neurone wird dadurch möglich, dass die Affen über visuelles Feed-
back lernen, die Signale einzelner Nervenzellen bewusst zu beeinflussen und somit
an den Dekodierungsalgorithmus anzupassen. Beide genannten Arbeiten sind Bei-
spiele für Echtzeit-Feedback-Versuche, d.h. Experimente, im Rahmen derer die Ver-
suchstiere bzw. Probanden einen Effektor in Echtzeit kontrollieren und dieser Effek-
tor für das Versuchtier bzw. den Probanden sichtbar ist, so dass ein direktes Feedback
des Erfolgs/Misserfolgs der neuronalen Kontrolle gegeben ist. Die zentrale Bedeu-
tung von solchen Echtzeit-Feedback-Versuchen für die BCI-Forschung ergibt sich
aus zwei Gesichtspunkten (vgl. auch [Carmena et al. 2003; Fetz 1999]):
— Echtzeit-Feedback-Versuche bilden einen „proof of concept“ dafür, dass ein
bestimmtes Verfahren tatsächlich ermöglicht, einen Effektor in einer für die Pra-