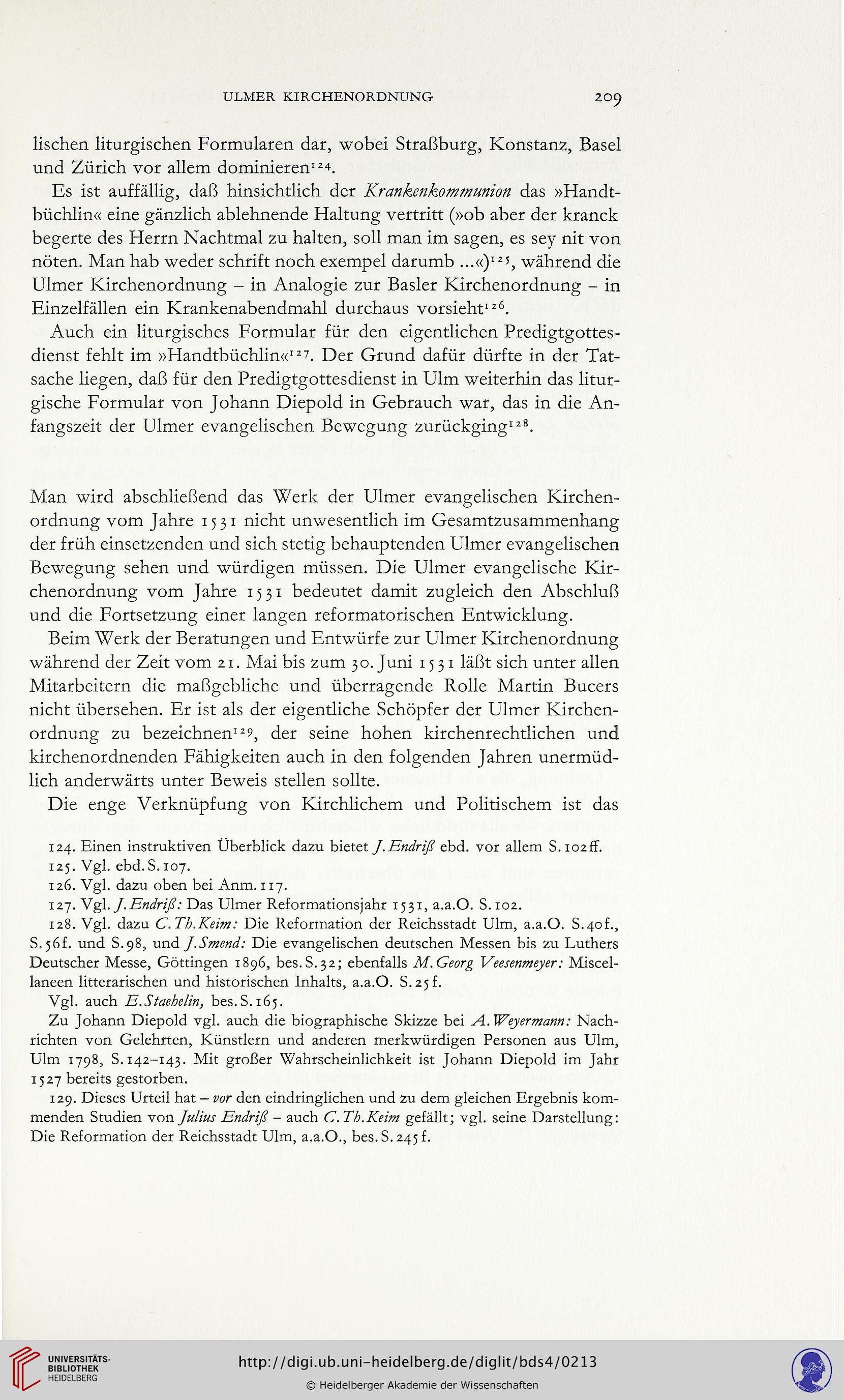ULMER KIRCHENORDNUNG
209
lischen liturgischen Formularen dar, wobei Straßburg, Konstanz, Basel
und Zürich vor allem dominieren124.
Es ist auffällig, daß hinsichtlich der Krankenkommunion das »Handt-
büchlin« eine gänzlich ablehnende Haltung vertritt (»ob aber der kranck
begerte des Herrn Nachtmal zu halten, soll man im sagen, es sey nit von
nöten. Man hab weder schrift noch exempel darumb ...«)125, während die
Ulmer Kirchenordnung - in Analogie zur Basler Kirchenordnung - in
Einzelfällen ein Krankenabendmahl durchaus vorsieht126.
Auch ein liturgisches Formular für den eigentlichen Predigtgottes-
dienst fehlt im »Handtbüchlin«127. Der Grund dafür dürfte in der Tat-
sache liegen, daß für den Predigtgottesdienst in Ulm weiterhin das litur-
gische Formular von Johann Diepold in Gebrauch war, das in die An-
fangszeit der Ulmer evangelischen Bewegung zurückging128.
Man wird abschließend das Werk der Ulmer evangelischen Kirchen-
ordnung vom Jahre 1531 nicht unwesentlich im Gesamtzusammenhang
der früh einsetzenden und sich stetig behauptenden Ulmer evangelischen
Bewegung sehen und würdigen müssen. Die Ulmer evangelische Kir-
chenordnung vom Jahre 1531 bedeutet damit zugleich den Abschluß
und die Fortsetzung einer langen reformatorischen Entwicklung.
Beim Werk der Beratungen und Entwürfe zur Ulmer Kirchenordnung
während der Zeit vom 21. Mai bis zum 30. Juni 1531 läßt sich unter allen
Mitarbeitern die maßgebliche und überragende Rolle Martin Bucers
nicht übersehen. Er ist als der eigentliche Schöpfer der Ulmer Kirchen-
ordnung zu bezeichnen129, der seine hohen kirchenrechtlichen und
kirchenordnenden Fähigkeiten auch in den folgenden Jahren unermüd-
lich anderwärts unter Beweis stellen sollte.
Die enge Verknüpfung von Kirchlichem und Politischem ist das
124. Einen instruktiven Überblick dazu bietet J.Endriß ebd. vor allem S.102ff.
125. Vgl. ebd. S. 107.
126. Vgl. dazu oben bei Anm. 117.
127. Vgl. J.Endriß: Das Ulmer Reformationsjahr 1531, a.a.O. S.102.
128. Vgl. dazu C. Th.Keim: Die Reformation der Reichsstadt Ulm, a.a.O. S. 40f.,
S. 56f. und S.98, und J.Smend: Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers
Deutscher Messe, Göttingen 1896, bes.S.32; ebenfalls M. Georg Veesenmeyer: Miscel-
laneen litterarischen und historischen Inhalts, a.a.O. S.25f.
Vgl. auch E.Staehelin, bes.S.165.
Zu Johann Diepold vgl. auch die biographische Skizze bei A. Weyermann: Nach-
richten von Gelehrten, Künstlern und anderen merkwürdigen Personen aus Ulm,
Ulm 1798, S. 142-143. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist Johann Diepold im Jahr
1527 bereits gestorben.
129. Dieses Urteil hat - vor den eindringlichen und zu dem gleichen Ergebnis kom-
menden Studien von Julius Endriß - auch C. Th.Keim gefällt; vgl. seine Darstellung:
Die Reformation der Reichsstadt Ulm, a.a.O., bes. S. 245 f.
209
lischen liturgischen Formularen dar, wobei Straßburg, Konstanz, Basel
und Zürich vor allem dominieren124.
Es ist auffällig, daß hinsichtlich der Krankenkommunion das »Handt-
büchlin« eine gänzlich ablehnende Haltung vertritt (»ob aber der kranck
begerte des Herrn Nachtmal zu halten, soll man im sagen, es sey nit von
nöten. Man hab weder schrift noch exempel darumb ...«)125, während die
Ulmer Kirchenordnung - in Analogie zur Basler Kirchenordnung - in
Einzelfällen ein Krankenabendmahl durchaus vorsieht126.
Auch ein liturgisches Formular für den eigentlichen Predigtgottes-
dienst fehlt im »Handtbüchlin«127. Der Grund dafür dürfte in der Tat-
sache liegen, daß für den Predigtgottesdienst in Ulm weiterhin das litur-
gische Formular von Johann Diepold in Gebrauch war, das in die An-
fangszeit der Ulmer evangelischen Bewegung zurückging128.
Man wird abschließend das Werk der Ulmer evangelischen Kirchen-
ordnung vom Jahre 1531 nicht unwesentlich im Gesamtzusammenhang
der früh einsetzenden und sich stetig behauptenden Ulmer evangelischen
Bewegung sehen und würdigen müssen. Die Ulmer evangelische Kir-
chenordnung vom Jahre 1531 bedeutet damit zugleich den Abschluß
und die Fortsetzung einer langen reformatorischen Entwicklung.
Beim Werk der Beratungen und Entwürfe zur Ulmer Kirchenordnung
während der Zeit vom 21. Mai bis zum 30. Juni 1531 läßt sich unter allen
Mitarbeitern die maßgebliche und überragende Rolle Martin Bucers
nicht übersehen. Er ist als der eigentliche Schöpfer der Ulmer Kirchen-
ordnung zu bezeichnen129, der seine hohen kirchenrechtlichen und
kirchenordnenden Fähigkeiten auch in den folgenden Jahren unermüd-
lich anderwärts unter Beweis stellen sollte.
Die enge Verknüpfung von Kirchlichem und Politischem ist das
124. Einen instruktiven Überblick dazu bietet J.Endriß ebd. vor allem S.102ff.
125. Vgl. ebd. S. 107.
126. Vgl. dazu oben bei Anm. 117.
127. Vgl. J.Endriß: Das Ulmer Reformationsjahr 1531, a.a.O. S.102.
128. Vgl. dazu C. Th.Keim: Die Reformation der Reichsstadt Ulm, a.a.O. S. 40f.,
S. 56f. und S.98, und J.Smend: Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers
Deutscher Messe, Göttingen 1896, bes.S.32; ebenfalls M. Georg Veesenmeyer: Miscel-
laneen litterarischen und historischen Inhalts, a.a.O. S.25f.
Vgl. auch E.Staehelin, bes.S.165.
Zu Johann Diepold vgl. auch die biographische Skizze bei A. Weyermann: Nach-
richten von Gelehrten, Künstlern und anderen merkwürdigen Personen aus Ulm,
Ulm 1798, S. 142-143. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist Johann Diepold im Jahr
1527 bereits gestorben.
129. Dieses Urteil hat - vor den eindringlichen und zu dem gleichen Ergebnis kom-
menden Studien von Julius Endriß - auch C. Th.Keim gefällt; vgl. seine Darstellung:
Die Reformation der Reichsstadt Ulm, a.a.O., bes. S. 245 f.