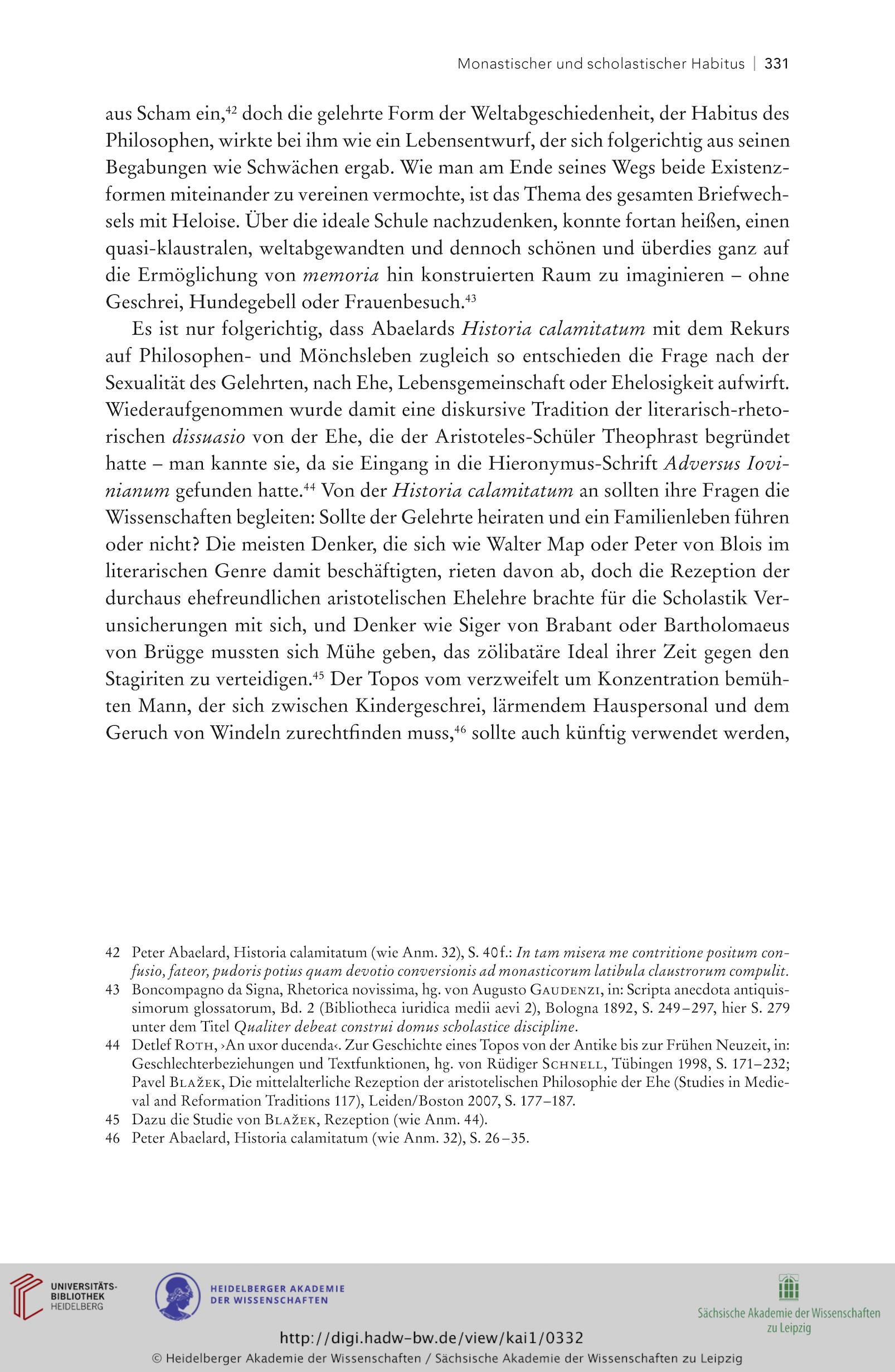Monastischer und scholastischer Habitus | 331
aus Scham ein, ⁴² doch die gelehrte Form der Weltabgeschiedenheit, der Habitus des
Philosophen, wirkte bei ihm wie ein Lebensentwurf, der sich folgerichtig aus seinen
Begabungen wie Schwächen ergab. Wie man am Ende seines Wegs beide Existenzformen
miteinander zu vereinen vermochte, ist das Thema des gesamten Briefwechsels
mit Heloise. Über die ideale Schule nachzudenken, konnte fortan heißen, einen
quasi-klaustralen, weltabgewandten und dennoch schönen und überdies ganz auf
die Ermöglichung von memoria hin konstruierten Raum zu imaginieren – ohne
Geschrei, Hundegebell oder Frauenbesuch. ⁴³
Es ist nur folgerichtig, dass Abaelards Historia calamitatum mit dem Rekurs
auf Philosophen- und Mönchsleben zugleich so entschieden die Frage nach der
Sexualität des Gelehrten, nach Ehe, Lebensgemeinschaft oder Ehelosigkeit aufwirft.
Wiederaufgenommen wurde damit eine diskursive Tradition der literarisch-rhetorischen
dissuasio von der Ehe, die der Aristoteles-Schüler Theophrast begründet
hatte – man kannte sie, da sie Eingang in die Hieronymus-Schrift Adversus Iovinianum
gefunden hatte. ⁴⁴ Von der Historia calamitatum an sollten ihre Fragen die
Wissenschaften begleiten: Sollte der Gelehrte heiraten und ein Familienleben führen
oder nicht? Die meisten Denker, die sich wie Walter Map oder Peter von Blois im
literarischen Genre damit beschäftigten, rieten davon ab, doch die Rezeption der
durchaus ehefreundlichen aristotelischen Ehelehre brachte für die Scholastik Verunsicherungen
mit sich, und Denker wie Siger von Brabant oder Bartholo maeus
von Brügge mussten sich Mühe geben, das zölibatäre Ideal ihrer Zeit gegen den
Stagiriten zu verteidigen. ⁴⁵ Der Topos vom verzweifelt um Konzentration bemühten
Mann, der sich zwischen Kindergeschrei, lärmendem Hauspersonal und dem
Geruch von Windeln zurechtfinden muss, ⁴⁶ sollte auch künftig verwendet werden,
42 Peter Abaelard, Historia calamitatum (wie Anm. 32), S. 40 f.: In tam misera me contritione positum confusio,
fateor, pudoris potius quam devotio conversionis ad monasticorum latibula claustrorum compulit.
43 Boncompagno da Signa, Rhetorica novissima, hg. von Augusto Gaudenzi, in: Scripta anecdota antiquissimorum
glossatorum, Bd. 2 (Bibliotheca iuridica medii aevi 2), Bologna 1892, S. 249 –297, hier S. 279
unter dem Titel Qualiter debeat construi domus scholastice discipline.
44 Detlef Roth, ›An uxor ducenda‹. Zur Geschichte eines Topos von der Antike bis zur Frühen Neuzeit, in:
Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen, hg. von Rüdiger Schnell, Tübingen 1998, S. 171–232;
Pavel Blažek, Die mittelalterliche Rezeption der aristotelischen Philosophie der Ehe (Studies in Medieval
and Reformation Traditions 117), Leiden/Boston 2007, S. 177–187.
45 Dazu die Studie von Blažek, Rezeption (wie Anm. 44).
46 Peter Abaelard, Historia calamitatum (wie Anm. 32), S. 26 –35.
aus Scham ein, ⁴² doch die gelehrte Form der Weltabgeschiedenheit, der Habitus des
Philosophen, wirkte bei ihm wie ein Lebensentwurf, der sich folgerichtig aus seinen
Begabungen wie Schwächen ergab. Wie man am Ende seines Wegs beide Existenzformen
miteinander zu vereinen vermochte, ist das Thema des gesamten Briefwechsels
mit Heloise. Über die ideale Schule nachzudenken, konnte fortan heißen, einen
quasi-klaustralen, weltabgewandten und dennoch schönen und überdies ganz auf
die Ermöglichung von memoria hin konstruierten Raum zu imaginieren – ohne
Geschrei, Hundegebell oder Frauenbesuch. ⁴³
Es ist nur folgerichtig, dass Abaelards Historia calamitatum mit dem Rekurs
auf Philosophen- und Mönchsleben zugleich so entschieden die Frage nach der
Sexualität des Gelehrten, nach Ehe, Lebensgemeinschaft oder Ehelosigkeit aufwirft.
Wiederaufgenommen wurde damit eine diskursive Tradition der literarisch-rhetorischen
dissuasio von der Ehe, die der Aristoteles-Schüler Theophrast begründet
hatte – man kannte sie, da sie Eingang in die Hieronymus-Schrift Adversus Iovinianum
gefunden hatte. ⁴⁴ Von der Historia calamitatum an sollten ihre Fragen die
Wissenschaften begleiten: Sollte der Gelehrte heiraten und ein Familienleben führen
oder nicht? Die meisten Denker, die sich wie Walter Map oder Peter von Blois im
literarischen Genre damit beschäftigten, rieten davon ab, doch die Rezeption der
durchaus ehefreundlichen aristotelischen Ehelehre brachte für die Scholastik Verunsicherungen
mit sich, und Denker wie Siger von Brabant oder Bartholo maeus
von Brügge mussten sich Mühe geben, das zölibatäre Ideal ihrer Zeit gegen den
Stagiriten zu verteidigen. ⁴⁵ Der Topos vom verzweifelt um Konzentration bemühten
Mann, der sich zwischen Kindergeschrei, lärmendem Hauspersonal und dem
Geruch von Windeln zurechtfinden muss, ⁴⁶ sollte auch künftig verwendet werden,
42 Peter Abaelard, Historia calamitatum (wie Anm. 32), S. 40 f.: In tam misera me contritione positum confusio,
fateor, pudoris potius quam devotio conversionis ad monasticorum latibula claustrorum compulit.
43 Boncompagno da Signa, Rhetorica novissima, hg. von Augusto Gaudenzi, in: Scripta anecdota antiquissimorum
glossatorum, Bd. 2 (Bibliotheca iuridica medii aevi 2), Bologna 1892, S. 249 –297, hier S. 279
unter dem Titel Qualiter debeat construi domus scholastice discipline.
44 Detlef Roth, ›An uxor ducenda‹. Zur Geschichte eines Topos von der Antike bis zur Frühen Neuzeit, in:
Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen, hg. von Rüdiger Schnell, Tübingen 1998, S. 171–232;
Pavel Blažek, Die mittelalterliche Rezeption der aristotelischen Philosophie der Ehe (Studies in Medieval
and Reformation Traditions 117), Leiden/Boston 2007, S. 177–187.
45 Dazu die Studie von Blažek, Rezeption (wie Anm. 44).
46 Peter Abaelard, Historia calamitatum (wie Anm. 32), S. 26 –35.