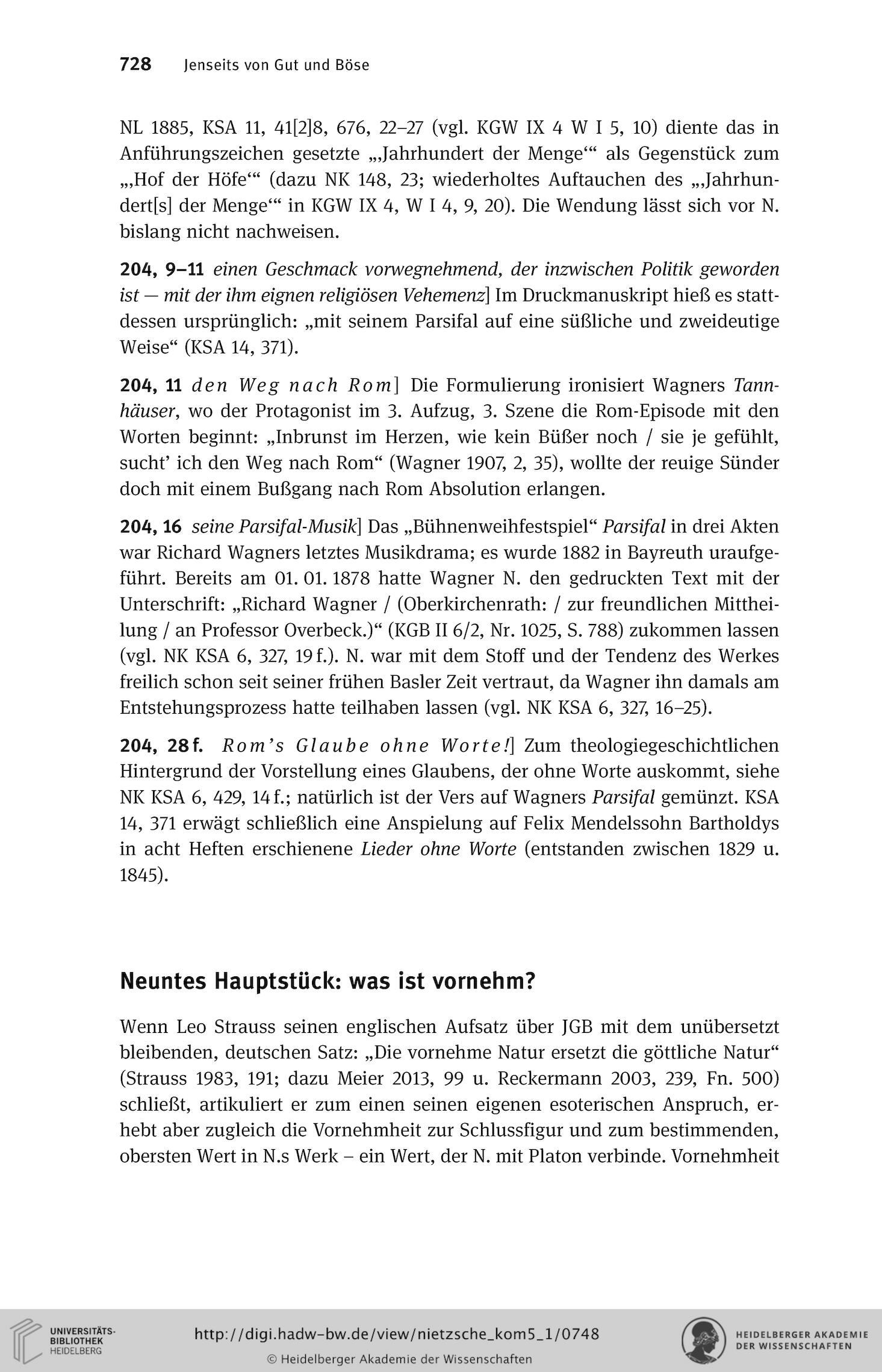728 Jenseits von Gut und Böse
NL 1885, KSA 11, 41[2]8, 676, 22-27 (vgl. KGW IX 4 W I 5, 10) diente das in
Anführungszeichen gesetzte „Jahrhundert der Menge“4 als Gegenstück zum
,„Hof der Höfe“4 (dazu NK 148, 23; wiederholtes Auftauchen des „Jahrhun-
dert[s] der Menge“4 in KGW IX 4, W I 4, 9, 20). Die Wendung lässt sich vor N.
bislang nicht nachweisen.
204, 9-11 einen Geschmack vorwegnehmend, der inzwischen Politik geworden
ist — mit der ihm eignen religiösen Vehemenz] Im Druckmanuskript hieß es statt-
dessen ursprünglich: „mit seinem Parsifal auf eine süßliche und zweideutige
Weise44 (KSA 14, 371).
204, 11 den Weg nach Rom] Die Formulierung ironisiert Wagners Tann-
häuser, wo der Protagonist im 3. Aufzug, 3. Szene die Rom-Episode mit den
Worten beginnt: „Inbrunst im Herzen, wie kein Büßer noch / sie je gefühlt,
sucht’ ich den Weg nach Rom44 (Wagner 1907, 2, 35), wollte der reuige Sünder
doch mit einem Bußgang nach Rom Absolution erlangen.
204,16 seine Parsifal-Musik] Das „Bühnenweihfestspiel44 Parsifal in drei Akten
war Richard Wagners letztes Musikdrama; es wurde 1882 in Bayreuth uraufge-
führt. Bereits am 01. 01.1878 hatte Wagner N. den gedruckten Text mit der
Unterschrift: „Richard Wagner / (Oberkirchenrath: / zur freundlichen Mitthei-
lung / an Professor Overbeck.)44 (KGB II 6/2, Nr. 1025, S. 788) zukommen lassen
(vgl. NK KSA 6, 327, 19 f.). N. war mit dem Stoff und der Tendenz des Werkes
freilich schon seit seiner frühen Basler Zeit vertraut, da Wagner ihn damals am
Entstehungsprozess hatte teilhaben lassen (vgl. NK KSA 6, 327, 16-25).
204, 28f. Rom’s Glaube ohne Worte!] Zum theologiegeschichtlichen
Hintergrund der Vorstellung eines Glaubens, der ohne Worte auskommt, siehe
NK KSA 6, 429, 14 f.; natürlich ist der Vers auf Wagners Parsifal gemünzt. KSA
14, 371 erwägt schließlich eine Anspielung auf Felix Mendelssohn Bartholdys
in acht Heften erschienene Lieder ohne Worte (entstanden zwischen 1829 u.
1845).
Neuntes Hauptstück: was ist vornehm?
Wenn Leo Strauss seinen englischen Aufsatz über JGB mit dem unübersetzt
bleibenden, deutschen Satz: „Die vornehme Natur ersetzt die göttliche Natur44
(Strauss 1983, 191; dazu Meier 2013, 99 u. Reckermann 2003, 239, Fn. 500)
schließt, artikuliert er zum einen seinen eigenen esoterischen Anspruch, er-
hebt aber zugleich die Vornehmheit zur Schlussfigur und zum bestimmenden,
obersten Wert in N.s Werk - ein Wert, der N. mit Platon verbinde. Vornehmheit
NL 1885, KSA 11, 41[2]8, 676, 22-27 (vgl. KGW IX 4 W I 5, 10) diente das in
Anführungszeichen gesetzte „Jahrhundert der Menge“4 als Gegenstück zum
,„Hof der Höfe“4 (dazu NK 148, 23; wiederholtes Auftauchen des „Jahrhun-
dert[s] der Menge“4 in KGW IX 4, W I 4, 9, 20). Die Wendung lässt sich vor N.
bislang nicht nachweisen.
204, 9-11 einen Geschmack vorwegnehmend, der inzwischen Politik geworden
ist — mit der ihm eignen religiösen Vehemenz] Im Druckmanuskript hieß es statt-
dessen ursprünglich: „mit seinem Parsifal auf eine süßliche und zweideutige
Weise44 (KSA 14, 371).
204, 11 den Weg nach Rom] Die Formulierung ironisiert Wagners Tann-
häuser, wo der Protagonist im 3. Aufzug, 3. Szene die Rom-Episode mit den
Worten beginnt: „Inbrunst im Herzen, wie kein Büßer noch / sie je gefühlt,
sucht’ ich den Weg nach Rom44 (Wagner 1907, 2, 35), wollte der reuige Sünder
doch mit einem Bußgang nach Rom Absolution erlangen.
204,16 seine Parsifal-Musik] Das „Bühnenweihfestspiel44 Parsifal in drei Akten
war Richard Wagners letztes Musikdrama; es wurde 1882 in Bayreuth uraufge-
führt. Bereits am 01. 01.1878 hatte Wagner N. den gedruckten Text mit der
Unterschrift: „Richard Wagner / (Oberkirchenrath: / zur freundlichen Mitthei-
lung / an Professor Overbeck.)44 (KGB II 6/2, Nr. 1025, S. 788) zukommen lassen
(vgl. NK KSA 6, 327, 19 f.). N. war mit dem Stoff und der Tendenz des Werkes
freilich schon seit seiner frühen Basler Zeit vertraut, da Wagner ihn damals am
Entstehungsprozess hatte teilhaben lassen (vgl. NK KSA 6, 327, 16-25).
204, 28f. Rom’s Glaube ohne Worte!] Zum theologiegeschichtlichen
Hintergrund der Vorstellung eines Glaubens, der ohne Worte auskommt, siehe
NK KSA 6, 429, 14 f.; natürlich ist der Vers auf Wagners Parsifal gemünzt. KSA
14, 371 erwägt schließlich eine Anspielung auf Felix Mendelssohn Bartholdys
in acht Heften erschienene Lieder ohne Worte (entstanden zwischen 1829 u.
1845).
Neuntes Hauptstück: was ist vornehm?
Wenn Leo Strauss seinen englischen Aufsatz über JGB mit dem unübersetzt
bleibenden, deutschen Satz: „Die vornehme Natur ersetzt die göttliche Natur44
(Strauss 1983, 191; dazu Meier 2013, 99 u. Reckermann 2003, 239, Fn. 500)
schließt, artikuliert er zum einen seinen eigenen esoterischen Anspruch, er-
hebt aber zugleich die Vornehmheit zur Schlussfigur und zum bestimmenden,
obersten Wert in N.s Werk - ein Wert, der N. mit Platon verbinde. Vornehmheit