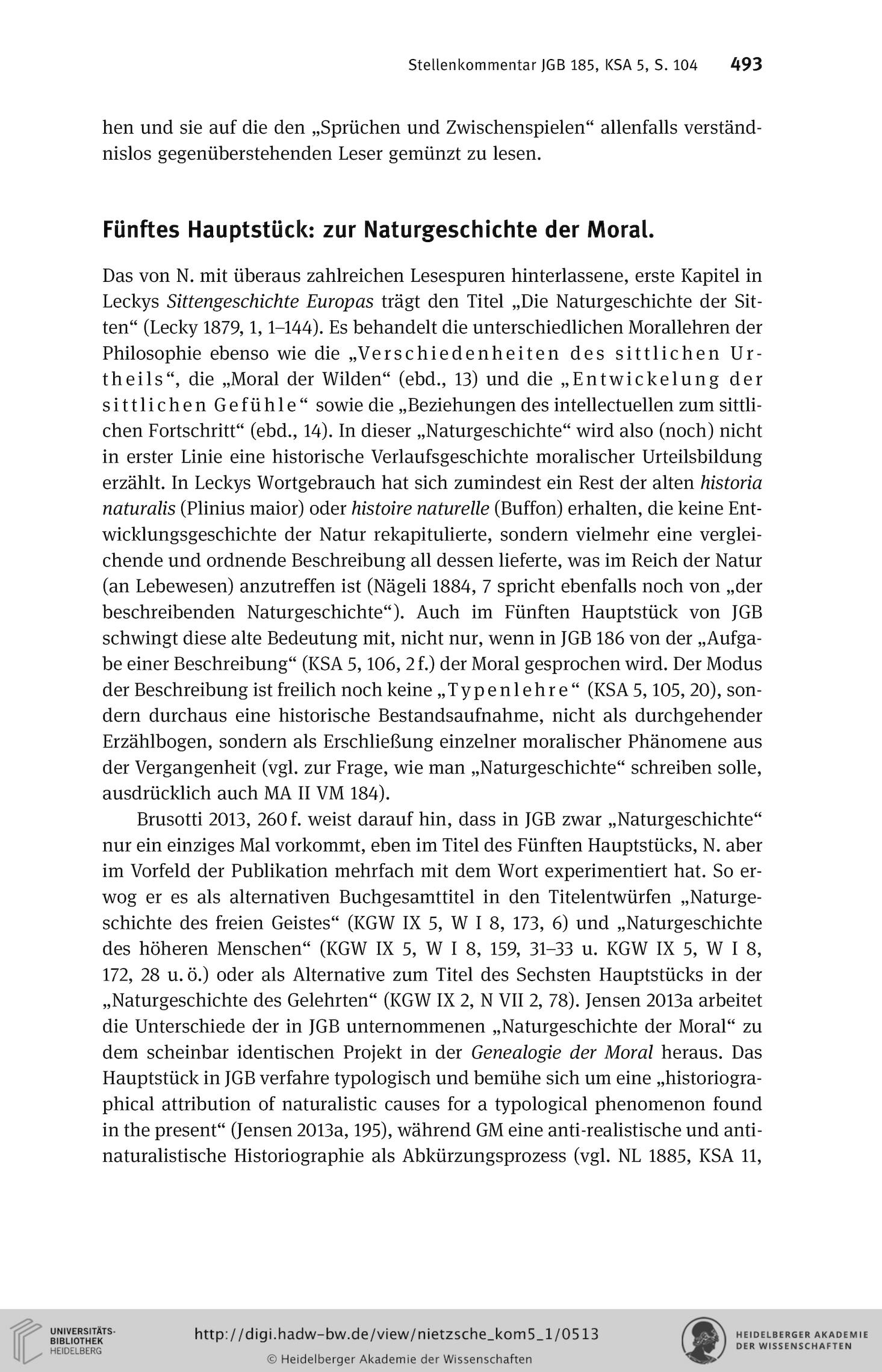Stellenkommentar JGB 185, KSA 5, S. 104 493
hen und sie auf die den „Sprüchen und Zwischenspielen“ allenfalls verständ-
nislos gegenüberstehenden Leser gemünzt zu lesen.
Fünftes Hauptstück: zur Naturgeschichte der Moral.
Das von N. mit überaus zahlreichen Lesespuren hinterlassene, erste Kapitel in
Leckys Sittengeschichte Europas trägt den Titel „Die Naturgeschichte der Sit-
ten“ (Lecky 1879,1,1-144). Es behandelt die unterschiedlichen Morallehren der
Philosophie ebenso wie die „Verschiedenheiten des sittlichen Ur-
theils“, die „Moral der Wilden“ (ebd., 13) und die „Entwickelung der
sittlichen Gefühle“ sowie die „Beziehungen des intellectuellen zum sittli-
chen Fortschritt“ (ebd., 14). In dieser „Naturgeschichte“ wird also (noch) nicht
in erster Linie eine historische Verlaufsgeschichte moralischer Urteilsbildung
erzählt. In Leckys Wortgebrauch hat sich zumindest ein Rest der alten historia
naturalis (Plinius maior) oder histoire naturelle (Buffon) erhalten, die keine Ent-
wicklungsgeschichte der Natur rekapitulierte, sondern vielmehr eine verglei-
chende und ordnende Beschreibung all dessen lieferte, was im Reich der Natur
(an Lebewesen) anzutreffen ist (Nägeli 1884, 7 spricht ebenfalls noch von „der
beschreibenden Naturgeschichte“). Auch im Fünften Hauptstück von JGB
schwingt diese alte Bedeutung mit, nicht nur, wenn in JGB 186 von der „Aufga-
be einer Beschreibung“ (KSA 5,106, 2 f.) der Moral gesprochen wird. Der Modus
der Beschreibung ist freilich noch keine „Typenlehre“ (KSA 5,105, 20), son-
dern durchaus eine historische Bestandsaufnahme, nicht als durchgehender
Erzählbogen, sondern als Erschließung einzelner moralischer Phänomene aus
der Vergangenheit (vgl. zur Frage, wie man „Naturgeschichte“ schreiben solle,
ausdrücklich auch MA II VM 184).
Brusotti 2013, 260 f. weist darauf hin, dass in JGB zwar „Naturgeschichte“
nur ein einziges Mal vorkommt, eben im Titel des Fünften Hauptstücks, N. aber
im Vorfeld der Publikation mehrfach mit dem Wort experimentiert hat. So er-
wog er es als alternativen Buchgesamttitel in den Titelentwürfen „Naturge-
schichte des freien Geistes“ (KGW IX 5, W I 8, 173, 6) und „Naturgeschichte
des höheren Menschen“ (KGW IX 5, W I 8, 159, 31-33 u. KGW IX 5, W I 8,
172, 28 u. ö.) oder als Alternative zum Titel des Sechsten Hauptstücks in der
„Naturgeschichte des Gelehrten“ (KGW IX 2, N VII 2, 78). Jensen 2013a arbeitet
die Unterschiede der in JGB unternommenen „Naturgeschichte der Moral“ zu
dem scheinbar identischen Projekt in der Genealogie der Moral heraus. Das
Hauptstück in JGB verfahre typologisch und bemühe sich um eine „historiogra-
phical attribution of naturalistic causes for a typological phenomenon found
in the present“ (Jensen 2013a, 195), während GM eine anti-realistische und anti-
naturalistische Historiographie als Abkürzungsprozess (vgl. NL 1885, KSA 11,
hen und sie auf die den „Sprüchen und Zwischenspielen“ allenfalls verständ-
nislos gegenüberstehenden Leser gemünzt zu lesen.
Fünftes Hauptstück: zur Naturgeschichte der Moral.
Das von N. mit überaus zahlreichen Lesespuren hinterlassene, erste Kapitel in
Leckys Sittengeschichte Europas trägt den Titel „Die Naturgeschichte der Sit-
ten“ (Lecky 1879,1,1-144). Es behandelt die unterschiedlichen Morallehren der
Philosophie ebenso wie die „Verschiedenheiten des sittlichen Ur-
theils“, die „Moral der Wilden“ (ebd., 13) und die „Entwickelung der
sittlichen Gefühle“ sowie die „Beziehungen des intellectuellen zum sittli-
chen Fortschritt“ (ebd., 14). In dieser „Naturgeschichte“ wird also (noch) nicht
in erster Linie eine historische Verlaufsgeschichte moralischer Urteilsbildung
erzählt. In Leckys Wortgebrauch hat sich zumindest ein Rest der alten historia
naturalis (Plinius maior) oder histoire naturelle (Buffon) erhalten, die keine Ent-
wicklungsgeschichte der Natur rekapitulierte, sondern vielmehr eine verglei-
chende und ordnende Beschreibung all dessen lieferte, was im Reich der Natur
(an Lebewesen) anzutreffen ist (Nägeli 1884, 7 spricht ebenfalls noch von „der
beschreibenden Naturgeschichte“). Auch im Fünften Hauptstück von JGB
schwingt diese alte Bedeutung mit, nicht nur, wenn in JGB 186 von der „Aufga-
be einer Beschreibung“ (KSA 5,106, 2 f.) der Moral gesprochen wird. Der Modus
der Beschreibung ist freilich noch keine „Typenlehre“ (KSA 5,105, 20), son-
dern durchaus eine historische Bestandsaufnahme, nicht als durchgehender
Erzählbogen, sondern als Erschließung einzelner moralischer Phänomene aus
der Vergangenheit (vgl. zur Frage, wie man „Naturgeschichte“ schreiben solle,
ausdrücklich auch MA II VM 184).
Brusotti 2013, 260 f. weist darauf hin, dass in JGB zwar „Naturgeschichte“
nur ein einziges Mal vorkommt, eben im Titel des Fünften Hauptstücks, N. aber
im Vorfeld der Publikation mehrfach mit dem Wort experimentiert hat. So er-
wog er es als alternativen Buchgesamttitel in den Titelentwürfen „Naturge-
schichte des freien Geistes“ (KGW IX 5, W I 8, 173, 6) und „Naturgeschichte
des höheren Menschen“ (KGW IX 5, W I 8, 159, 31-33 u. KGW IX 5, W I 8,
172, 28 u. ö.) oder als Alternative zum Titel des Sechsten Hauptstücks in der
„Naturgeschichte des Gelehrten“ (KGW IX 2, N VII 2, 78). Jensen 2013a arbeitet
die Unterschiede der in JGB unternommenen „Naturgeschichte der Moral“ zu
dem scheinbar identischen Projekt in der Genealogie der Moral heraus. Das
Hauptstück in JGB verfahre typologisch und bemühe sich um eine „historiogra-
phical attribution of naturalistic causes for a typological phenomenon found
in the present“ (Jensen 2013a, 195), während GM eine anti-realistische und anti-
naturalistische Historiographie als Abkürzungsprozess (vgl. NL 1885, KSA 11,