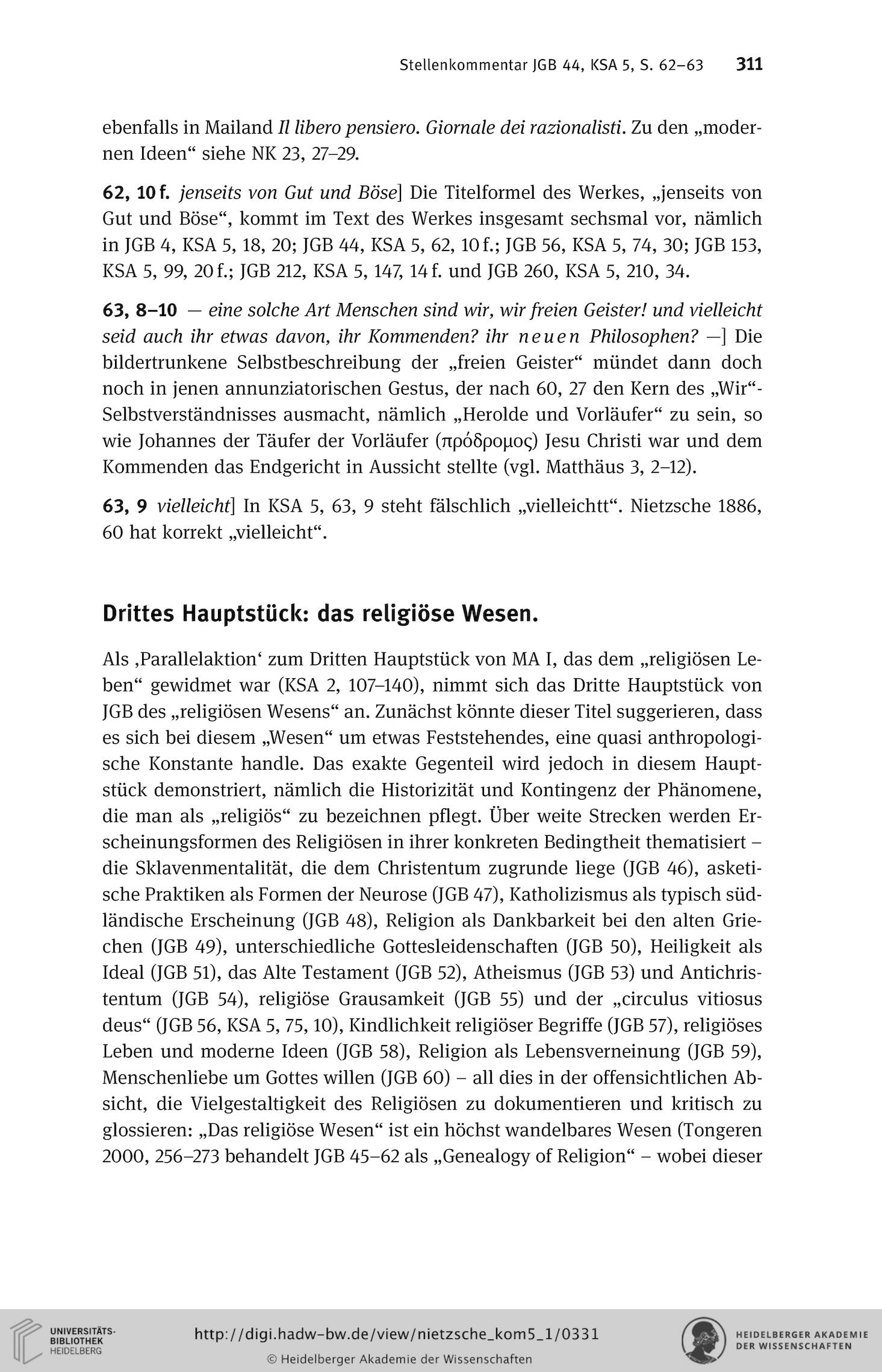Stellenkommentar JGB 44, KSA 5, S. 62-63 311
ebenfalls in Mailand II libero pensiero. Giornale dei razionalisti. Zu den „moder-
nen Ideen“ siehe NK 23, 27-29.
62,10 f. jenseits von Gut und Böse] Die Titelformel des Werkes, „jenseits von
Gut und Böse“, kommt im Text des Werkes insgesamt sechsmal vor, nämlich
in JGB 4, KSA 5, 18, 20; JGB 44, KSA 5, 62, 10 f.; JGB 56, KSA 5, 74, 30; JGB 153,
KSA 5, 99, 20 f.; JGB 212, KSA 5, 147, 14 f. und JGB 260, KSA 5, 210, 34.
63, 8-10 — eine solche Art Menschen sind wir, wir freien Geister! und vielleicht
seid auch ihr etwas davon, ihr Kommenden? ihr neuen Philosophen? —] Die
bildertrunkene Selbstbeschreibung der „freien Geister“ mündet dann doch
noch in jenen annunziatorischen Gestus, der nach 60, TI den Kern des „Wir“-
Selbstverständnisses ausmacht, nämlich „Herolde und Vorläufer“ zu sein, so
wie Johannes der Täufer der Vorläufer (npoöpopoc;) Jesu Christi war und dem
Kommenden das Endgericht in Aussicht stellte (vgl. Matthäus 3, 2-12).
63, 9 vielleicht] In KSA 5, 63, 9 steht fälschlich „vielleicht!“. Nietzsche 1886,
60 hat korrekt „vielleicht“.
Drittes Hauptstück: das religiöse Wesen.
Als ,Parallelaktion4 zum Dritten Hauptstück von MA I, das dem „religiösen Le-
ben“ gewidmet war (KSA 2, 107-140), nimmt sich das Dritte Hauptstück von
JGB des „religiösen Wesens“ an. Zunächst könnte dieser Titel suggerieren, dass
es sich bei diesem „Wesen“ um etwas Feststehendes, eine quasi anthropologi-
sche Konstante handle. Das exakte Gegenteil wird jedoch in diesem Haupt-
stück demonstriert, nämlich die Historizität und Kontingenz der Phänomene,
die man als „religiös“ zu bezeichnen pflegt. Über weite Strecken werden Er-
scheinungsformen des Religiösen in ihrer konkreten Bedingtheit thematisiert -
die Sklavenmentalität, die dem Christentum zugrunde liege (JGB 46), asketi-
sche Praktiken als Formen der Neurose (JGB 47), Katholizismus als typisch süd-
ländische Erscheinung (JGB 48), Religion als Dankbarkeit bei den alten Grie-
chen (JGB 49), unterschiedliche Gottesleidenschaften (JGB 50), Heiligkeit als
Ideal (JGB 51), das Alte Testament (JGB 52), Atheismus (JGB 53) und Antichris-
tentum (JGB 54), religiöse Grausamkeit (JGB 55) und der „circulus vitiosus
deus“ (JGB 56, KSA 5, 75,10), Kindlichkeit religiöser Begriffe (JGB 57), religiöses
Leben und moderne Ideen (JGB 58), Religion als Lebensverneinung (JGB 59),
Menschenliebe um Gottes willen (JGB 60) - all dies in der offensichtlichen Ab-
sicht, die Vielgestaltigkeit des Religiösen zu dokumentieren und kritisch zu
glossieren: „Das religiöse Wesen“ ist ein höchst wandelbares Wesen (Tongeren
2000, 256-273 behandelt JGB 45-62 als „Genealogy of Religion“ - wobei dieser
ebenfalls in Mailand II libero pensiero. Giornale dei razionalisti. Zu den „moder-
nen Ideen“ siehe NK 23, 27-29.
62,10 f. jenseits von Gut und Böse] Die Titelformel des Werkes, „jenseits von
Gut und Böse“, kommt im Text des Werkes insgesamt sechsmal vor, nämlich
in JGB 4, KSA 5, 18, 20; JGB 44, KSA 5, 62, 10 f.; JGB 56, KSA 5, 74, 30; JGB 153,
KSA 5, 99, 20 f.; JGB 212, KSA 5, 147, 14 f. und JGB 260, KSA 5, 210, 34.
63, 8-10 — eine solche Art Menschen sind wir, wir freien Geister! und vielleicht
seid auch ihr etwas davon, ihr Kommenden? ihr neuen Philosophen? —] Die
bildertrunkene Selbstbeschreibung der „freien Geister“ mündet dann doch
noch in jenen annunziatorischen Gestus, der nach 60, TI den Kern des „Wir“-
Selbstverständnisses ausmacht, nämlich „Herolde und Vorläufer“ zu sein, so
wie Johannes der Täufer der Vorläufer (npoöpopoc;) Jesu Christi war und dem
Kommenden das Endgericht in Aussicht stellte (vgl. Matthäus 3, 2-12).
63, 9 vielleicht] In KSA 5, 63, 9 steht fälschlich „vielleicht!“. Nietzsche 1886,
60 hat korrekt „vielleicht“.
Drittes Hauptstück: das religiöse Wesen.
Als ,Parallelaktion4 zum Dritten Hauptstück von MA I, das dem „religiösen Le-
ben“ gewidmet war (KSA 2, 107-140), nimmt sich das Dritte Hauptstück von
JGB des „religiösen Wesens“ an. Zunächst könnte dieser Titel suggerieren, dass
es sich bei diesem „Wesen“ um etwas Feststehendes, eine quasi anthropologi-
sche Konstante handle. Das exakte Gegenteil wird jedoch in diesem Haupt-
stück demonstriert, nämlich die Historizität und Kontingenz der Phänomene,
die man als „religiös“ zu bezeichnen pflegt. Über weite Strecken werden Er-
scheinungsformen des Religiösen in ihrer konkreten Bedingtheit thematisiert -
die Sklavenmentalität, die dem Christentum zugrunde liege (JGB 46), asketi-
sche Praktiken als Formen der Neurose (JGB 47), Katholizismus als typisch süd-
ländische Erscheinung (JGB 48), Religion als Dankbarkeit bei den alten Grie-
chen (JGB 49), unterschiedliche Gottesleidenschaften (JGB 50), Heiligkeit als
Ideal (JGB 51), das Alte Testament (JGB 52), Atheismus (JGB 53) und Antichris-
tentum (JGB 54), religiöse Grausamkeit (JGB 55) und der „circulus vitiosus
deus“ (JGB 56, KSA 5, 75,10), Kindlichkeit religiöser Begriffe (JGB 57), religiöses
Leben und moderne Ideen (JGB 58), Religion als Lebensverneinung (JGB 59),
Menschenliebe um Gottes willen (JGB 60) - all dies in der offensichtlichen Ab-
sicht, die Vielgestaltigkeit des Religiösen zu dokumentieren und kritisch zu
glossieren: „Das religiöse Wesen“ ist ein höchst wandelbares Wesen (Tongeren
2000, 256-273 behandelt JGB 45-62 als „Genealogy of Religion“ - wobei dieser