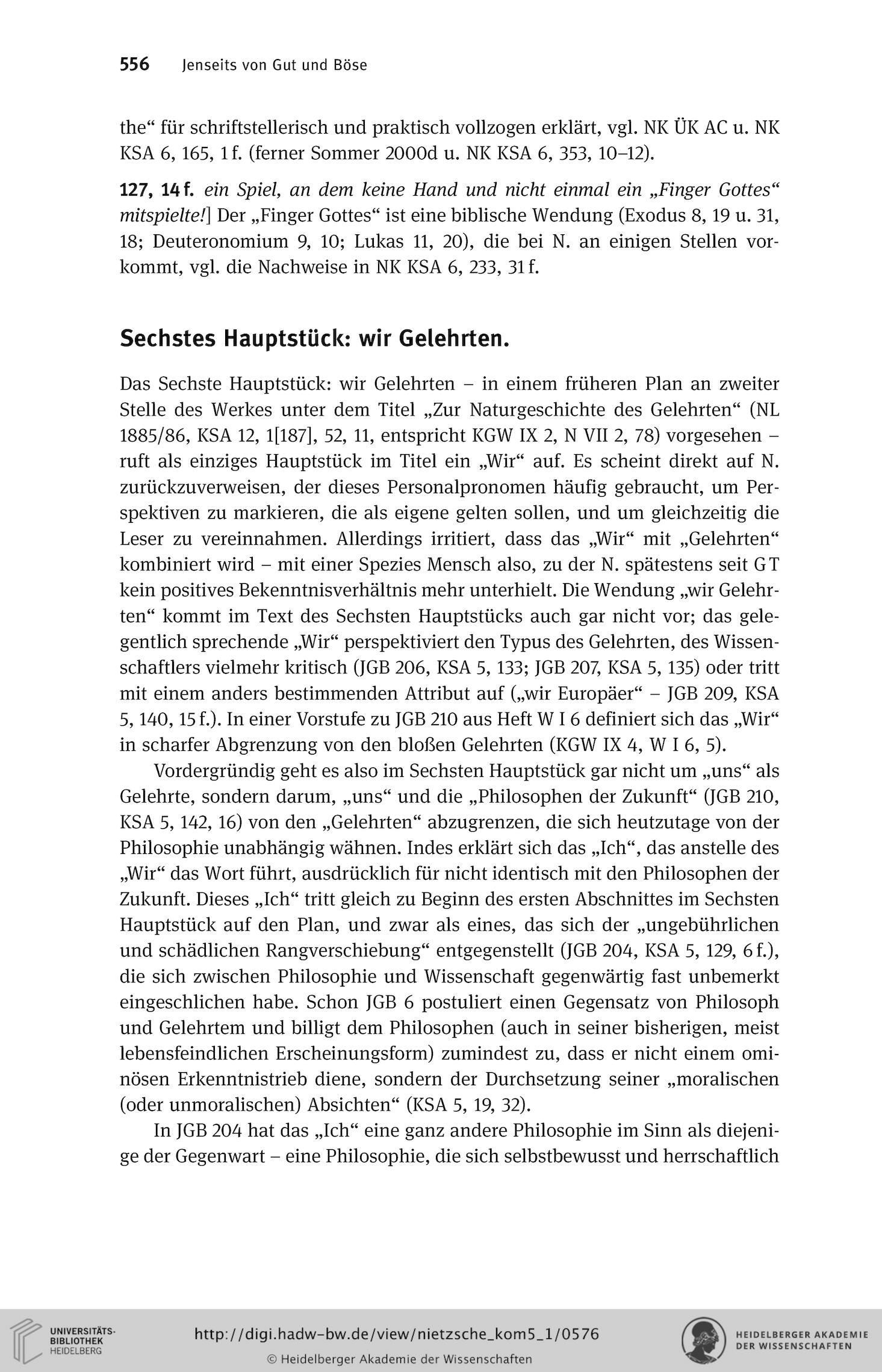556 Jenseits von Gut und Böse
the“ für schriftstellerisch und praktisch vollzogen erklärt, vgl. NK ÜK AC u. NK
KSA 6, 165, 1 f. (ferner Sommer 2OOOd u. NK KSA 6, 353, 10-12).
127, 14 f. ein Spiel, an dem keine Hand und nicht einmal ein „Finger Gottes“
mitspielte!] Der „Finger Gottes“ ist eine biblische Wendung (Exodus 8,19 u. 31,
18; Deuteronomium 9, 10; Lukas 11, 20), die bei N. an einigen Stellen vor-
kommt, vgl. die Nachweise in NK KSA 6, 233, 31 f.
Sechstes Hauptstück: wir Gelehrten.
Das Sechste Hauptstück: wir Gelehrten - in einem früheren Plan an zweiter
Stelle des Werkes unter dem Titel „Zur Naturgeschichte des Gelehrten“ (NL
1885/86, KSA 12, 1[187], 52, 11, entspricht KGW IX 2, N VII 2, 78) vorgesehen -
ruft als einziges Hauptstück im Titel ein „Wir“ auf. Es scheint direkt auf N.
zurückzuverweisen, der dieses Personalpronomen häufig gebraucht, um Per-
spektiven zu markieren, die als eigene gelten sollen, und um gleichzeitig die
Leser zu vereinnahmen. Allerdings irritiert, dass das „Wir“ mit „Gelehrten“
kombiniert wird - mit einer Spezies Mensch also, zu der N. spätestens seit G T
kein positives Bekenntnisverhältnis mehr unterhielt. Die Wendung „wir Gelehr-
ten“ kommt im Text des Sechsten Hauptstücks auch gar nicht vor; das gele-
gentlich sprechende „Wir“ perspektiviert den Typus des Gelehrten, des Wissen-
schaftlers vielmehr kritisch (JGB 206, KSA 5, 133; JGB 207, KSA 5, 135) oder tritt
mit einem anders bestimmenden Attribut auf („wir Europäer“ - JGB 209, KSA
5,140,15 f.). In einer Vorstufe zu JGB 210 aus Heft WI 6 definiert sich das „Wir“
in scharfer Abgrenzung von den bloßen Gelehrten (KGW IX 4, W I 6, 5).
Vordergründig geht es also im Sechsten Hauptstück gar nicht um „uns“ als
Gelehrte, sondern darum, „uns“ und die „Philosophen der Zukunft“ (JGB 210,
KSA 5, 142, 16) von den „Gelehrten“ abzugrenzen, die sich heutzutage von der
Philosophie unabhängig wähnen. Indes erklärt sich das „Ich“, das anstelle des
„Wir“ das Wort führt, ausdrücklich für nicht identisch mit den Philosophen der
Zukunft. Dieses „Ich“ tritt gleich zu Beginn des ersten Abschnittes im Sechsten
Hauptstück auf den Plan, und zwar als eines, das sich der „ungebührlichen
und schädlichen Rangverschiebung“ entgegenstellt (JGB 204, KSA 5, 129, 6 f.),
die sich zwischen Philosophie und Wissenschaft gegenwärtig fast unbemerkt
eingeschlichen habe. Schon JGB 6 postuliert einen Gegensatz von Philosoph
und Gelehrtem und billigt dem Philosophen (auch in seiner bisherigen, meist
lebensfeindlichen Erscheinungsform) zumindest zu, dass er nicht einem omi-
nösen Erkenntnistrieb diene, sondern der Durchsetzung seiner „moralischen
(oder unmoralischen) Absichten“ (KSA 5, 19, 32).
In JGB 204 hat das „Ich“ eine ganz andere Philosophie im Sinn als diejeni-
ge der Gegenwart - eine Philosophie, die sich selbstbewusst und herrschaftlich
the“ für schriftstellerisch und praktisch vollzogen erklärt, vgl. NK ÜK AC u. NK
KSA 6, 165, 1 f. (ferner Sommer 2OOOd u. NK KSA 6, 353, 10-12).
127, 14 f. ein Spiel, an dem keine Hand und nicht einmal ein „Finger Gottes“
mitspielte!] Der „Finger Gottes“ ist eine biblische Wendung (Exodus 8,19 u. 31,
18; Deuteronomium 9, 10; Lukas 11, 20), die bei N. an einigen Stellen vor-
kommt, vgl. die Nachweise in NK KSA 6, 233, 31 f.
Sechstes Hauptstück: wir Gelehrten.
Das Sechste Hauptstück: wir Gelehrten - in einem früheren Plan an zweiter
Stelle des Werkes unter dem Titel „Zur Naturgeschichte des Gelehrten“ (NL
1885/86, KSA 12, 1[187], 52, 11, entspricht KGW IX 2, N VII 2, 78) vorgesehen -
ruft als einziges Hauptstück im Titel ein „Wir“ auf. Es scheint direkt auf N.
zurückzuverweisen, der dieses Personalpronomen häufig gebraucht, um Per-
spektiven zu markieren, die als eigene gelten sollen, und um gleichzeitig die
Leser zu vereinnahmen. Allerdings irritiert, dass das „Wir“ mit „Gelehrten“
kombiniert wird - mit einer Spezies Mensch also, zu der N. spätestens seit G T
kein positives Bekenntnisverhältnis mehr unterhielt. Die Wendung „wir Gelehr-
ten“ kommt im Text des Sechsten Hauptstücks auch gar nicht vor; das gele-
gentlich sprechende „Wir“ perspektiviert den Typus des Gelehrten, des Wissen-
schaftlers vielmehr kritisch (JGB 206, KSA 5, 133; JGB 207, KSA 5, 135) oder tritt
mit einem anders bestimmenden Attribut auf („wir Europäer“ - JGB 209, KSA
5,140,15 f.). In einer Vorstufe zu JGB 210 aus Heft WI 6 definiert sich das „Wir“
in scharfer Abgrenzung von den bloßen Gelehrten (KGW IX 4, W I 6, 5).
Vordergründig geht es also im Sechsten Hauptstück gar nicht um „uns“ als
Gelehrte, sondern darum, „uns“ und die „Philosophen der Zukunft“ (JGB 210,
KSA 5, 142, 16) von den „Gelehrten“ abzugrenzen, die sich heutzutage von der
Philosophie unabhängig wähnen. Indes erklärt sich das „Ich“, das anstelle des
„Wir“ das Wort führt, ausdrücklich für nicht identisch mit den Philosophen der
Zukunft. Dieses „Ich“ tritt gleich zu Beginn des ersten Abschnittes im Sechsten
Hauptstück auf den Plan, und zwar als eines, das sich der „ungebührlichen
und schädlichen Rangverschiebung“ entgegenstellt (JGB 204, KSA 5, 129, 6 f.),
die sich zwischen Philosophie und Wissenschaft gegenwärtig fast unbemerkt
eingeschlichen habe. Schon JGB 6 postuliert einen Gegensatz von Philosoph
und Gelehrtem und billigt dem Philosophen (auch in seiner bisherigen, meist
lebensfeindlichen Erscheinungsform) zumindest zu, dass er nicht einem omi-
nösen Erkenntnistrieb diene, sondern der Durchsetzung seiner „moralischen
(oder unmoralischen) Absichten“ (KSA 5, 19, 32).
In JGB 204 hat das „Ich“ eine ganz andere Philosophie im Sinn als diejeni-
ge der Gegenwart - eine Philosophie, die sich selbstbewusst und herrschaftlich