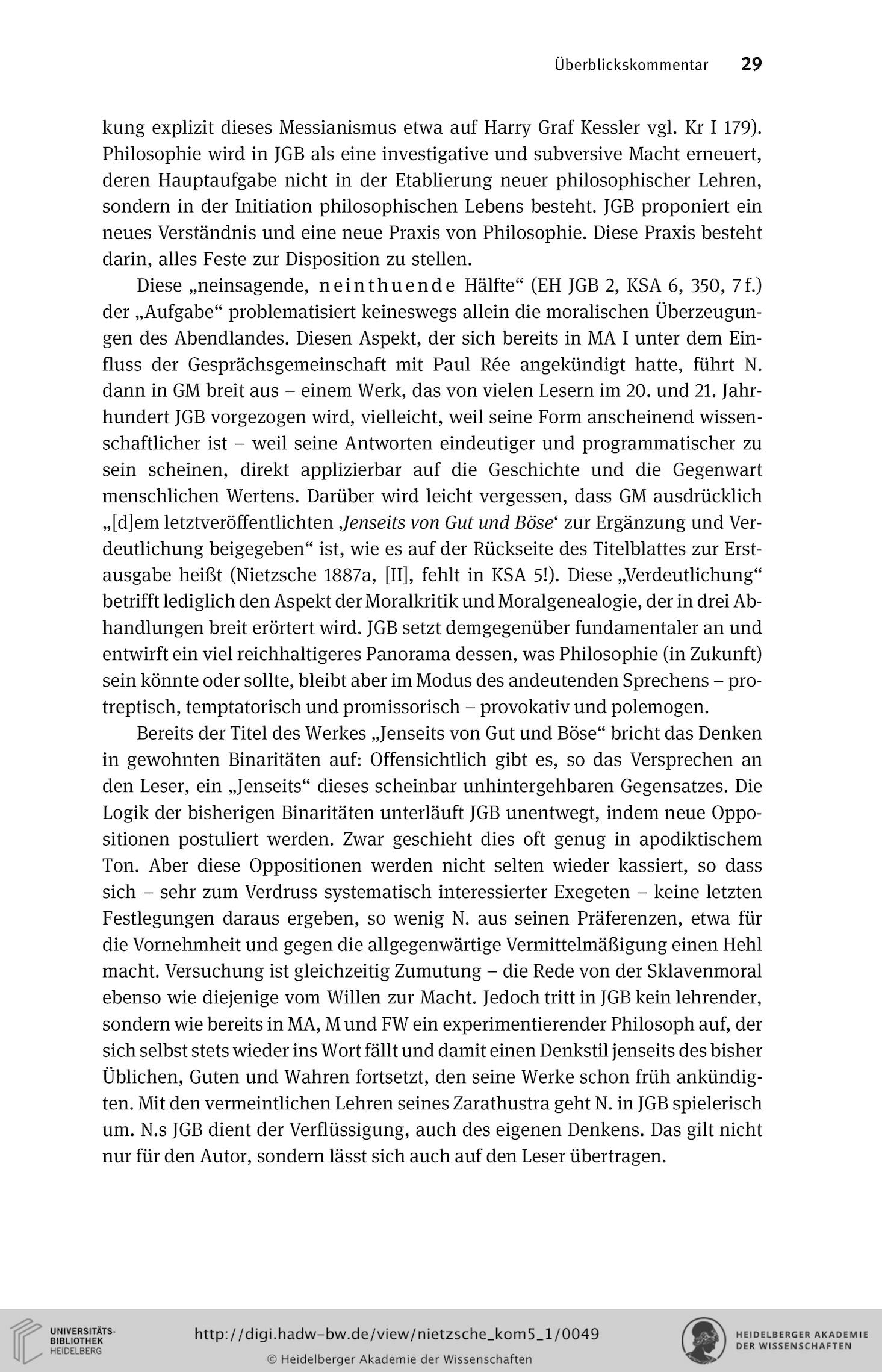Überblickskommentar 29
kung explizit dieses Messianismus etwa auf Harry Graf Kessler vgl. Kr I 179).
Philosophie wird in JGB als eine investigative und subversive Macht erneuert,
deren Hauptaufgabe nicht in der Etablierung neuer philosophischer Lehren,
sondern in der Initiation philosophischen Lebens besteht. JGB proponiert ein
neues Verständnis und eine neue Praxis von Philosophie. Diese Praxis besteht
darin, alles Feste zur Disposition zu stellen.
Diese „neinsagende, neinthuende Hälfte“ (EH JGB 2, KSA 6, 350, 7f.)
der „Aufgabe“ problematisiert keineswegs allein die moralischen Überzeugun-
gen des Abendlandes. Diesen Aspekt, der sich bereits in MA I unter dem Ein-
fluss der Gesprächsgemeinschaft mit Paul Ree angekündigt hatte, führt N.
dann in GM breit aus - einem Werk, das von vielen Lesern im 20. und 21. Jahr-
hundert JGB vorgezogen wird, vielleicht, weil seine Form anscheinend wissen-
schaftlicher ist - weil seine Antworten eindeutiger und programmatischer zu
sein scheinen, direkt applizierbar auf die Geschichte und die Gegenwart
menschlichen Wertens. Darüber wird leicht vergessen, dass GM ausdrücklich
,,[d]em letztveröffentlichten Jenseits von Gut und Böse‘ zur Ergänzung und Ver-
deutlichung beigegeben“ ist, wie es auf der Rückseite des Titelblattes zur Erst-
ausgabe heißt (Nietzsche 1887a, [II], fehlt in KSA 5!). Diese „Verdeutlichung“
betrifft lediglich den Aspekt der Moralkritik und Moralgenealogie, der in drei Ab-
handlungen breit erörtert wird. JGB setzt demgegenüber fundamentaler an und
entwirft ein viel reichhaltigeres Panorama dessen, was Philosophie (in Zukunft)
sein könnte oder sollte, bleibt aber im Modus des andeutenden Sprechens - pro-
treptisch, temptatorisch und promissorisch - provokativ und polemogen.
Bereits der Titel des Werkes „Jenseits von Gut und Böse“ bricht das Denken
in gewohnten Binaritäten auf: Offensichtlich gibt es, so das Versprechen an
den Leser, ein „Jenseits“ dieses scheinbar unhintergehbaren Gegensatzes. Die
Logik der bisherigen Binaritäten unterläuft JGB unentwegt, indem neue Oppo-
sitionen postuliert werden. Zwar geschieht dies oft genug in apodiktischem
Ton. Aber diese Oppositionen werden nicht selten wieder kassiert, so dass
sich - sehr zum Verdruss systematisch interessierter Exegeten - keine letzten
Festlegungen daraus ergeben, so wenig N. aus seinen Präferenzen, etwa für
die Vornehmheit und gegen die allgegenwärtige Vermittelmäßigung einen Hehl
macht. Versuchung ist gleichzeitig Zumutung - die Rede von der Sklavenmoral
ebenso wie diejenige vom Willen zur Macht. Jedoch tritt in JGB kein lehrender,
sondern wie bereits in MA, M und FW ein experimentierender Philosoph auf, der
sich selbst stets wieder ins Wort fällt und damit einen Denkstil jenseits des bisher
Üblichen, Guten und Wahren fortsetzt, den seine Werke schon früh ankündig-
ten. Mit den vermeintlichen Lehren seines Zarathustra geht N. in JGB spielerisch
um. N.s JGB dient der Verflüssigung, auch des eigenen Denkens. Das gilt nicht
nur für den Autor, sondern lässt sich auch auf den Leser übertragen.
kung explizit dieses Messianismus etwa auf Harry Graf Kessler vgl. Kr I 179).
Philosophie wird in JGB als eine investigative und subversive Macht erneuert,
deren Hauptaufgabe nicht in der Etablierung neuer philosophischer Lehren,
sondern in der Initiation philosophischen Lebens besteht. JGB proponiert ein
neues Verständnis und eine neue Praxis von Philosophie. Diese Praxis besteht
darin, alles Feste zur Disposition zu stellen.
Diese „neinsagende, neinthuende Hälfte“ (EH JGB 2, KSA 6, 350, 7f.)
der „Aufgabe“ problematisiert keineswegs allein die moralischen Überzeugun-
gen des Abendlandes. Diesen Aspekt, der sich bereits in MA I unter dem Ein-
fluss der Gesprächsgemeinschaft mit Paul Ree angekündigt hatte, führt N.
dann in GM breit aus - einem Werk, das von vielen Lesern im 20. und 21. Jahr-
hundert JGB vorgezogen wird, vielleicht, weil seine Form anscheinend wissen-
schaftlicher ist - weil seine Antworten eindeutiger und programmatischer zu
sein scheinen, direkt applizierbar auf die Geschichte und die Gegenwart
menschlichen Wertens. Darüber wird leicht vergessen, dass GM ausdrücklich
,,[d]em letztveröffentlichten Jenseits von Gut und Böse‘ zur Ergänzung und Ver-
deutlichung beigegeben“ ist, wie es auf der Rückseite des Titelblattes zur Erst-
ausgabe heißt (Nietzsche 1887a, [II], fehlt in KSA 5!). Diese „Verdeutlichung“
betrifft lediglich den Aspekt der Moralkritik und Moralgenealogie, der in drei Ab-
handlungen breit erörtert wird. JGB setzt demgegenüber fundamentaler an und
entwirft ein viel reichhaltigeres Panorama dessen, was Philosophie (in Zukunft)
sein könnte oder sollte, bleibt aber im Modus des andeutenden Sprechens - pro-
treptisch, temptatorisch und promissorisch - provokativ und polemogen.
Bereits der Titel des Werkes „Jenseits von Gut und Böse“ bricht das Denken
in gewohnten Binaritäten auf: Offensichtlich gibt es, so das Versprechen an
den Leser, ein „Jenseits“ dieses scheinbar unhintergehbaren Gegensatzes. Die
Logik der bisherigen Binaritäten unterläuft JGB unentwegt, indem neue Oppo-
sitionen postuliert werden. Zwar geschieht dies oft genug in apodiktischem
Ton. Aber diese Oppositionen werden nicht selten wieder kassiert, so dass
sich - sehr zum Verdruss systematisch interessierter Exegeten - keine letzten
Festlegungen daraus ergeben, so wenig N. aus seinen Präferenzen, etwa für
die Vornehmheit und gegen die allgegenwärtige Vermittelmäßigung einen Hehl
macht. Versuchung ist gleichzeitig Zumutung - die Rede von der Sklavenmoral
ebenso wie diejenige vom Willen zur Macht. Jedoch tritt in JGB kein lehrender,
sondern wie bereits in MA, M und FW ein experimentierender Philosoph auf, der
sich selbst stets wieder ins Wort fällt und damit einen Denkstil jenseits des bisher
Üblichen, Guten und Wahren fortsetzt, den seine Werke schon früh ankündig-
ten. Mit den vermeintlichen Lehren seines Zarathustra geht N. in JGB spielerisch
um. N.s JGB dient der Verflüssigung, auch des eigenen Denkens. Das gilt nicht
nur für den Autor, sondern lässt sich auch auf den Leser übertragen.