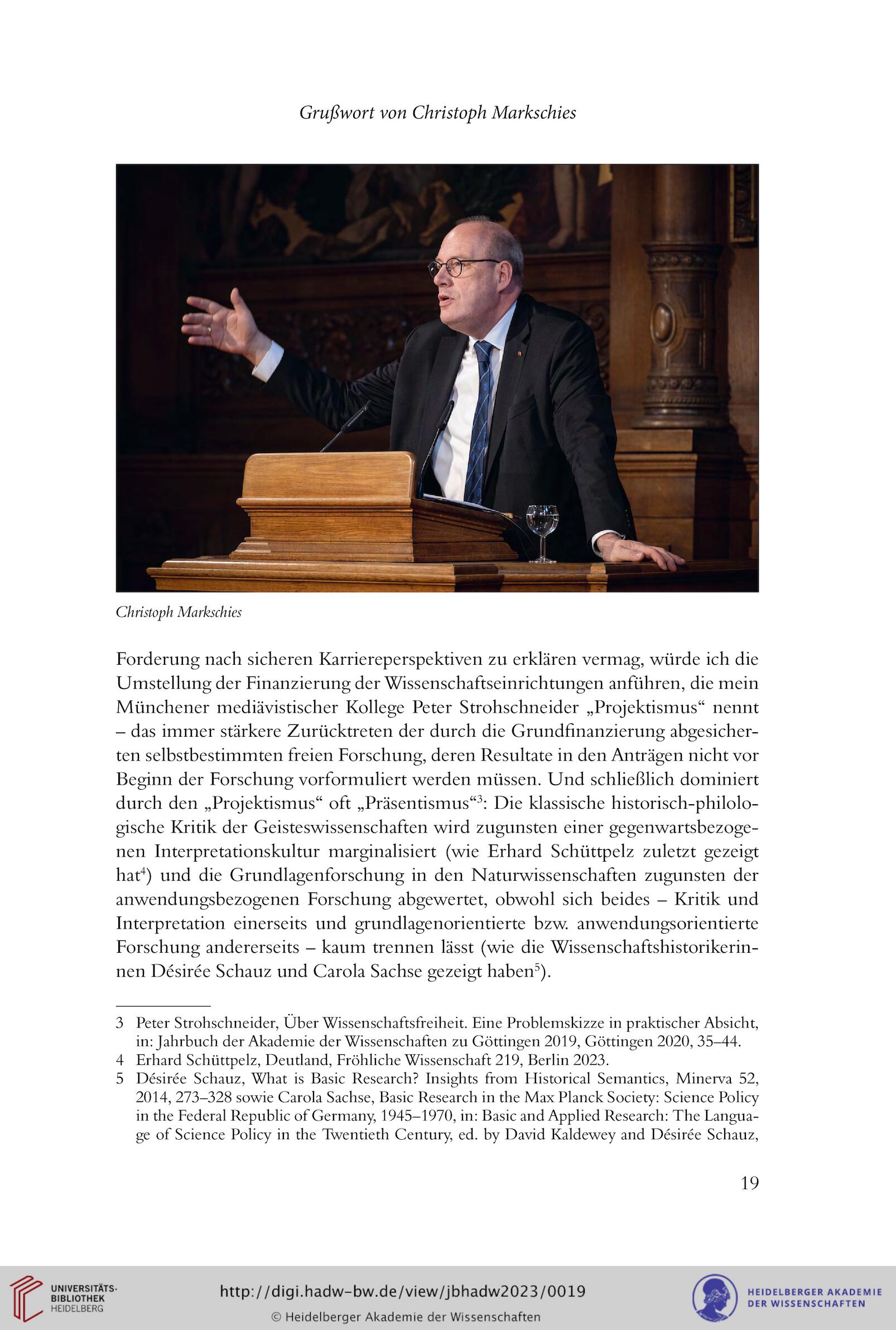Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2023
— 2023(2024)
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.71221#0019
DOI Kapitel:
A. Das akademische Jahr
DOI Kapitel:I. Jahresfeier am 24. Juni 2023
DOI Kapitel:Grußwort von Christoph Markschies, Präsident der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.71221#0019
- Titelblatt
- 5-10 Inhaltsverzeichnis
-
11-194
A. Das akademische Jahr
-
11-43
I. Jahresfeier am 24. Juni 2023
- 11-12 Begrüßung durch den Präsidenten Bernd Schneidmüller
- 13-17 "Politik braucht Wissenschaft". Grußwort der Ministerin Petra Olschowsk
- 18-21 Grußwort von Christoph Markschies, Präsident der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
- 22-27 „Von Demut und vom Zweifeln in der Wissenschaft“. Bericht des Präsidenten
- 28-29 Kurzbericht der Sprecherin des WIN-Kollegs Katharina Jacob
- 30-42 Festvortrag von Matthias Kind: „Energieversorgung im Zeichen des Klimawandels“
- 43 Verleihung der Preise
-
44-110
II. Wissenschaftliche Vorträge
- 111-194 III. Veranstaltungen
-
11-43
I. Jahresfeier am 24. Juni 2023
- 195-246 B. Die Mitglieder
- 247-368 C. Die Forschungsvorhaben
-
369-430
D. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
-
369-383
I. Preise der Akademie
- 384 II. Die Junge Akademie|HAdW
-
385-413
III. Das WIN-Kolleg der Jungen Akademie|HAdW
- 386 Verzeichnis der WIN-Kollegiatinnen und -Kollegiaten des 7. Teilprogramms
- 387 Verzeichnis der WIN-Kollegiatinnen und -Kollegiaten des 8. Teilprogramms
- 388-392 Tag der interdisziplinären Wissenschaftskommunikation
- 393-403 Siebter Forschungsschwerpunkt. „Wie entscheiden Kollektive?“
- 404-413 Achter Forschungsschwerpunkt. „Stabilität und Instabilität von Zuständen – Schlüssel zum Verständnis von Umbrüchen, Wendepunkten und Übergangsphasen“
- 414-421 IV. Das Akademie-Kolleg der Jungen Akademie | HAdW
- 422-430 V. WIN-Konferenzen der Jungen Akademie | HAdW
-
369-383
I. Preise der Akademie
- 431-452 E. Anhang
Grußwort von Christoph Markschies
Christoph Markschies
Forderung nach sicheren Karriereperspektiven zu erklären vermag, würde ich die
Umstellung der Finanzierung der Wissenschaftseinrichtungen anführen, die mein
Münchener mediävistischer Kollege Peter Strohschneider „Projektismus" nennt
- das immer stärkere Zurücktreten der durch die Grundfinanzierung abgesicher-
ten selbstbestimmten freien Forschung, deren Resultate in den Anträgen nicht vor
Beginn der Forschung vorformuliert werden müssen. Und schließlich dominiert
durch den „Projektismus" oft „Präsentismus"3: Die klassische historisch-philolo-
gische Kritik der Geisteswissenschaften wird zugunsten einer gegenwartsbezoge-
nen Interpretationskultur marginalisiert (wie Erhard Schüttpelz zuletzt gezeigt
hat4) und die Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften zugunsten der
anwendungsbezogenen Forschung abgewertet, obwohl sich beides - Kritik und
Interpretation einerseits und grundlagenorientierte bzw. anwendungsorientierte
Forschung andererseits - kaum trennen lässt (wie die Wissenschaftshistorikerin-
nen Desiree Schauz und Carola Sachse gezeigt haben5).
3 Peter Strohschneider, Über Wissenschaftsfreiheit. Eine Problemskizze in praktischer Absicht,
in: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2019, Göttingen 2020, 35-44.
4 Erhard Schüttpelz, Deutland, Fröhliche Wissenschaft 219, Berlin 2023.
5 Desiree Schauz, What is Basic Research? Insights from Historical Semantics, Minerva 52,
2014, 273-328 sowie Carola Sachse, Basic Research in the Max Planck Society: Science Policy
in the Federal Republic of Germany, 1945-1970, in: Basic and Applied Research: The Langua-
ge of Science Policy in the Twentieth Century, ed. by David Kaldewey and Desiree Schauz,
19
Christoph Markschies
Forderung nach sicheren Karriereperspektiven zu erklären vermag, würde ich die
Umstellung der Finanzierung der Wissenschaftseinrichtungen anführen, die mein
Münchener mediävistischer Kollege Peter Strohschneider „Projektismus" nennt
- das immer stärkere Zurücktreten der durch die Grundfinanzierung abgesicher-
ten selbstbestimmten freien Forschung, deren Resultate in den Anträgen nicht vor
Beginn der Forschung vorformuliert werden müssen. Und schließlich dominiert
durch den „Projektismus" oft „Präsentismus"3: Die klassische historisch-philolo-
gische Kritik der Geisteswissenschaften wird zugunsten einer gegenwartsbezoge-
nen Interpretationskultur marginalisiert (wie Erhard Schüttpelz zuletzt gezeigt
hat4) und die Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften zugunsten der
anwendungsbezogenen Forschung abgewertet, obwohl sich beides - Kritik und
Interpretation einerseits und grundlagenorientierte bzw. anwendungsorientierte
Forschung andererseits - kaum trennen lässt (wie die Wissenschaftshistorikerin-
nen Desiree Schauz und Carola Sachse gezeigt haben5).
3 Peter Strohschneider, Über Wissenschaftsfreiheit. Eine Problemskizze in praktischer Absicht,
in: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2019, Göttingen 2020, 35-44.
4 Erhard Schüttpelz, Deutland, Fröhliche Wissenschaft 219, Berlin 2023.
5 Desiree Schauz, What is Basic Research? Insights from Historical Semantics, Minerva 52,
2014, 273-328 sowie Carola Sachse, Basic Research in the Max Planck Society: Science Policy
in the Federal Republic of Germany, 1945-1970, in: Basic and Applied Research: The Langua-
ge of Science Policy in the Twentieth Century, ed. by David Kaldewey and Desiree Schauz,
19