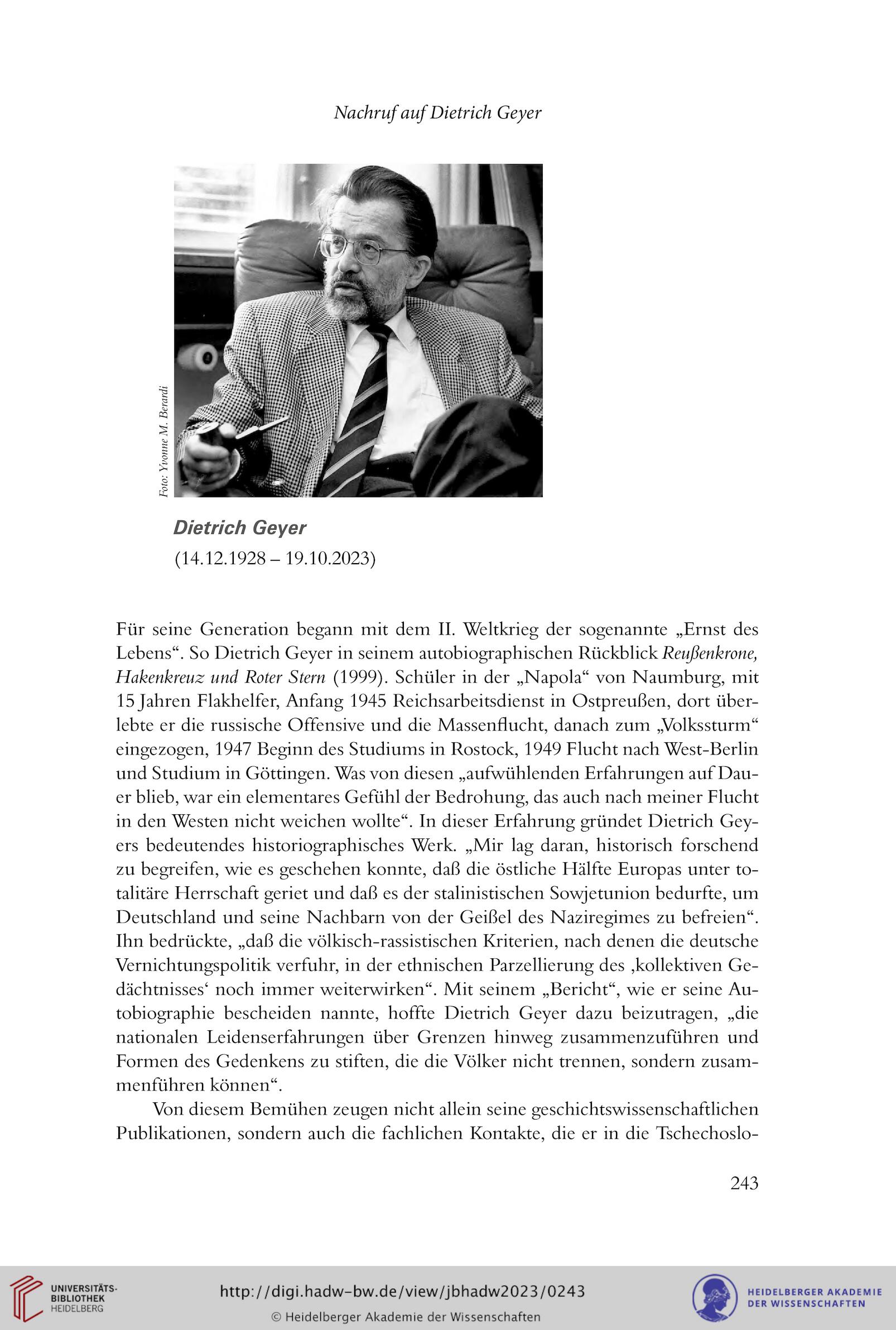Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2023
— 2023(2024)
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.71221#0243
DOI Kapitel:
B. Die Mitglieder
DOI Kapitel:II. Nachrufe
DOI Artikel:Langewiesche, Dieter: Dietrich Geyer
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.71221#0243
- Titelblatt
- 5-10 Inhaltsverzeichnis
-
11-194
A. Das akademische Jahr
-
11-43
I. Jahresfeier am 24. Juni 2023
- 11-12 Begrüßung durch den Präsidenten Bernd Schneidmüller
- 13-17 "Politik braucht Wissenschaft". Grußwort der Ministerin Petra Olschowsk
- 18-21 Grußwort von Christoph Markschies, Präsident der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
- 22-27 „Von Demut und vom Zweifeln in der Wissenschaft“. Bericht des Präsidenten
- 28-29 Kurzbericht der Sprecherin des WIN-Kollegs Katharina Jacob
- 30-42 Festvortrag von Matthias Kind: „Energieversorgung im Zeichen des Klimawandels“
- 43 Verleihung der Preise
-
44-110
II. Wissenschaftliche Vorträge
- 111-194 III. Veranstaltungen
-
11-43
I. Jahresfeier am 24. Juni 2023
- 195-246 B. Die Mitglieder
- 247-368 C. Die Forschungsvorhaben
-
369-430
D. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
-
369-383
I. Preise der Akademie
- 384 II. Die Junge Akademie|HAdW
-
385-413
III. Das WIN-Kolleg der Jungen Akademie|HAdW
- 386 Verzeichnis der WIN-Kollegiatinnen und -Kollegiaten des 7. Teilprogramms
- 387 Verzeichnis der WIN-Kollegiatinnen und -Kollegiaten des 8. Teilprogramms
- 388-392 Tag der interdisziplinären Wissenschaftskommunikation
- 393-403 Siebter Forschungsschwerpunkt. „Wie entscheiden Kollektive?“
- 404-413 Achter Forschungsschwerpunkt. „Stabilität und Instabilität von Zuständen – Schlüssel zum Verständnis von Umbrüchen, Wendepunkten und Übergangsphasen“
- 414-421 IV. Das Akademie-Kolleg der Jungen Akademie | HAdW
- 422-430 V. WIN-Konferenzen der Jungen Akademie | HAdW
-
369-383
I. Preise der Akademie
- 431-452 E. Anhang
Nachruf auf Dietrich Geyer
Dietrich Geyer
(14.12.1928 - 19.10.2023)
Für seine Generation begann mit dem II. Weltkrieg der sogenannte „Ernst des
Lebens". So Dietrich Geyer in seinem autobiographischen Rückblick Reußenkrone,
Hakenkreuz und Roter Stern (1999). Schüler in der „Napola" von Naumburg, mit
15 Jahren Flakhelfer, Anfang 1945 Reichsarbeitsdienst in Ostpreußen, dort über-
lebte er die russische Offensive und die Massenflucht, danach zum „Volkssturm"
eingezogen, 1947 Beginn des Studiums in Rostock, 1949 Flucht nach West-Berlin
und Studium in Göttingen. Was von diesen „aufwühlenden Erfahrungen auf Dau-
er blieb, war ein elementares Gefühl der Bedrohung, das auch nach meiner Flucht
in den Westen nicht weichen wollte". In dieser Erfahrung gründet Dietrich Gey-
ers bedeutendes historiographisches Werk. „Mir lag daran, historisch forschend
zu begreifen, wie es geschehen konnte, daß die östliche Hälfte Europas unter to-
talitäre Herrschaft geriet und daß es der stalinistischen Sowjetunion bedurfte, um
Deutschland und seine Nachbarn von der Geißel des Naziregimes zu befreien".
Ihn bedrückte, „daß die völkisch-rassistischen Kriterien, nach denen die deutsche
Vernichtungspolitik verfuhr, in der ethnischen Parzellierung des ,kollektiven Ge-
dächtnisses' noch immer weiterwirken". Mit seinem „Bericht", wie er seine Au-
tobiographie bescheiden nannte, hoffte Dietrich Geyer dazu beizutragen, „die
nationalen Leidenserfahrungen über Grenzen hinweg zusammenzuführen und
Formen des Gedenkens zu stiften, die die Völker nicht trennen, sondern zusam-
menführen können".
Von diesem Bemühen zeugen nicht allein seine geschichtswissenschaftlichen
Publikationen, sondern auch die fachlichen Kontakte, die er in die Tschechoslo-
243
Dietrich Geyer
(14.12.1928 - 19.10.2023)
Für seine Generation begann mit dem II. Weltkrieg der sogenannte „Ernst des
Lebens". So Dietrich Geyer in seinem autobiographischen Rückblick Reußenkrone,
Hakenkreuz und Roter Stern (1999). Schüler in der „Napola" von Naumburg, mit
15 Jahren Flakhelfer, Anfang 1945 Reichsarbeitsdienst in Ostpreußen, dort über-
lebte er die russische Offensive und die Massenflucht, danach zum „Volkssturm"
eingezogen, 1947 Beginn des Studiums in Rostock, 1949 Flucht nach West-Berlin
und Studium in Göttingen. Was von diesen „aufwühlenden Erfahrungen auf Dau-
er blieb, war ein elementares Gefühl der Bedrohung, das auch nach meiner Flucht
in den Westen nicht weichen wollte". In dieser Erfahrung gründet Dietrich Gey-
ers bedeutendes historiographisches Werk. „Mir lag daran, historisch forschend
zu begreifen, wie es geschehen konnte, daß die östliche Hälfte Europas unter to-
talitäre Herrschaft geriet und daß es der stalinistischen Sowjetunion bedurfte, um
Deutschland und seine Nachbarn von der Geißel des Naziregimes zu befreien".
Ihn bedrückte, „daß die völkisch-rassistischen Kriterien, nach denen die deutsche
Vernichtungspolitik verfuhr, in der ethnischen Parzellierung des ,kollektiven Ge-
dächtnisses' noch immer weiterwirken". Mit seinem „Bericht", wie er seine Au-
tobiographie bescheiden nannte, hoffte Dietrich Geyer dazu beizutragen, „die
nationalen Leidenserfahrungen über Grenzen hinweg zusammenzuführen und
Formen des Gedenkens zu stiften, die die Völker nicht trennen, sondern zusam-
menführen können".
Von diesem Bemühen zeugen nicht allein seine geschichtswissenschaftlichen
Publikationen, sondern auch die fachlichen Kontakte, die er in die Tschechoslo-
243