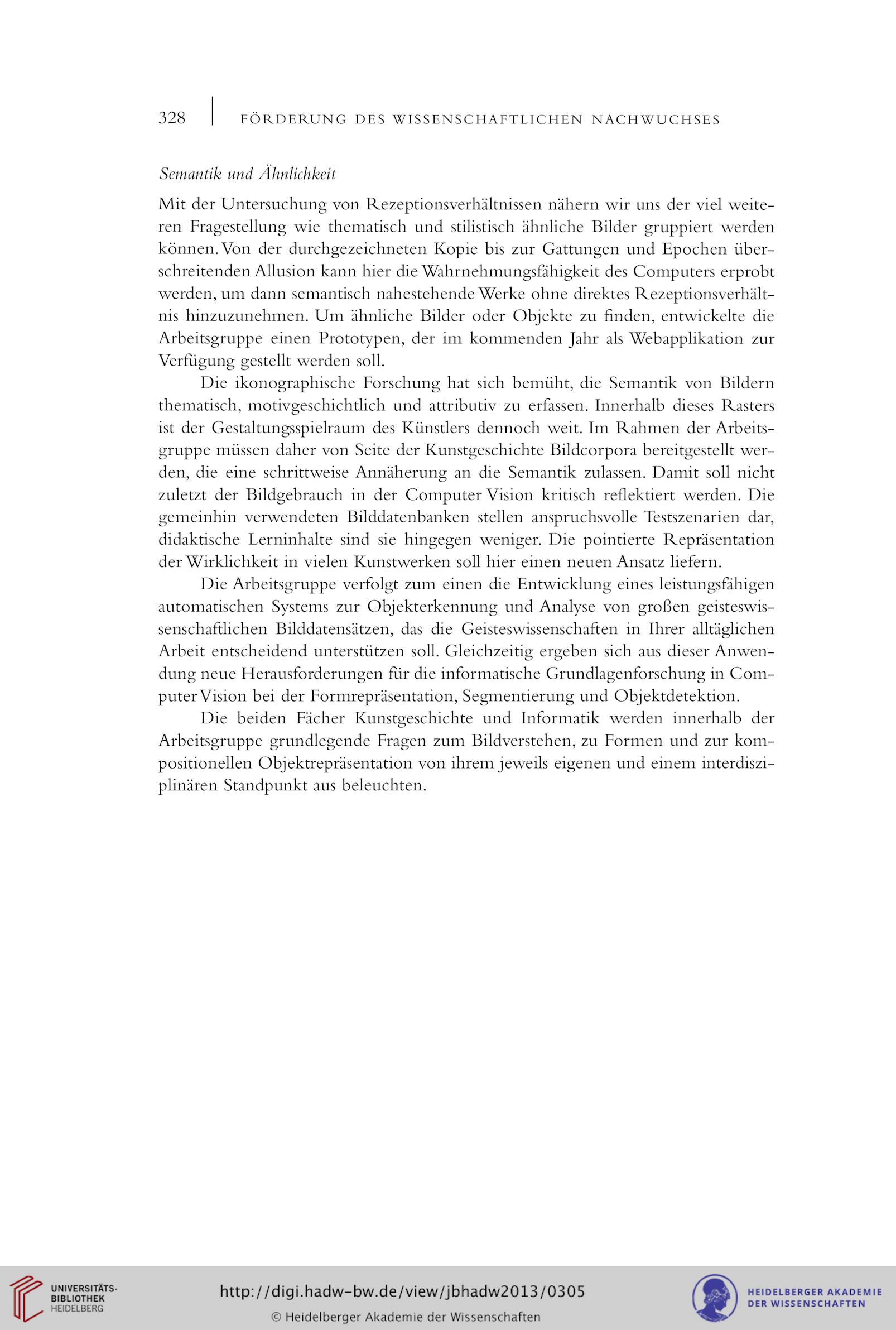Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2013
— 2014
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.55655#0305
DOI Kapitel:
III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
DOI Kapitel:B. Das WIN-Kolleg
DOI Kapitel:5. Forschungsschwerpunkt „Neue Wege der Verflechtung von Natur- und Geisteswissenschaften“
DOI Kapitel:Künstliches und künstlerisches Sehen. Computer Vision und Kunstgeschichte in methodisch-praktischer Zusammenarbeit
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.55655#0305
- Schmutztitel
- Titelblatt
- 5 Zum Geleit
- 7-11 Inhaltsübersicht
- 12-13 Vorstand und Verwaltung der Akademie
- 40-202 I. Das akademische Jahr 2013
-
60-132
Wissenschaftliche Sitzungen
-
60-63
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 25. Januar 2013
-
63-66
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 25. Januar 2013
-
66-75
Gesamtsitzung am 26. Januar 2013
-
75-89
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 26.April 2013
- 89-90 Sitzung der Math.-nat. Klasse am 26.April 2013
- 90-92 Gesamtsitzung am 27.April 2013
-
92-95
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 19. Juli 2013
-
95-98
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 19. Juli 2013
-
98-101
Gesamtsitzung am 20. Juli 2013
-
101-104
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 25. Oktober 2013
-
104-107
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 25. Oktober 2013
-
107-116
Gesamtsitzung am 26. Oktober 2013
- 116-132 Öffentliche Gesamtsitzung an der Universität Ulm am 14. Dezember 2013
- 133-162 Veranstaltungen
-
163-190
Antrittsreden
-
191-202
Nachrufe
-
60-63
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 25. Januar 2013
-
203-281
II. Die Forschungsvorhaben
- 203-206 Verzeichnis der Forschungsvorhaben und der Arbeitsstellenleiter
-
207-281
Tätigkeitsberichte
- 207-209 1. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)
- 210-215 2. The Role of Culture in Early Expansions of Humans (Frankfurt/Tübingen)
- 216-219 3. Historische und rezente Hochwasserkonflikte an Rhein, Elbe und Donau im Spannungsfeld von Naturwissenschaft, Technik und Sozialökologie (Stuttgart)
- 220-222 4. Deutsche Inschriften des Mittelalters
- 223-227 5. Deutsches Rechtswörterbuch
- 228-229 6. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch/DEAF
- 230-233 7. Wörterbuch der altgaskognischen Urkundensprache/DAG
- 234-236 8. Melanchthon-Briefwechsel
- 237-238 9. Martin Bucers Deutsche Schriften
- 239-240 10. Evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts
- 241-244 11. Europa Humanistica
- 245-248 12. Epigraphische Datenbank römischer Inschriften
- 249-252 13. Edition literarischer Keilschrifttexte aus Assur
- 253-256 14. Buddhistische Steininschriften in Nord-China
- 257-260 15. Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jahrhundert
- 261-263 16. Nietzsche-Kommentar (Freiburg)
- 264-266 17. Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle (Heidelberg/Dresden)
- 267-271 18. Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens (Tübingen)
- 272-275 19. Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (Freiburg)
- 276-278 20. Kommentierung und Gesamtedition der Werke von Karl Jaspers sowie Edition der Briefe und des Nachlasses in Auswahl
- 279-281 21. Historisch-philologischer Kommentar zur Chronik des Johannes Malalas
- 282-333 III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
-
334-335
IV. Internationale wissenschaftliche Kooperation
- 336-337 Verein zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 338-350 Anhang
328
FÖRDERUNG DES WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHSES
Semantik und Ähnlichkeit
Mit der Untersuchung von Rezeptionsverhältnissen nähern wir uns der viel weite-
ren Fragestellung wie thematisch und stilistisch ähnliche Bilder gruppiert werden
können. Von der durchgezeichneten Kopie bis zur Gattungen und Epochen über-
schreitenden Allusion kann hier die Wahrnehmungsfähigkeit des Computers erprobt
werden, um dann semantisch nahestehende Werke ohne direktes Rezeptionsverhält-
nis hinzuzunehmen. Um ähnliche Bilder oder Objekte zu finden, entwickelte die
Arbeitsgruppe einen Prototypen, der im kommenden Jahr als Webapplikation zur
Verfügung gestellt werden soll.
Die ikonographische Forschung hat sich bemüht, die Semantik von Bildern
thematisch, motivgeschichtlich und attributiv zu erfassen. Innerhalb dieses Rasters
ist der Gestaltungsspielraum des Künstlers dennoch weit. Im Rahmen der Arbeits-
gruppe müssen daher von Seite der Kunstgeschichte Bildcorpora bereitgestellt wer-
den, die eine schrittweise Annäherung an die Semantik zulassen. Damit soll nicht
zuletzt der Bildgebrauch in der Computer Vision kritisch reflektiert werden. Die
gemeinhin verwendeten Bilddatenbanken stellen anspruchsvolle Testszenarien dar,
didaktische Lerninhalte sind sie hingegen weniger. Die pointierte Repräsentation
der Wirklichkeit in vielen Kunstwerken soll hier einen neuen Ansatz liefern.
Die Arbeitsgruppe verfolgt zum einen die Entwicklung eines leistungsfähigen
automatischen Systems zur Objekterkennung und Analyse von großen geisteswis-
senschaftlichen Bilddatensätzen, das die Geisteswissenschaften in Ihrer alltäglichen
Arbeit entscheidend unterstützen soll. Gleichzeitig ergeben sich aus dieser Anwen-
dung neue Herausforderungen für die informatische Grundlagenforschung in Com-
puterVision bei der Formrepräsentation, Segmentierung und Objektdetektion.
Die beiden Fächer Kunstgeschichte und Informatik werden innerhalb der
Arbeitsgruppe grundlegende Fragen zum Bildverstehen, zu Formen und zur kom-
positionellen Objektrepräsentation von ihrem jeweils eigenen und einem interdiszi-
plinären Standpunkt aus beleuchten.
FÖRDERUNG DES WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHSES
Semantik und Ähnlichkeit
Mit der Untersuchung von Rezeptionsverhältnissen nähern wir uns der viel weite-
ren Fragestellung wie thematisch und stilistisch ähnliche Bilder gruppiert werden
können. Von der durchgezeichneten Kopie bis zur Gattungen und Epochen über-
schreitenden Allusion kann hier die Wahrnehmungsfähigkeit des Computers erprobt
werden, um dann semantisch nahestehende Werke ohne direktes Rezeptionsverhält-
nis hinzuzunehmen. Um ähnliche Bilder oder Objekte zu finden, entwickelte die
Arbeitsgruppe einen Prototypen, der im kommenden Jahr als Webapplikation zur
Verfügung gestellt werden soll.
Die ikonographische Forschung hat sich bemüht, die Semantik von Bildern
thematisch, motivgeschichtlich und attributiv zu erfassen. Innerhalb dieses Rasters
ist der Gestaltungsspielraum des Künstlers dennoch weit. Im Rahmen der Arbeits-
gruppe müssen daher von Seite der Kunstgeschichte Bildcorpora bereitgestellt wer-
den, die eine schrittweise Annäherung an die Semantik zulassen. Damit soll nicht
zuletzt der Bildgebrauch in der Computer Vision kritisch reflektiert werden. Die
gemeinhin verwendeten Bilddatenbanken stellen anspruchsvolle Testszenarien dar,
didaktische Lerninhalte sind sie hingegen weniger. Die pointierte Repräsentation
der Wirklichkeit in vielen Kunstwerken soll hier einen neuen Ansatz liefern.
Die Arbeitsgruppe verfolgt zum einen die Entwicklung eines leistungsfähigen
automatischen Systems zur Objekterkennung und Analyse von großen geisteswis-
senschaftlichen Bilddatensätzen, das die Geisteswissenschaften in Ihrer alltäglichen
Arbeit entscheidend unterstützen soll. Gleichzeitig ergeben sich aus dieser Anwen-
dung neue Herausforderungen für die informatische Grundlagenforschung in Com-
puterVision bei der Formrepräsentation, Segmentierung und Objektdetektion.
Die beiden Fächer Kunstgeschichte und Informatik werden innerhalb der
Arbeitsgruppe grundlegende Fragen zum Bildverstehen, zu Formen und zur kom-
positionellen Objektrepräsentation von ihrem jeweils eigenen und einem interdiszi-
plinären Standpunkt aus beleuchten.