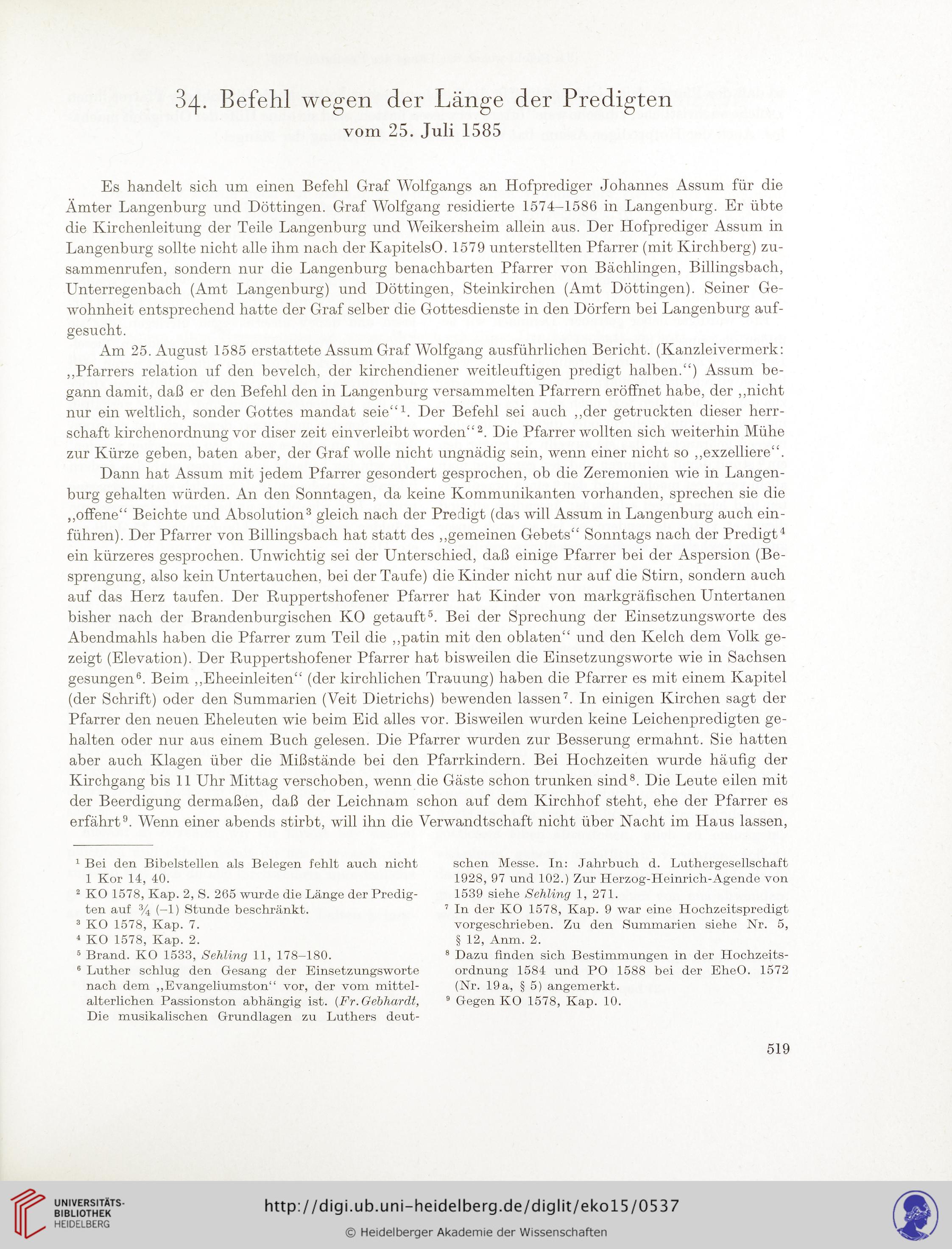34. Befehl wegen der Länge der Predigten
vom 25. Juli 1585
Es handelt sich nm einen Befehl Graf Wolfgangs an Hofprediger Johannes Assum für die
Ämter Langenburg und Döttingen. Graf Wolfgang residierte 1574-1586 in Langenburg. Er übte
die Kirchenleitung der Teile Langenburg und Weikersheim allein aus. Der Hofprediger Assum in
Langenburg sollte nicht alle ihm nach der KapitelsO. 1579 unterstellten Pfarrer (mit Kirchberg) zu-
sammenrufen, sondern nur die Langenburg benachbarten Pfarrer von Bächlingen, Billingsbach,
Unterregenbach (Amt Langenburg) und Döttingen, Steinkirchen (Amt Döttingen). Seiner Ge-
wohnheit entsprechend hatte der Graf selber die Gottesdienste in den Dörfern bei Langenburg auf-
gesucht.
iVm 25. August 1585 erstattete Assum Graf Wolfgang ausführlichen Bericht. (Kanzleivermerk:
,,Pfarrers relation uf den bevelch, der kirchendiener weitleuftigen predigt halben.“) Assum be-
gann damit, daß er den Befehl den in Langenburg versammelten Pfarrern eröffnet habe, der ,,nicht
nur ein weltlich, sonder Gottes mandat seie“ 1. Der Befehl sei auch ,,der getruckten dieser herr-
schaft kirchenordnung vor diser zeit einverleibt worden“ 2. Die Pfarrer wollten sich weiterhin Mühe
zur Kürze geben, baten aber, der Graf wolle nicht ungnädig sein, wenn einer nicht so „exzelliere“.
Dann hat Assum mit jedem Pfarrer gesondert gesprochen, ob die Zeremonien wie in Langen-
burg gehalten würden. An den Sonntagen, da keine Kommunikanten vorhanden, sprechen sie die
„offene“ Beichte und Absolution 3 gleich nach der Predigt (clas will Assum in Langenburg auch ein-
führen). Der Pfarrer von Billingsbach hat statt des „gemeinen Gebets“ Sonntags nach der Predigt 4
ein kürzeres gesprochen. Unwichtig sei der Unterschied, daß einige Pfarrer bei der Aspersion (Be-
sprengung, also kein Untertauchen, bei derTaufe) dieKinder nicht nur auf die Stirn, sondern auch
auf das Herz taufen. Der Ruppertshofener Pfarrer hat Kinder von markgräfischen Untertanen
bisher nach der Brandenburgischen KO getauft 5. Bei der Sprechung der Einsetzungsworte des
Abendmahls haben die Pfarrer zum Teil die „patin mit den oblaten“ und den Kelch dem Volk ge-
zeigt (Elevation). Der Ruppertshofener Pfarrer hat bisweilen die Einsetzungsworte wie in Sachsen
gesungen 6. Beim „Eheeinleiten“ (der kirchlichen Trauung) haben die Pfarrer es mit einem Kapitel
(der Schrift) oder den Summarien (Veit Dietrichs) bewenden lassen 7. In einigen Kirchen sagt der
Pfarrer den neuen Eheleuten wie beim Eid alles vor. Bisweilen wurden keine Leichenpredigten ge-
halten oder nur aus einem Buch gelesen. Die Pfarrer wurden zur Besserung ermahnt. Sie hatten
aber auch Klagen über die Mißstände bei den Pfarrkindern. Bei Hochzeiten wurde häufig der
Kirchgang bis 11 Uhr Mittag verschoben, wenn die Gäste schon trunken sind 8. Die Leute eilen mit
der Beerdigung dermaßen, daß der Leichnam schon auf dem Kirchhof steht, ehe der Pfarrer es
erfährt 9. Wenn einer abends stirbt, will ihn die Verwandtschaft nicht über Nacht im Haus lassen,
1 Bei den Bibelstellen als Belegen fehlt auch nicht
1 Kor 14, 40.
2 KO 1578, Kap. 2, S. 265 wurde die Länge der Predig-
ten auf % (-1) Stunde beschränkt.
3 KO 1578, Kap. 7.
4 KO 1578, Kap. 2.
5 Brand. KO 1533, Sehling 11, 178-180.
6 Luther schlug den Gesang der Einsetzungsworte
nach dem „Evangeliumston“ vor, der vom mittel-
alterlichen Passionston abhängig ist. (Fr.Oehhardt,
Die musikalischen Grundlagen zu Luthers deut-
schen Messe. In: Jahrbuch d. Luthergesellschaft
1928, 97 und 102.) Zur Herzog-Heinrich-Agende von
1539 siehe Sehling 1, 271.
7 In der KO 1578, Kap. 9 war eine Hochzeitspredigt
vorgeschrieben. Zu den Summarien siehe Nr. 5,
§ 12, Anm. 2.
8 Dazu finden sich Bestimmungen in der Hochzeits-
ordnung 1584 und PO 1588 bei der EheO. 1572
(Nr. 19a, § 5) angemerkt.
9 Gegen KO 1578, Kap. 10.
519
vom 25. Juli 1585
Es handelt sich nm einen Befehl Graf Wolfgangs an Hofprediger Johannes Assum für die
Ämter Langenburg und Döttingen. Graf Wolfgang residierte 1574-1586 in Langenburg. Er übte
die Kirchenleitung der Teile Langenburg und Weikersheim allein aus. Der Hofprediger Assum in
Langenburg sollte nicht alle ihm nach der KapitelsO. 1579 unterstellten Pfarrer (mit Kirchberg) zu-
sammenrufen, sondern nur die Langenburg benachbarten Pfarrer von Bächlingen, Billingsbach,
Unterregenbach (Amt Langenburg) und Döttingen, Steinkirchen (Amt Döttingen). Seiner Ge-
wohnheit entsprechend hatte der Graf selber die Gottesdienste in den Dörfern bei Langenburg auf-
gesucht.
iVm 25. August 1585 erstattete Assum Graf Wolfgang ausführlichen Bericht. (Kanzleivermerk:
,,Pfarrers relation uf den bevelch, der kirchendiener weitleuftigen predigt halben.“) Assum be-
gann damit, daß er den Befehl den in Langenburg versammelten Pfarrern eröffnet habe, der ,,nicht
nur ein weltlich, sonder Gottes mandat seie“ 1. Der Befehl sei auch ,,der getruckten dieser herr-
schaft kirchenordnung vor diser zeit einverleibt worden“ 2. Die Pfarrer wollten sich weiterhin Mühe
zur Kürze geben, baten aber, der Graf wolle nicht ungnädig sein, wenn einer nicht so „exzelliere“.
Dann hat Assum mit jedem Pfarrer gesondert gesprochen, ob die Zeremonien wie in Langen-
burg gehalten würden. An den Sonntagen, da keine Kommunikanten vorhanden, sprechen sie die
„offene“ Beichte und Absolution 3 gleich nach der Predigt (clas will Assum in Langenburg auch ein-
führen). Der Pfarrer von Billingsbach hat statt des „gemeinen Gebets“ Sonntags nach der Predigt 4
ein kürzeres gesprochen. Unwichtig sei der Unterschied, daß einige Pfarrer bei der Aspersion (Be-
sprengung, also kein Untertauchen, bei derTaufe) dieKinder nicht nur auf die Stirn, sondern auch
auf das Herz taufen. Der Ruppertshofener Pfarrer hat Kinder von markgräfischen Untertanen
bisher nach der Brandenburgischen KO getauft 5. Bei der Sprechung der Einsetzungsworte des
Abendmahls haben die Pfarrer zum Teil die „patin mit den oblaten“ und den Kelch dem Volk ge-
zeigt (Elevation). Der Ruppertshofener Pfarrer hat bisweilen die Einsetzungsworte wie in Sachsen
gesungen 6. Beim „Eheeinleiten“ (der kirchlichen Trauung) haben die Pfarrer es mit einem Kapitel
(der Schrift) oder den Summarien (Veit Dietrichs) bewenden lassen 7. In einigen Kirchen sagt der
Pfarrer den neuen Eheleuten wie beim Eid alles vor. Bisweilen wurden keine Leichenpredigten ge-
halten oder nur aus einem Buch gelesen. Die Pfarrer wurden zur Besserung ermahnt. Sie hatten
aber auch Klagen über die Mißstände bei den Pfarrkindern. Bei Hochzeiten wurde häufig der
Kirchgang bis 11 Uhr Mittag verschoben, wenn die Gäste schon trunken sind 8. Die Leute eilen mit
der Beerdigung dermaßen, daß der Leichnam schon auf dem Kirchhof steht, ehe der Pfarrer es
erfährt 9. Wenn einer abends stirbt, will ihn die Verwandtschaft nicht über Nacht im Haus lassen,
1 Bei den Bibelstellen als Belegen fehlt auch nicht
1 Kor 14, 40.
2 KO 1578, Kap. 2, S. 265 wurde die Länge der Predig-
ten auf % (-1) Stunde beschränkt.
3 KO 1578, Kap. 7.
4 KO 1578, Kap. 2.
5 Brand. KO 1533, Sehling 11, 178-180.
6 Luther schlug den Gesang der Einsetzungsworte
nach dem „Evangeliumston“ vor, der vom mittel-
alterlichen Passionston abhängig ist. (Fr.Oehhardt,
Die musikalischen Grundlagen zu Luthers deut-
schen Messe. In: Jahrbuch d. Luthergesellschaft
1928, 97 und 102.) Zur Herzog-Heinrich-Agende von
1539 siehe Sehling 1, 271.
7 In der KO 1578, Kap. 9 war eine Hochzeitspredigt
vorgeschrieben. Zu den Summarien siehe Nr. 5,
§ 12, Anm. 2.
8 Dazu finden sich Bestimmungen in der Hochzeits-
ordnung 1584 und PO 1588 bei der EheO. 1572
(Nr. 19a, § 5) angemerkt.
9 Gegen KO 1578, Kap. 10.
519