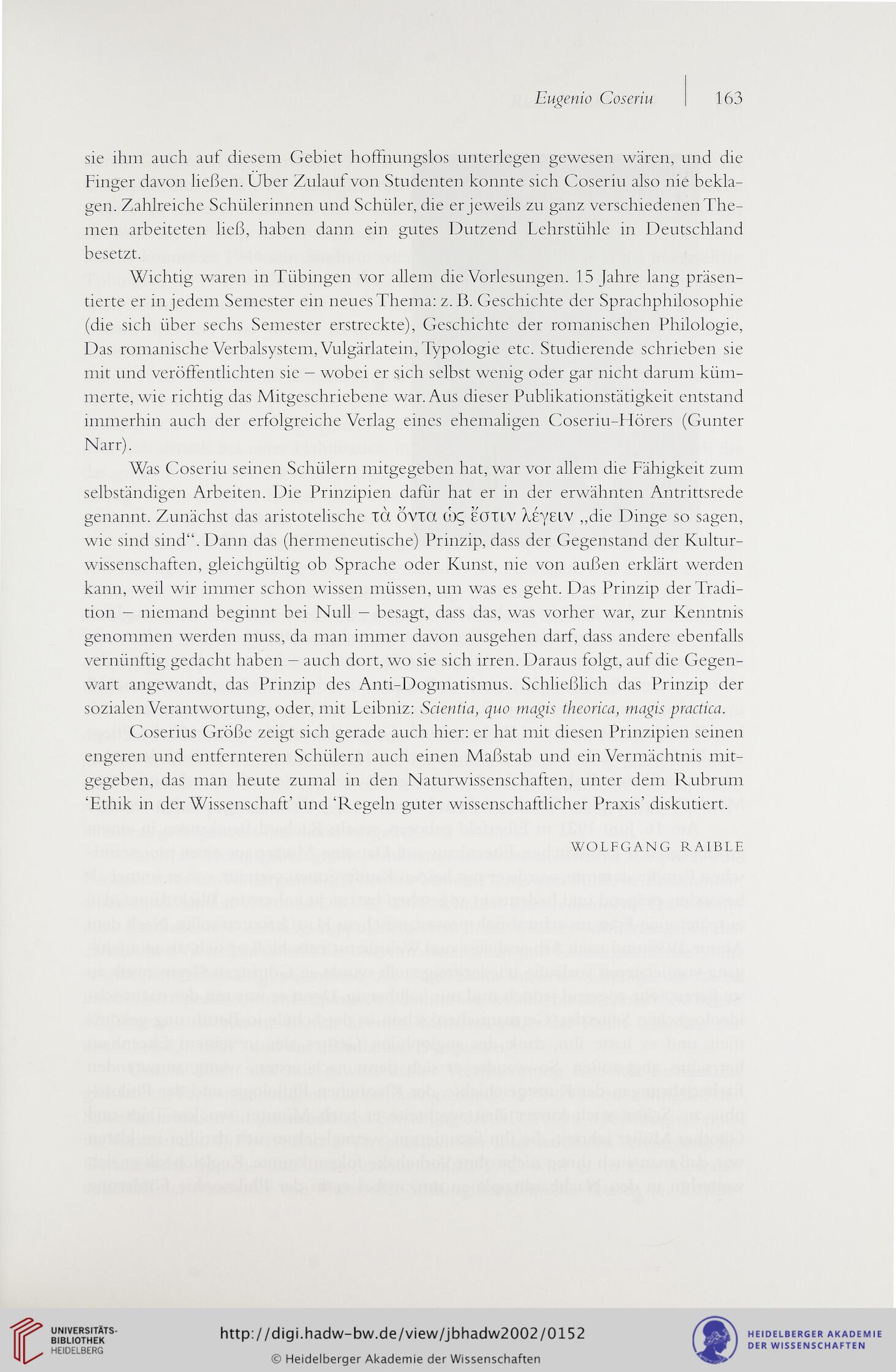Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2002
— 2003
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.66351#0152
DOI Kapitel:
I. Das Geschäftsjahr 2002
DOI Kapitel:Nachrufe
DOI Artikel:Raible, Wolfgang: Eugenio Coseriu (27.7.1921 - 7.9.2002)
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.66351#0152
- Schmutztitel
- Titelblatt
- 5-9 Inhaltsübersicht
- 10 Vorstand und Verwaltung der Akademie
- 11-27 Verzeichnis der Mitglieder der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 28 Tabula mortuorum
- 28 Vertreter der Akademie in wissenschaftlichen Institutionen
- 28 Verein zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
-
29-174
I. Das Geschäftsjahr 2002
- 29-50 Jahresfeier am 8. Juni 2002
-
51-105
Wissenschaftliche Sitzungen
-
51-54
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 26. Januar 2002
-
55-58
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 8. Februar 2002
-
58-61
Gesamtsitzung am 9. Februar 2002
-
62-67
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 27. April 2002
-
68-71
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 4. Mai 2002
-
71-77
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 7. Juni 2002
-
77-82
Gesamtsitzung am 15. Juni 2002
-
83-88
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 29. Juni 2002
- 88-94 Gesamtsitzung am 13. Juli 2002
- 94-100 Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 13. Juli 2001
-
100-101
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 9. November 2002
-
101-103
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 30. November 2002
-
103-105
Gesamtsitzung am 14. Dezember 2002
-
51-54
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 26. Januar 2002
- 106-110 Öffentliche Veranstaltungen
-
111-141
Antrittsreden
-
143-174
Nachrufe
-
175-245
II. Die Forschungsvorhaben
- 175-177 Verzeichnis der Forschungsvorhaben und der Arbeitsstellenleiter
- 178 Berichte über die Tätigkeit der Forschungsvorhaben
-
179-245
Die Forschungsvorhaben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 179-181 Interakademische Vorhaben
-
181-209
Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse
- 181-187 3. Archäometrie
- 187-194 4. Radiometrische Altersbestimmung von Wasser und Sedimenten
- 194-200 5. Weltkarte der tektonischen Spannungen
- 200-204 6. Anwendung der In-situ-Infrarotspektroskopie zur Minderung von Schadstoffemissionen
- 204-207 7. Mathematische Logik (Kaiserslautern)
- 208-209 8. Mathematische Kommission. Zentralblatt MATH
-
209-244
Philosophisch-historische Klasse
- 209-210 9. Deutsches Rechtswörterbuch
- 210-212 10. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch/DEAF
- 212-213 11. Altgaskognisches und Altokzitanisches Wörterbuch/DAG/DAO
- 213-215 12. Spanisches Wörterbuch des Mittelalters/DEM
- 216-221 13. Cusanus-Edition
- 222-223 14. Melanchthon-Briefwechsel
- 223-226 15. Martin Bucers Deutsche Schriften
- 226-227 16. Reuchlin-Briefwechsel (Pforzheim)
- 227-228 17. Luther-Register (Tübingen)
- 228-229 18. Evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts
- 229-231 19. Epigraphische Datenbank
- 231-233 20. Papyrus-Edition
- 233-234 21. Année Philologique
- 234-235 22. Internationale Kommission für die Erforschung der Vorgeschichte des Balkans
- 235-236 23. Heidelberger Antikensammlung
- 236-238 24. Lexikon der antiken Kulte und Riten (Heidelberg/Würzburg)
- 238-240 25. Felsbilder und Inschriften am Karakorum-Highway
- 241-243 26. Geschichte der Mannheimer Hofkapelle im 18. Jahrhundert
- 244 27. Geschichte der Universität Heidelberg
- 245 Von der Heidelberger Akademie wissenschaftlich betreute, aber anderweitig finanzierte Vorhaben
- 246-264 III. Förderung der wissenschaftlichen Nachwuchses: Das WIN-Kolleg
- 265 IV. Gesamthaushalt 2002 der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 266-267 Publikationen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften vom 1. 5. 2002 bis zum 28. 2. 2003
- 268-275 Personenregister
- Maßstab/Farbkeil
Eugenio Coseriu | 163
sie ihm auch auf diesem Gebiet hoffnungslos unterlegen gewesen wären, und die
Finger davon ließen. Uber Zulauf von Studenten konnte sich Coseriu also nie bekla-
gen. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die er jeweils zu ganz verschiedenen The-
men arbeiteten ließ, haben dann ein gutes Dutzend Lehrstühle in Deutschland
besetzt.
Wichtig waren in Tübingen vor allem die Vorlesungen. 15 Jahre lang präsen-
tierte er in jedem Semester ein neues Thema: z. B. Geschichte der Sprachphilosophie
(die sich über sechs Semester erstreckte), Geschichte der romanischen Philologie,
Das romanische Verbalsystem, Vulgärlatein, Typologie etc. Studierende schrieben sie
mit und veröffentlichten sie — wobei er sich selbst wenig oder gar nicht darum küm-
merte, wie richtig das Mitgeschriebene war. Aus dieser Publikationstätigkeit entstand
immerhin auch der erfolgreiche Verlag eines ehemaligen Coseriu-Hörers (Gunter
Narr).
Was Coseriu seinen Schülern mitgegeben hat, war vor allem die Fähigkeit zum
selbständigen Arbeiten. Die Prinzipien dafür hat er in der erwähnten Antrittsrede
genannt. Zunächst das aristotelische TOt OVTtt cbg EGTIV XsyElV „die Dinge so sagen,
wie sind sind“. Dann das (hermeneutische) Prinzip, dass der Gegenstand der Kultur-
wissenschaften, gleichgültig ob Sprache oder Kunst, nie von außen erklärt werden
kann, weil wir immer schon wissen müssen, um was es geht. Das Prinzip der Tradi-
tion - niemand beginnt bei Null — besagt, dass das, was vorher war, zur Kenntnis
genommen werden muss, da man immer davon ausgehen darf, dass andere ebenfalls
vernünftig gedacht haben — auch dort, wo sie sich irren. Daraus folgt, auf die Gegen-
wart angewandt, das Prinzip des Anti-Dogmatismus. Schließlich das Prinzip der
sozialen Verantwortung, oder, mit Leibniz: Scientia, quo magis theorica, magis practica.
Coserius Größe zeigt sich gerade auch hier: er hat mit diesen Prinzipien seinen
engeren und entfernteren Schülern auch einen Maßstab und em Vermächtnis mit-
gegeben, das man heute zumal in den Naturwissenschaften, unter dem Rubrum
‘Ethik in der Wissenschaft’ und ‘Regeln guter wissenschaftlicher Praxis’ diskutiert.
WOLFGANG RAIBLE
sie ihm auch auf diesem Gebiet hoffnungslos unterlegen gewesen wären, und die
Finger davon ließen. Uber Zulauf von Studenten konnte sich Coseriu also nie bekla-
gen. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die er jeweils zu ganz verschiedenen The-
men arbeiteten ließ, haben dann ein gutes Dutzend Lehrstühle in Deutschland
besetzt.
Wichtig waren in Tübingen vor allem die Vorlesungen. 15 Jahre lang präsen-
tierte er in jedem Semester ein neues Thema: z. B. Geschichte der Sprachphilosophie
(die sich über sechs Semester erstreckte), Geschichte der romanischen Philologie,
Das romanische Verbalsystem, Vulgärlatein, Typologie etc. Studierende schrieben sie
mit und veröffentlichten sie — wobei er sich selbst wenig oder gar nicht darum küm-
merte, wie richtig das Mitgeschriebene war. Aus dieser Publikationstätigkeit entstand
immerhin auch der erfolgreiche Verlag eines ehemaligen Coseriu-Hörers (Gunter
Narr).
Was Coseriu seinen Schülern mitgegeben hat, war vor allem die Fähigkeit zum
selbständigen Arbeiten. Die Prinzipien dafür hat er in der erwähnten Antrittsrede
genannt. Zunächst das aristotelische TOt OVTtt cbg EGTIV XsyElV „die Dinge so sagen,
wie sind sind“. Dann das (hermeneutische) Prinzip, dass der Gegenstand der Kultur-
wissenschaften, gleichgültig ob Sprache oder Kunst, nie von außen erklärt werden
kann, weil wir immer schon wissen müssen, um was es geht. Das Prinzip der Tradi-
tion - niemand beginnt bei Null — besagt, dass das, was vorher war, zur Kenntnis
genommen werden muss, da man immer davon ausgehen darf, dass andere ebenfalls
vernünftig gedacht haben — auch dort, wo sie sich irren. Daraus folgt, auf die Gegen-
wart angewandt, das Prinzip des Anti-Dogmatismus. Schließlich das Prinzip der
sozialen Verantwortung, oder, mit Leibniz: Scientia, quo magis theorica, magis practica.
Coserius Größe zeigt sich gerade auch hier: er hat mit diesen Prinzipien seinen
engeren und entfernteren Schülern auch einen Maßstab und em Vermächtnis mit-
gegeben, das man heute zumal in den Naturwissenschaften, unter dem Rubrum
‘Ethik in der Wissenschaft’ und ‘Regeln guter wissenschaftlicher Praxis’ diskutiert.
WOLFGANG RAIBLE