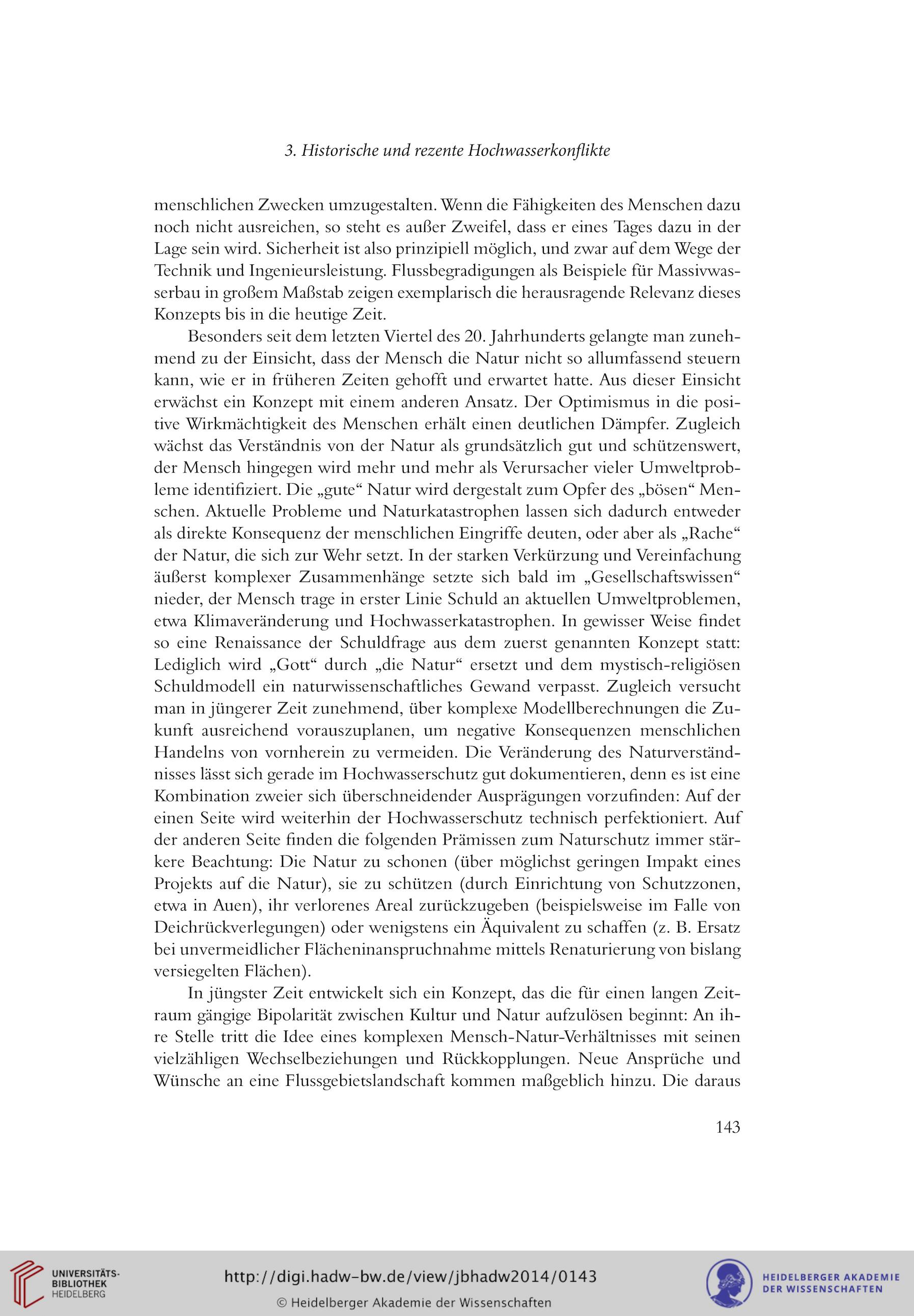3. Historische und rezente Hochwasserkonflikte
menschlichen Zwecken umzugestalten. Wenn die Fähigkeiten des Menschen dazu
noch nicht ausreichen, so steht es außer Zweifel, dass er eines Tages dazu in der
Lage sein wird. Sicherheit ist also prinzipiell möglich, und zwar auf dem Wege der
Technik und Ingenieursleistung. Flussbegradigungen als Beispiele für Massivwas-
serbau in großem Maßstab zeigen exemplarisch die herausragende Relevanz dieses
Konzepts bis in die heutige Zeit.
Besonders seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts gelangte man zuneh-
mend zu der Einsicht, dass der Mensch die Natur nicht so allumfassend steuern
kann, wie er in früheren Zeiten gehofft und erwartet hatte. Aus dieser Einsicht
eiwächst ein Konzept mit einem anderen Ansatz. Der Optimismus in die posi-
tive Wirkmächtigkeit des Menschen erhält einen deutlichen Dämpfer. Zugleich
wächst das Verständnis von der Natur als grundsätzlich gut und schützenswert,
der Mensch hingegen wird mehr und mehr als Verursacher vieler Umweltprob-
leme identifiziert. Die „gute“ Natur wird dergestalt zum Opfer des „bösen“ Men-
schen. Aktuelle Probleme und Naturkatastrophen lassen sich dadurch entweder
als direkte Konsequenz der menschlichen Eingriffe deuten, oder aber als „Rache“
der Natur, die sich zur Wehr setzt. In der starken Verkürzung und Vereinfachung
äußerst komplexer Zusammenhänge setzte sich bald im „Gesellschaftswissen“
nieder, der Mensch trage in erster Linie Schuld an aktuellen Umweltproblemen,
etwa Klimaveränderung und Hochwasserkatastrophen. In gewisser Weise findet
so eine Renaissance der Schuldfrage aus dem zuerst genannten Konzept statt:
Lediglich wird „Gott“ durch „die Natur“ ersetzt und dem mystisch-religiösen
Schuldmodell ein natuiwissenschaftliches Gewand verpasst. Zugleich versucht
man in jüngerer Zeit zunehmend, über komplexe Modellberechnungen die Zu-
kunft ausreichend vorauszuplanen, um negative Konsequenzen menschlichen
Handelns von vornherein zu vermeiden. Die Veränderung des Naturverständ-
nisses lässt sich gerade im Hochwasserschutz gut dokumentieren, denn es ist eine
Kombination zweier sich überschneidender Ausprägungen vorzufinden: Auf der
einen Seite wird weiterhin der Hochwasserschutz technisch perfektioniert. Auf
der anderen Seite finden die folgenden Prämissen zum Naturschutz immer stär-
kere Beachtung: Die Natur zu schonen (über möglichst geringen Impakt eines
Projekts auf die Natur), sie zu schützen (durch Einrichtung von Schutzzonen,
etwa in Auen), ihr verlorenes Areal zurückzugeben (beispielsweise im Falle von
Deichrückverlegungen) oder wenigstens ein Äquivalent zu schaffen (z. B. Ersatz
bei unvermeidlicher Flächeninanspruchnahme mittels Renaturierung von bislang
versiegelten Flächen).
In jüngster Zeit entwickelt sich ein Konzept, das die für einen langen Zeit-
raum gängige Bipolarität zwischen Kultur und Natur aufzulösen beginnt: An ih-
re Stelle tritt die Idee eines komplexen Mensch-Natur-Verhältnisses mit seinen
vielzähligen Wechselbeziehungen und Rückkopplungen. Neue Ansprüche und
Wünsche an eine Flussgebietslandschaft kommen maßgeblich hinzu. Die daraus
143
menschlichen Zwecken umzugestalten. Wenn die Fähigkeiten des Menschen dazu
noch nicht ausreichen, so steht es außer Zweifel, dass er eines Tages dazu in der
Lage sein wird. Sicherheit ist also prinzipiell möglich, und zwar auf dem Wege der
Technik und Ingenieursleistung. Flussbegradigungen als Beispiele für Massivwas-
serbau in großem Maßstab zeigen exemplarisch die herausragende Relevanz dieses
Konzepts bis in die heutige Zeit.
Besonders seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts gelangte man zuneh-
mend zu der Einsicht, dass der Mensch die Natur nicht so allumfassend steuern
kann, wie er in früheren Zeiten gehofft und erwartet hatte. Aus dieser Einsicht
eiwächst ein Konzept mit einem anderen Ansatz. Der Optimismus in die posi-
tive Wirkmächtigkeit des Menschen erhält einen deutlichen Dämpfer. Zugleich
wächst das Verständnis von der Natur als grundsätzlich gut und schützenswert,
der Mensch hingegen wird mehr und mehr als Verursacher vieler Umweltprob-
leme identifiziert. Die „gute“ Natur wird dergestalt zum Opfer des „bösen“ Men-
schen. Aktuelle Probleme und Naturkatastrophen lassen sich dadurch entweder
als direkte Konsequenz der menschlichen Eingriffe deuten, oder aber als „Rache“
der Natur, die sich zur Wehr setzt. In der starken Verkürzung und Vereinfachung
äußerst komplexer Zusammenhänge setzte sich bald im „Gesellschaftswissen“
nieder, der Mensch trage in erster Linie Schuld an aktuellen Umweltproblemen,
etwa Klimaveränderung und Hochwasserkatastrophen. In gewisser Weise findet
so eine Renaissance der Schuldfrage aus dem zuerst genannten Konzept statt:
Lediglich wird „Gott“ durch „die Natur“ ersetzt und dem mystisch-religiösen
Schuldmodell ein natuiwissenschaftliches Gewand verpasst. Zugleich versucht
man in jüngerer Zeit zunehmend, über komplexe Modellberechnungen die Zu-
kunft ausreichend vorauszuplanen, um negative Konsequenzen menschlichen
Handelns von vornherein zu vermeiden. Die Veränderung des Naturverständ-
nisses lässt sich gerade im Hochwasserschutz gut dokumentieren, denn es ist eine
Kombination zweier sich überschneidender Ausprägungen vorzufinden: Auf der
einen Seite wird weiterhin der Hochwasserschutz technisch perfektioniert. Auf
der anderen Seite finden die folgenden Prämissen zum Naturschutz immer stär-
kere Beachtung: Die Natur zu schonen (über möglichst geringen Impakt eines
Projekts auf die Natur), sie zu schützen (durch Einrichtung von Schutzzonen,
etwa in Auen), ihr verlorenes Areal zurückzugeben (beispielsweise im Falle von
Deichrückverlegungen) oder wenigstens ein Äquivalent zu schaffen (z. B. Ersatz
bei unvermeidlicher Flächeninanspruchnahme mittels Renaturierung von bislang
versiegelten Flächen).
In jüngster Zeit entwickelt sich ein Konzept, das die für einen langen Zeit-
raum gängige Bipolarität zwischen Kultur und Natur aufzulösen beginnt: An ih-
re Stelle tritt die Idee eines komplexen Mensch-Natur-Verhältnisses mit seinen
vielzähligen Wechselbeziehungen und Rückkopplungen. Neue Ansprüche und
Wünsche an eine Flussgebietslandschaft kommen maßgeblich hinzu. Die daraus
143