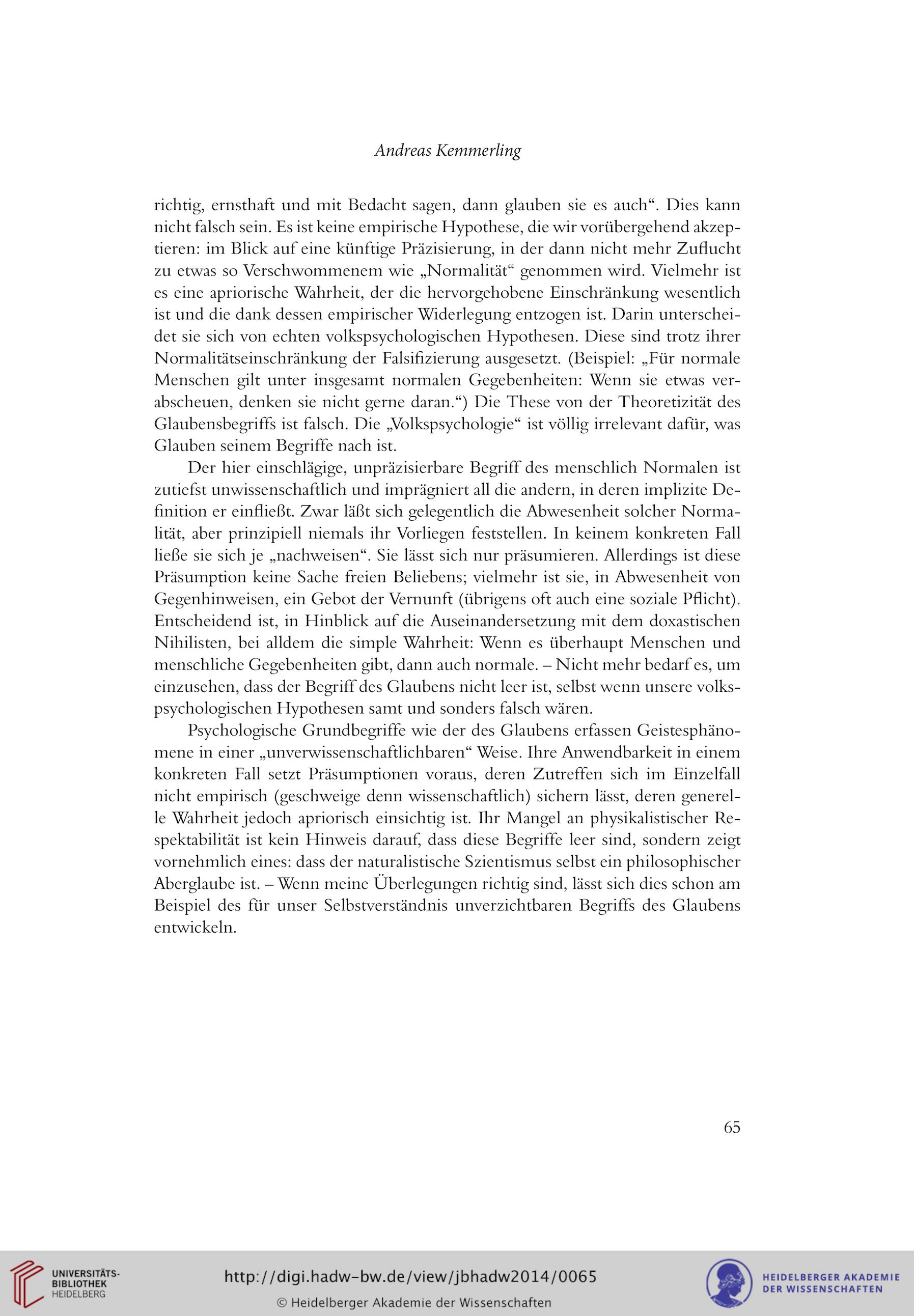Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2014
— 2015
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.55654#0065
DOI Kapitel:
A. Das akademische Jahr 2014
DOI Kapitel:II. Wissenschaftliche Vorträge
DOI Artikel:Kemmerling, Andreas: Menschliches Glauben und unser Begriff von ihm: Sitzung der Philosophisch-historischen Klasse am 24. Oktober 2014
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.55654#0065
- Schmutztitel
- Titelblatt
- Geleitwort
- 7-12 Inhaltsverzeichnis
- 13-128 A. Das akademische Jahr 2014
-
129-228
B. Die Forschungsvorhaben
- 129-130 I. Forschungsvorhaben und Arbeitsstellenleiter
-
131-225
II. Tätigkeitsberichte
- 131-132 1. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)
- 133-141 2. The Role of Culture in Early Expansions of Humans (Frankfurt und Tübingen)
- 141-145 3. Historische und rezente Hochwasserkonflikte an Rhein, Elbe und Donau im Spannungsfeld von Naturwissenschaft, Technik und Sozialökologie (Stuttgart)
- 145-148 4. Deutsche Inschriften des Mittelalters
- 149-151 5. Wörterbuch der altgaskognischen Urkundensprache/Dictionnaire onomasiologique de l’ancien gascon (DAG)
- 151-156 6. Deutsches Rechtswörterbuch
- 156-158 7. Martin Bucers Deutsche Schriften
- 158-162 8. Melanchthon-Briefwechsel
- 162-167 9. Dictionnaire étymologique de l’ancien français (DEAF)/Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch
- 167-171 10. Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH)
- 172-175 11. Evangelische Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts
- 175-181 12. Edition literarischer Keilschrifttexte aus Assur
- 181-187 13. Buddhistische Steininschriften in Nordchina
- 187-192 14. Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jahrhundert
- 193-196 15. Nietzsche-Kommentar (Freiburg)
- 196-199 16. Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle
- 200-207 17. Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens (Tübingen)
- 207-210 18. Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (Freiburg)
- 210-216 19. Kommentierung und Gesamtedition der Werke von Karl Jaspers sowie Edition der Briefe und des Nachlasses in Auswahl
- 216-219 20. Historisch-philologischer Kommentar zur Chronik des Johannes Malalas (Tübingen)
- 219-225 21. Religions- und rechtsgeschichtliche Quellen des vormodernen Nepal
- 226-228 III. Archivierung der Materialien abgeschlossener Forschungsvorhaben
-
229-309
C. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- 229-233 I. Die Preisträger
-
234-302
II. Das WIN-Kolleg
- 234-235 Aufgaben und Ziele
- 236-238 Verzeichnis der WIN-Kollegiaten
- 239 Fünfter Forschungsschwerpunkt „Neue Wege der Verflechtung von Natur‑ und Geisteswissenschaften“
-
251
Sechster Forschungsschwerpunkt „Messen und Verstehen der Welt durch die Wissenschaft“
- 251 3. Analyzing, Measuring and Forecasting Financial Risks by means of High-Frequency Data
- 252-257 4. Das menschliche Spiegelneuronensystem: Wie erfassen wir, was wir nicht messen können?
- 257-259 5. Geld, Gunst und Gnade. Die Monetarisierung der Politik im 12. und 13. Jahrhundert
- 259-264 6. Neogeographie einer Digitalen Erde: Geo-Informatik als methodische Brücke in der interdisziplinären Naturgefahrenanalyse (NEOHAZ)
- 264-267 7. Quantifizierung und Operationalisierung der Verhältnismäßigkeit von internationalen und interlokalen Sanktionen
- 267-269 8. Selbstregulierung in den Naturwissenschaften
- 270-275 9. Texte messen – Messungen interpretieren. Altertumswissenschaften und Digital Humanities als zukunftsträchtige Symbiose
- 275-278 10. Vom corpus iuris zu den corpora iurum. Konzeption und Erschließung eines juristischen Referenzkorpus (JuReko)
- 278-281 11. Die Vermessung der Welt: Religiöse Deutung und empirische Quantifizierung im mittelalterlichen Europa
- 281-284 12. Wissen(schaft), Zahl und Macht
- 284-290 13. Thermischer Komfort und Schmerz: Verstehen von menschlicher Adaption an Störfaktoren durch die Kombination psychologischer, physikalischer und physiologischer Messungen und Messmethoden
- 291-293 14. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen und der Hämodynamik mittels modell- und simulationsbasierter Fluss-MRI (CFD-MRI)
- 294-299 15. Zählen und Erzählen – Spielräume und Korrelationen quantitativer und qualitativer Welterschließung
- 300-302 16. Metaphern und Modelle. Zur Übersetzung von Wissen in Verstehen
- 303-309 III. Akademiekonferenzen
- 311-368 D. Antrittsreden, Nachrufe, Organe, Mitglieder
- 401-406 E. Anhang
- 407-415 Personenregister
Andreas Kemmerling
richtig, ernsthaft und mit Bedacht sagen, dann glauben sie es auch“. Dies kann
nicht falsch sein. Es ist keine empirische Hypothese, die wir vorübergehend akzep-
tieren: im Blick auf eine künftige Präzisierung, in der dann nicht mehr Zuflucht
zu etwas so Verschwommenem wie „Normalität“ genommen wird. Vielmehr ist
es eine apriorische Wahrheit, der die hervorgehobene Einschränkung wesentlich
ist und die dank dessen empirischer Widerlegung entzogen ist. Darin unterschei-
det sie sich von echten volkspsychologischen Hypothesen. Diese sind trotz ihrer
Normalitätseinschränkung der Falsifizierung ausgesetzt. (Beispiel: „Für normale
Menschen gilt unter insgesamt normalen Gegebenheiten: Wenn sie etwas ver-
abscheuen, denken sie nicht gerne daran.“) Die These von der Theoretizität des
Glaubensbegriffs ist falsch. Die „Volkspsychologie“ ist völlig irrelevant dafür, was
Glauben seinem Begriffe nach ist.
Der hier einschlägige, unpräzisierbare Begriff des menschlich Normalen ist
zutiefst unwissenschaftlich und imprägniert all die andern, in deren implizite De-
finition er einfließt. Zwar läßt sich gelegentlich die Abwesenheit solcher Norma-
lität, aber prinzipiell niemals ihr Vorliegen feststellen. In keinem konkreten Fall
ließe sie sich je „nachweisen“. Sie lässt sich nur präsumieren. Allerdings ist diese
Präsumption keine Sache freien Beliebens; vielmehr ist sie, in Abwesenheit von
Gegenhinweisen, ein Gebot der Vernunft (übrigens oft auch eine soziale Pflicht).
Entscheidend ist, in Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem doxastischen
Nihilisten, bei alldem die simple Wahrheit: Wenn es überhaupt Menschen und
menschliche Gegebenheiten gibt, dann auch normale. - Nicht mehr bedarf es, um
einzusehen, dass der Begriff des Glaubens nicht leer ist, selbst wenn unsere volks-
psychologischen Hypothesen samt und sonders falsch wären.
Psychologische Grundbegriffe wie der des Glaubens erfassen Geistesphäno-
mene in einer „unverwissenschaftlichbaren“ Weise. Ihre Anwendbarkeit in einem
konkreten Fall setzt Präsumptionen voraus, deren Zutreffen sich im Einzelfall
nicht empirisch (geschweige denn wissenschaftlich) sichern lässt, deren generel-
le Wahrheit jedoch apriorisch einsichtig ist. Ihr Mangel an physikalistischer Re-
spektabilität ist kein Hinweis darauf, dass diese Begriffe leer sind, sondern zeigt
vornehmlich eines: dass der naturalistische Szientismus selbst ein philosophischer
Aberglaube ist. - Wenn meine Überlegungen richtig sind, lässt sich dies schon am
Beispiel des für unser Selbstverständnis unverzichtbaren Begriffs des Glaubens
entwickeln.
65
richtig, ernsthaft und mit Bedacht sagen, dann glauben sie es auch“. Dies kann
nicht falsch sein. Es ist keine empirische Hypothese, die wir vorübergehend akzep-
tieren: im Blick auf eine künftige Präzisierung, in der dann nicht mehr Zuflucht
zu etwas so Verschwommenem wie „Normalität“ genommen wird. Vielmehr ist
es eine apriorische Wahrheit, der die hervorgehobene Einschränkung wesentlich
ist und die dank dessen empirischer Widerlegung entzogen ist. Darin unterschei-
det sie sich von echten volkspsychologischen Hypothesen. Diese sind trotz ihrer
Normalitätseinschränkung der Falsifizierung ausgesetzt. (Beispiel: „Für normale
Menschen gilt unter insgesamt normalen Gegebenheiten: Wenn sie etwas ver-
abscheuen, denken sie nicht gerne daran.“) Die These von der Theoretizität des
Glaubensbegriffs ist falsch. Die „Volkspsychologie“ ist völlig irrelevant dafür, was
Glauben seinem Begriffe nach ist.
Der hier einschlägige, unpräzisierbare Begriff des menschlich Normalen ist
zutiefst unwissenschaftlich und imprägniert all die andern, in deren implizite De-
finition er einfließt. Zwar läßt sich gelegentlich die Abwesenheit solcher Norma-
lität, aber prinzipiell niemals ihr Vorliegen feststellen. In keinem konkreten Fall
ließe sie sich je „nachweisen“. Sie lässt sich nur präsumieren. Allerdings ist diese
Präsumption keine Sache freien Beliebens; vielmehr ist sie, in Abwesenheit von
Gegenhinweisen, ein Gebot der Vernunft (übrigens oft auch eine soziale Pflicht).
Entscheidend ist, in Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem doxastischen
Nihilisten, bei alldem die simple Wahrheit: Wenn es überhaupt Menschen und
menschliche Gegebenheiten gibt, dann auch normale. - Nicht mehr bedarf es, um
einzusehen, dass der Begriff des Glaubens nicht leer ist, selbst wenn unsere volks-
psychologischen Hypothesen samt und sonders falsch wären.
Psychologische Grundbegriffe wie der des Glaubens erfassen Geistesphäno-
mene in einer „unverwissenschaftlichbaren“ Weise. Ihre Anwendbarkeit in einem
konkreten Fall setzt Präsumptionen voraus, deren Zutreffen sich im Einzelfall
nicht empirisch (geschweige denn wissenschaftlich) sichern lässt, deren generel-
le Wahrheit jedoch apriorisch einsichtig ist. Ihr Mangel an physikalistischer Re-
spektabilität ist kein Hinweis darauf, dass diese Begriffe leer sind, sondern zeigt
vornehmlich eines: dass der naturalistische Szientismus selbst ein philosophischer
Aberglaube ist. - Wenn meine Überlegungen richtig sind, lässt sich dies schon am
Beispiel des für unser Selbstverständnis unverzichtbaren Begriffs des Glaubens
entwickeln.
65