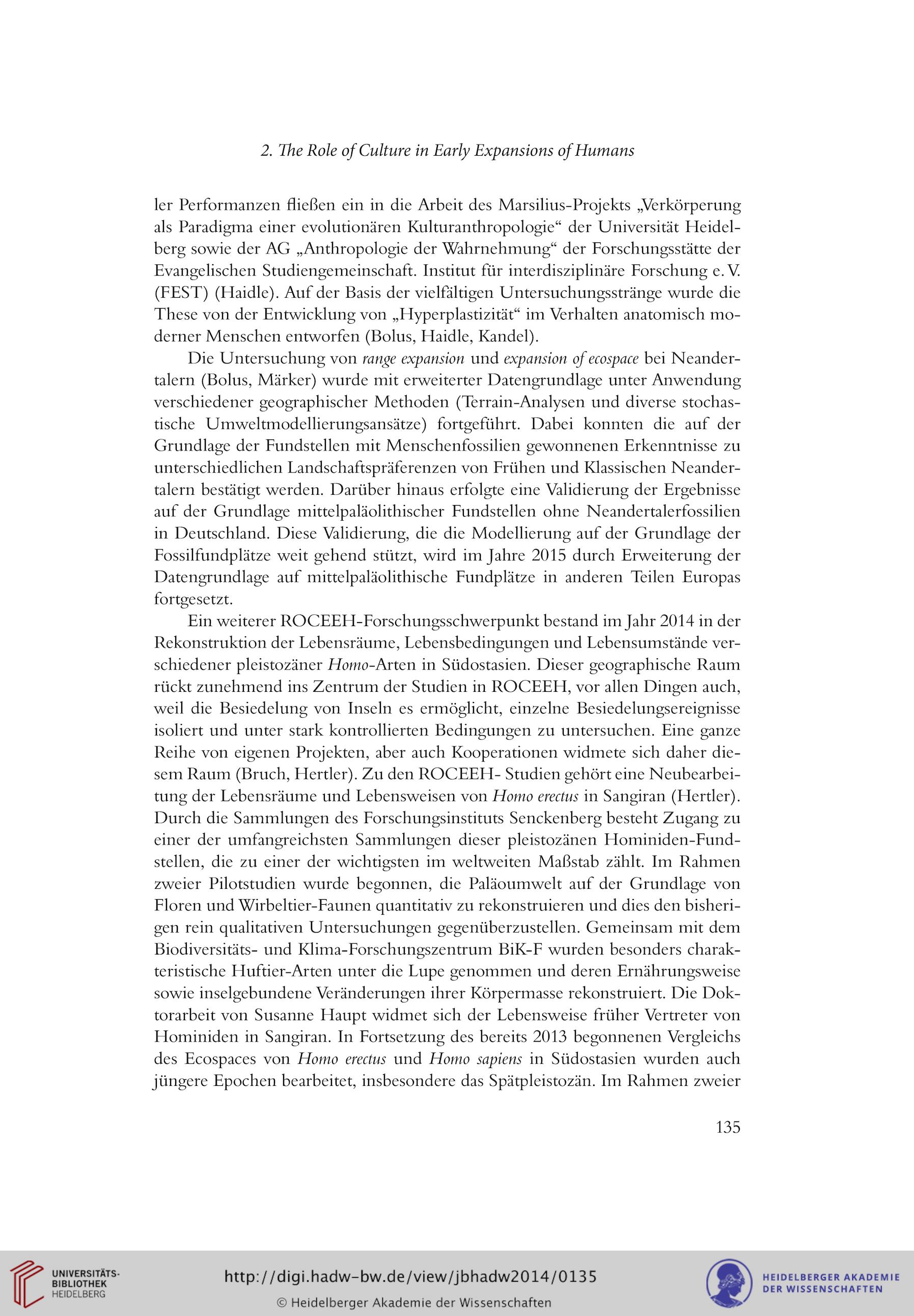2. The Role ofCulture in Early Expansions ofHumans
ler Performanzen fließen ein in die Arbeit des Marsilius-Projekts „Verkörperung
als Paradigma einer evolutionären Kulturanthropologie“ der Universität Heidel-
berg sowie der AG „Anthropologie der Wahrnehmung“ der Forschungsstätte der
Evangelischen Studiengemeinschaft. Institut für interdisziplinäre Forschung e.V
(FEST) (Haidle). Auf der Basis der vielfältigen Untersuchungsstränge wurde die
These von der Entwicklung von „Hyperplastizität“ im Verhalten anatomisch mo-
derner Menschen entworfen (Bolus, Haidle, Kandel).
Die Untersuchung von ränge expansion und expansion of ecospace bei Neander-
talern (Bolus, Märker) wurde mit erweiterter Datengrundlage unter Anwendung
verschiedener geographischer Methoden (Terrain-Analysen und diverse stochas-
tische Umweltmodellierungsansätze) fortgeführt. Dabei konnten die auf der
Grundlage der Fundstellen mit Menschenfossilien gewonnenen Erkenntnisse zu
unterschiedlichen Landschaftspräferenzen von Frühen und Klassischen Neander-
talern bestätigt werden. Darüber hinaus erfolgte eine Validierung der Ergebnisse
auf der Grundlage mitteIpaläolithischer Fundstellen ohne Neandertalerfossilien
in Deutschland. Diese Validierung, die die Modellierung auf der Grundlage der
Fossilfundplätze weit gehend stützt, wird im Jahre 2015 durch Eiweiterung der
Datengrundlage auf mittelpaläolithische Fundplätze in anderen Teilen Europas
fortgesetzt.
Ein weiterer ROCEEH-Forschungsschwerpunkt bestand im Jahr 2014 in der
Rekonstruktion der Lebensräume, Lebensbedingungen und Lebensumstände ver-
schiedener pleistozäner Homo-Arten in Südostasien. Dieser geographische Raum
rückt zunehmend ins Zentrum der Studien in ROCEEH, vor allen Dingen auch,
weil die Besiedelung von Inseln es ermöglicht, einzelne Besiedelungsereignisse
isoliert und unter stark kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Eine ganze
Reihe von eigenen Projekten, aber auch Kooperationen widmete sich daher die-
sem Raum (Bruch, Herder). Zu den ROCEEH- Studien gehört eine Neubearbei-
tung der Lebensräume und Lebensweisen von Homo erectus in Sangiran (Herder).
Durch die Sammlungen des Forschungsinstituts Senckenberg besteht Zugang zu
einer der umfangreichsten Sammlungen dieser pleistozänen Hominiden-Fund-
stellen, die zu einer der wichtigsten im weltweiten Maßstab zählt. Im Rahmen
zweier Pilotstudien wurde begonnen, die Paläoumwelt auf der Grundlage von
Floren und Wirbeltier-Faunen quantitativ zu rekonstruieren und dies den bisheri-
gen rein qualitativen Untersuchungen gegenüberzustellen. Gemeinsam mit dem
Biodiversitäts- und Klima-Forschungszentrum BiK-F wurden besonders charak-
teristische Huftier-Arten unter die Lupe genommen und deren Ernährungsweise
sowie inselgebundene Veränderungen ihrer Körpermasse rekonstruiert. Die Dok-
torarbeit von Susanne Haupt widmet sich der Lebensweise früher Vertreter von
Hominiden in Sangiran. In Fortsetzung des bereits 2013 begonnenen Vergleichs
des Ecospaces von Homo erectus und Homo sapiens in Südostasien wurden auch
jüngere Epochen bearbeitet, insbesondere das Spätpleistozän. Im Rahmen zweier
135
ler Performanzen fließen ein in die Arbeit des Marsilius-Projekts „Verkörperung
als Paradigma einer evolutionären Kulturanthropologie“ der Universität Heidel-
berg sowie der AG „Anthropologie der Wahrnehmung“ der Forschungsstätte der
Evangelischen Studiengemeinschaft. Institut für interdisziplinäre Forschung e.V
(FEST) (Haidle). Auf der Basis der vielfältigen Untersuchungsstränge wurde die
These von der Entwicklung von „Hyperplastizität“ im Verhalten anatomisch mo-
derner Menschen entworfen (Bolus, Haidle, Kandel).
Die Untersuchung von ränge expansion und expansion of ecospace bei Neander-
talern (Bolus, Märker) wurde mit erweiterter Datengrundlage unter Anwendung
verschiedener geographischer Methoden (Terrain-Analysen und diverse stochas-
tische Umweltmodellierungsansätze) fortgeführt. Dabei konnten die auf der
Grundlage der Fundstellen mit Menschenfossilien gewonnenen Erkenntnisse zu
unterschiedlichen Landschaftspräferenzen von Frühen und Klassischen Neander-
talern bestätigt werden. Darüber hinaus erfolgte eine Validierung der Ergebnisse
auf der Grundlage mitteIpaläolithischer Fundstellen ohne Neandertalerfossilien
in Deutschland. Diese Validierung, die die Modellierung auf der Grundlage der
Fossilfundplätze weit gehend stützt, wird im Jahre 2015 durch Eiweiterung der
Datengrundlage auf mittelpaläolithische Fundplätze in anderen Teilen Europas
fortgesetzt.
Ein weiterer ROCEEH-Forschungsschwerpunkt bestand im Jahr 2014 in der
Rekonstruktion der Lebensräume, Lebensbedingungen und Lebensumstände ver-
schiedener pleistozäner Homo-Arten in Südostasien. Dieser geographische Raum
rückt zunehmend ins Zentrum der Studien in ROCEEH, vor allen Dingen auch,
weil die Besiedelung von Inseln es ermöglicht, einzelne Besiedelungsereignisse
isoliert und unter stark kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Eine ganze
Reihe von eigenen Projekten, aber auch Kooperationen widmete sich daher die-
sem Raum (Bruch, Herder). Zu den ROCEEH- Studien gehört eine Neubearbei-
tung der Lebensräume und Lebensweisen von Homo erectus in Sangiran (Herder).
Durch die Sammlungen des Forschungsinstituts Senckenberg besteht Zugang zu
einer der umfangreichsten Sammlungen dieser pleistozänen Hominiden-Fund-
stellen, die zu einer der wichtigsten im weltweiten Maßstab zählt. Im Rahmen
zweier Pilotstudien wurde begonnen, die Paläoumwelt auf der Grundlage von
Floren und Wirbeltier-Faunen quantitativ zu rekonstruieren und dies den bisheri-
gen rein qualitativen Untersuchungen gegenüberzustellen. Gemeinsam mit dem
Biodiversitäts- und Klima-Forschungszentrum BiK-F wurden besonders charak-
teristische Huftier-Arten unter die Lupe genommen und deren Ernährungsweise
sowie inselgebundene Veränderungen ihrer Körpermasse rekonstruiert. Die Dok-
torarbeit von Susanne Haupt widmet sich der Lebensweise früher Vertreter von
Hominiden in Sangiran. In Fortsetzung des bereits 2013 begonnenen Vergleichs
des Ecospaces von Homo erectus und Homo sapiens in Südostasien wurden auch
jüngere Epochen bearbeitet, insbesondere das Spätpleistozän. Im Rahmen zweier
135