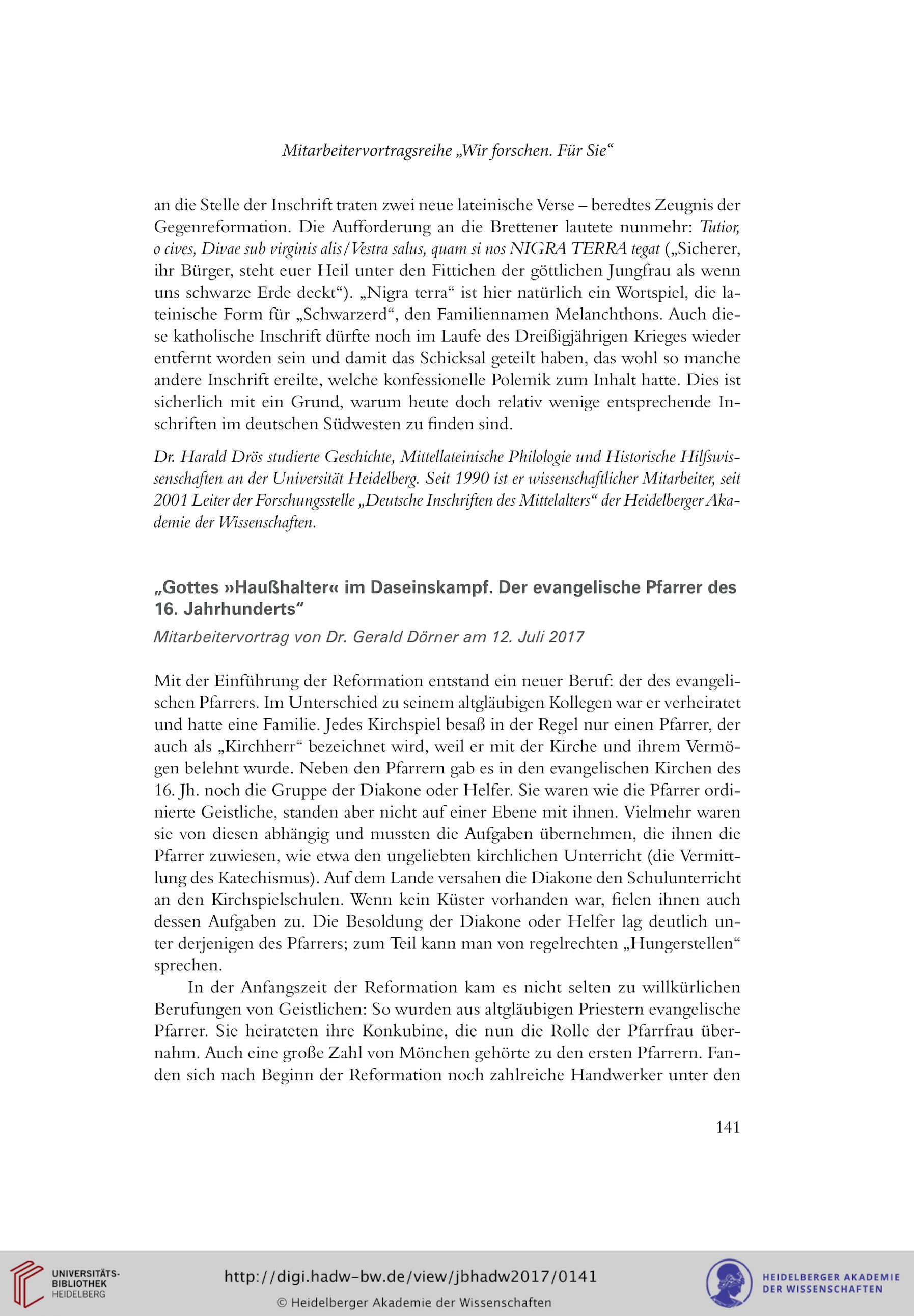Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2017
— 2018
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.55651#0141
DOI Kapitel:
A. Das akademische Jahr 2017
DOI Kapitel:III. Veranstaltungen
DOI Kapitel:Mitarbeitervortragsreihe „Wir forschen. Für Sie“
DOI Artikel:Drös, Harald: »O Herr behüt vor falscher Lehr.«: Die Reformation im Spiegel südwestdeutscher Inschriften
DOI Artikel:Dörner, Gerald: Gottes »Haußhalter« im Daseinskampf: der evangelische Pfarrer des 16. Jahrhunderts
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.55651#0141
- Schmutztitel
- Titelblatt
- 5-10 Inhaltsverzeichnis
- 11-176 A. Das akademische Jahr 2017
-
177-276
B. Die Forschungsvorhaben
- 177-178 I. Forschungsvorhaben und Arbeitsstellenleiter (Übersicht)
-
179-276
II. Tätigkeitsberichte (chronologisch)
- 179-182 1. Deutsche Inschriften des Mittelalters
- 183-186 2. Wörterbuch der altgaskognischen Urkundensprache (DAG)
- 186-191 3. Deutsches Rechtswörterbuch
- 191-193 4. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)
- 193-197 5. Melanchthon-Briefwechsel
- 197-201 6. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch (DEAF)
- 201-206 7. Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH)
- 207-209 8. Evangelische Kirchenordnungen des 16.Jahrhunderts
- 210-214 9. Edition literarischer Keilschrifttexte aus Assur
- 214-220 10. Buddhistische Steininschriften in Nordchina
- 220-225 11. Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18.Jahrhundert (Schwetzingen)
- 225-236 12. The Role of Culture in Early Expansions of Humans (Frankfurt/Tübingen)
- 236-241 13. Nietzsche-Kommentar (Freiburg i.Br.)
- 241-245 14. Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle (Heidelberg/Dresden)
- 246-252 15. Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens (Tübingen)
- 253-257 16. Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (Freiburg i.Br.)
- 257-261 17. Kommentierung und Gesamtedition der Werke von Karl Jaspers sowieEdition der Briefe und des Nachlasses in Auswahl
- 261-266 18. Historisch-philologischer Kommentar zur Chronik des Johannes Malalas (Tübingen)
- 266-272 19. Religions- und rechtsgeschichtliche Quellen des vormodernen Nepal
- 272-276 20. Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit (1550–1620)
-
277-355
C. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- 277-284 I. Die Preisträger
-
285-346
II. Das WIN-Kolleg
- 285-286 Aufgaben und Ziele des WIN-Kollegs
- 287 Verzeichnis der WIN-Kollegiaten
- 289-298 Fünfter Forschungsschwerpunkt „Neue Wege der Verflechtung von Natur- und Geisteswissenschaften“
-
299-346
Sechster Forschungsschwerpunkt„Messen und Verstehen der Welt durch die Wissenschaft“
- 299-301 3. Analyzing, Measuring and Forecasting Financial Risks by means of High-Frequency Data
- 302-305 4. Das menschliche Spiegelneuronensystem: Wie erfassen wir, was wir nicht messen können?
- 305-306 5. Geld, Gunst und Gnade. Die Monetarisierung der Politik im 12. und 13. Jahrhundert
- 306-308 6. Neogeographie einer Digitalen Erde: Geo-Informatik als methodische Brücke in der interdisziplinären Naturgefahren-analyse (NEOHAZ)
- 309-312 7. Quantifizierung in Politik und Recht am Beispiel von Wirtschaftssanktionen
- 313-317 8. Europäischer Datenschutz und Datentausch in der genetischen Forschung: interdisziplinäre Bedingungen und internationale Implikationen
- 317-321 9. Der „digital turn“ in den Altertumswissenschaften: Wahrnehmung – Dokumentation – Reflexion
- 322-325 10. Computergestützte Rechtslinguistik (CAL²) – Zu einer Digitalen Forschungs- und Experimentierplattform zur Analyse juristischer Semantik
- 325-327 11. Die Vermessung der Welt: Religiöse Deutung und empirische Quantifizierung im mittelalterlichen Europa
- 327-331 12. „Working Numbers“: Science and Contemporary Politics
- 331-338 13. Thermischer Komfort und Schmerz – Wechselwirkung zwischen Methode und Interpretation
- 338-342 14. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen und der Hämodynamik mittels modell- und simulationsbasierter Fluss-MRI (CFD-MRI): Qualitative Analyse des Genauigkeitsgewinns der kombinierten Methode
- 342-345 15. Zählen und Erzählen. Spielräume und Korrelationen quantitativer und qualitativer Welterschließung im Spannungsfeld von wissenschaftlichem Objekt und Methode
- 345-346 16. Metaphern und Modelle – Zur Übersetzung von Wissen in Verstehen
- 347-355 III. Konferenzen
- 357-420 D. Antrittsreden, Nachrufe, Organe und Mitglieder
- 421-437 E. Anhang
- 429-437 Personenregister
Mitarbeitervortragsreihe „Wir forschen. Für Sie'
an die Stelle der Inschrift traten zwei neue lateinische Verse - beredtes Zeugnis der
Gegenreformation. Die Aufforderung an die Brettener lautete nunmehr: Tutior,
o cives, Divaesub virginis alis/Vestra salus, quam si nos NIGRA TERRA tegat („Sicherer,
ihr Bürger, steht euer Heil unter den Fittichen der göttlichen Jungfrau als wenn
uns schwarze Erde deckt“). „Nigra terra“ ist hier natürlich ein Wortspiel, die la-
teinische Form für „Schwarzerd“, den Familiennamen Melanchthons. Auch die-
se katholische Inschrift dürfte noch im Laufe des Dreißigjährigen Krieges wieder
entfernt worden sein und damit das Schicksal geteilt haben, das wohl so manche
andere Inschrift ereilte, welche konfessionelle Polemik zum Inhalt hatte. Dies ist
sicherlich mit ein Grund, warum heute doch relativ wenige entsprechende In-
schriften im deutschen Südwesten zu finden sind.
Dr. Harald Drös studierte Geschichte, Mittellateinische Philologie und Historische Hilfswis-
senschaften an der Universität Heidelberg. Seit 1990 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit
2001 Leiter der Forschungsstelle „Deutsche Inschriften des Mittelalters“ der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften.
„Gottes »Haußhalter« im Daseinskampf. Der evangelische Pfarrer des
16. Jahrhunderts"
Mitarbeitervortrag von Dr. Gerald Dörner am 12. Juii 2017
Mit der Einführung der Reformation entstand ein neuer Beruf: der des evangeli-
schen Pfarrers. Im Unterschied zu seinem altgläubigen Kollegen war er verheiratet
und hatte eine Familie. Jedes Kirchspiel besaß in der Regel nur einen Pfarrer, der
auch als „Kirchherr“ bezeichnet wird, weil er mit der Kirche und ihrem Vermö-
gen belehnt wurde. Neben den Pfarrern gab es in den evangelischen Kirchen des
16. Jh. noch die Gruppe der Diakone oder Helfer. Sie waren wie die Pfarrer ordi-
nierte Geistliche, standen aber nicht auf einer Ebene mit ihnen. Vielmehr waren
sie von diesen abhängig und mussten die Aufgaben übernehmen, die ihnen die
Pfarrer zuwiesen, wie etwa den ungeliebten kirchlichen Unterricht (die Vermitt-
lung des Katechismus). Auf dem Lande versahen die Diakone den Schulunterricht
an den Kirchspielschulen. Wenn kein Küster vorhanden war, fielen ihnen auch
dessen Aufgaben zu. Die Besoldung der Diakone oder Helfer lag deutlich un-
ter derjenigen des Pfarrers; zum Teil kann man von regelrechten „Hungerstellen“
sprechen.
In der Anfangszeit der Reformation kam es nicht selten zu willkürlichen
Berufungen von Geistlichen: So wurden aus altgläubigen Priestern evangelische
Pfarrer. Sie heirateten ihre Konkubine, die nun die Rolle der Pfarrfrau über-
nahm. Auch eine große Zahl von Mönchen gehörte zu den ersten Pfarrern. Fan-
den sich nach Beginn der Reformation noch zahlreiche Handwerker unter den
141
an die Stelle der Inschrift traten zwei neue lateinische Verse - beredtes Zeugnis der
Gegenreformation. Die Aufforderung an die Brettener lautete nunmehr: Tutior,
o cives, Divaesub virginis alis/Vestra salus, quam si nos NIGRA TERRA tegat („Sicherer,
ihr Bürger, steht euer Heil unter den Fittichen der göttlichen Jungfrau als wenn
uns schwarze Erde deckt“). „Nigra terra“ ist hier natürlich ein Wortspiel, die la-
teinische Form für „Schwarzerd“, den Familiennamen Melanchthons. Auch die-
se katholische Inschrift dürfte noch im Laufe des Dreißigjährigen Krieges wieder
entfernt worden sein und damit das Schicksal geteilt haben, das wohl so manche
andere Inschrift ereilte, welche konfessionelle Polemik zum Inhalt hatte. Dies ist
sicherlich mit ein Grund, warum heute doch relativ wenige entsprechende In-
schriften im deutschen Südwesten zu finden sind.
Dr. Harald Drös studierte Geschichte, Mittellateinische Philologie und Historische Hilfswis-
senschaften an der Universität Heidelberg. Seit 1990 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit
2001 Leiter der Forschungsstelle „Deutsche Inschriften des Mittelalters“ der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften.
„Gottes »Haußhalter« im Daseinskampf. Der evangelische Pfarrer des
16. Jahrhunderts"
Mitarbeitervortrag von Dr. Gerald Dörner am 12. Juii 2017
Mit der Einführung der Reformation entstand ein neuer Beruf: der des evangeli-
schen Pfarrers. Im Unterschied zu seinem altgläubigen Kollegen war er verheiratet
und hatte eine Familie. Jedes Kirchspiel besaß in der Regel nur einen Pfarrer, der
auch als „Kirchherr“ bezeichnet wird, weil er mit der Kirche und ihrem Vermö-
gen belehnt wurde. Neben den Pfarrern gab es in den evangelischen Kirchen des
16. Jh. noch die Gruppe der Diakone oder Helfer. Sie waren wie die Pfarrer ordi-
nierte Geistliche, standen aber nicht auf einer Ebene mit ihnen. Vielmehr waren
sie von diesen abhängig und mussten die Aufgaben übernehmen, die ihnen die
Pfarrer zuwiesen, wie etwa den ungeliebten kirchlichen Unterricht (die Vermitt-
lung des Katechismus). Auf dem Lande versahen die Diakone den Schulunterricht
an den Kirchspielschulen. Wenn kein Küster vorhanden war, fielen ihnen auch
dessen Aufgaben zu. Die Besoldung der Diakone oder Helfer lag deutlich un-
ter derjenigen des Pfarrers; zum Teil kann man von regelrechten „Hungerstellen“
sprechen.
In der Anfangszeit der Reformation kam es nicht selten zu willkürlichen
Berufungen von Geistlichen: So wurden aus altgläubigen Priestern evangelische
Pfarrer. Sie heirateten ihre Konkubine, die nun die Rolle der Pfarrfrau über-
nahm. Auch eine große Zahl von Mönchen gehörte zu den ersten Pfarrern. Fan-
den sich nach Beginn der Reformation noch zahlreiche Handwerker unter den
141