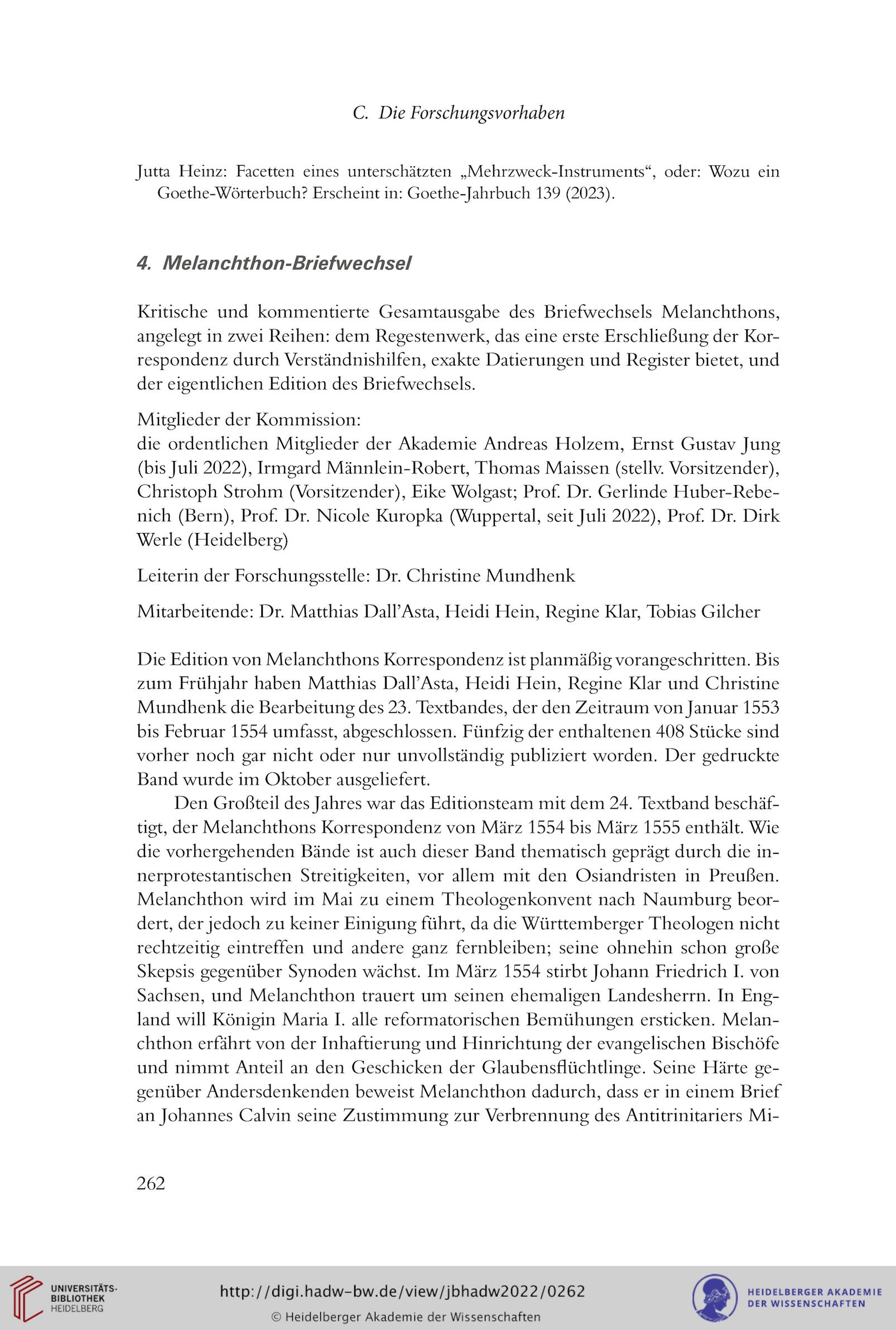Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2022
— 2023
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.67410#0262
DOI Kapitel:
C. Die Forschungsvorhaben
DOI Kapitel:II. Tätigkeitsberichte
DOI Kapitel:3. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)
DOI Kapitel:4. Melanchthon-Briefwechsel
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.67410#0262
- Schmutztitel
- Titelblatt
- 5-10 Inhaltsverzeichnis
-
11-172
A. Das akademische Jahr 2022
-
11-37
I. Jahresfeier am 21. Mai 2022
- 11-12 Begrüßung durch den Präsidenten Bernd Schneidmüller
- 13-15 Grußwort des Präsidenten der Akademie von Athen Antonios Rengakos
- 16-22 Verantwortung und das Prinzip von Wissenschaft. Bericht des Präsidenten
- 23-24 Kurzbericht des Sprechers des WIN-Kollegs Martin Fungisai Gerchen
- 36-37 Verleihung der Preise
-
38-101
II. Wissenschaftliche Vorträge
-
102-172
III. Veranstaltungen
- 102-106 Academy for Future – Klimakrise: Warum müssen wir jetzt handeln? Öffentliche Veranstaltungsreihe der Arbeitsgruppe „Klimakrise“
- 106-108 Akademievorträge. Gemeinsame Vortragsreihe der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit der Württembergischen Landesbibliothek
-
109-121
Mitarbeitervortragsreihe „Wir forschen. Für Sie“
- 126 Internationale Kooperation mit der Estnischen Akademie der Wissenschaften
-
127
Verleihung des Reuchlinpreises 2022 an die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur
- 147-151 Sebestyén, Ágnes; Weber, Andreas: Netzwerktreffen mit Postdoktorandinnen und Postdoktoranden des Eliteprogramms der Baden-Württemberg Stiftung. 14. und 15. November 2022
-
151-170
Verleihung des Karl-Jaspers-Preises 2022 an den Philosophen Volker Gerhardt
-
11-37
I. Jahresfeier am 21. Mai 2022
- 173-241 B. Die Mitglieder
-
243-356
C. Die Forschungsvorhaben
- 243-244 I. Forschungsvorhaben und Arbeitsstellenleitung
-
245-347
II. Tätigkeitsberichte
- 245-249 1. Deutsche Inschriften des Mittelalters
- 249-255 2. Deutsches Rechtswörterbuch
- 255-262 3. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)
- 262-265 4. Melanchthon-Briefwechsel
- 265-270 5. Edition literarischer Keilschrifttexte aus Assur
- 270-278 6. Buddhistische Steinschriften in Nordchina
- 278-293 7. The Role of Culture in Early Expansions of Humans (Frankfurt und Tübingen)
- 294-299 8. Nietzsche-Kommentar (Freiburg)
- 300-309 9. Klöster im Hochmittelalter
- 309-312 10. Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens (Tübingen)
- 313-316 11. Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (Freiburg im Breisgau)
- 317-320 12. Karl-Jaspers-Gesamtausgabe (KJG)
- 320-326 13. Historisch-philologischer Kommentar zur Weltchronik des Johannes Malalas
- 326-333 14. Religions- und rechtsgeschichtliche Quellen des vormodernen Nepal
- 333-339 15. Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit (1550–1620)
- 339-345 16. Hinduistische Tempellegenden in Südindien
- 345-347 17. Wissensnetze in der mittelalterlichen Romania (ALMA)
- 348-354 III. Drittmittelgeförderte Projekte
- 355-356 IV. Kooperationsprojekte
-
357-434
D. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- 357-372 I. Preise der Akademie
- 373 II. Die Junge Akademie | HAdW
- 374-376 III. Das WIN-Kolleg der Jungen Akademie | HAdW
- 414 IV. Das Akademie-Kolleg der Jungen Akademie | HAdW
-
435-455
E. Anhang
-
435-439
I. Organe, Mitglieder, Institutionen
- 435-436 Vorstand und Geschäftsstelle
- 436 Personalrat / Ombudsperson „Gute wissenschaftliche Praxis“ / Ombudsperson „Partnerschaftliches Miteinander“ / Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
- 437 Vertreter der Akademie in Kommissionen der Union / Vertreter der Akademie in anderen wissenschaftlichen Institutionen
- 438 Verein zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften e.V.
- 439 Tabula Mortuorum 2022
- 440 II. Gesamthaushalt 2022 der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 441-446 III. Publikationen
-
435-439
I. Organe, Mitglieder, Institutionen
- 447-455 Personenregister
C. Die Forschungsvorhaben
Jutta Heinz: Facetten eines unterschätzten „Mehrzweck-Instruments“, oder: Wozu ein
Goethe-Wörterbuch? Erscheint in: Goethe-Jahrbuch 139 (2023).
4. Melanchthon-Briefwechsel
Kritische und kommentierte Gesamtausgabe des Briefwechsels Melanchthons,
angelegt in zwei Reihen: dem Regestenwerk, das eine erste Erschließung der Kor-
respondenz durch Verständnishilfen, exakte Datierungen und Register bietet, und
der eigentlichen Edition des Briefwechsels.
Mitglieder der Kommission:
die ordentlichen Mitglieder der Akademie Andreas Holzem, Ernst Gustav Jung
(bis Juli 2022), Irmgard Männlein-Robert, Thomas Maissen (stellv. Vorsitzender),
Christoph Strohm (Vorsitzender), Eike Wolgast; Prof. Dr. Gerlinde Huber-Rebe-
nich (Bern), Prof. Dr. Nicole Kuropka (Wuppertal, seit Juli 2022), Prof Dr. Dirk
Werle (Eieideiberg)
Leiterin der Forschungsstelle: Dr. Christine Mundhenk
Mitarbeitende: Dr. Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, Regine Klar, Tobias Gilcher
Die Edition von Melanchthons Korrespondenz ist planmäßig vorangeschritten. Bis
zum Frühjahr haben Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, Regine Klar und Christine
Mundhenk die Bearbeitung des 23. Textbandes, der den Zeitraum von Januar 1553
bis Februar 1554 umfasst, abgeschlossen. Fünfzig der enthaltenen 408 Stücke sind
vorher noch gar nicht oder nur unvollständig publiziert worden. Der gedruckte
Band wurde im Oktober ausgeliefert.
Den Großteil des Jahres war das Editionsteam mit dem 24. Textband beschäf-
tigt, der Melanchthons Korrespondenz von März 1554 bis März 1555 enthält. Wie
die vorhergehenden Bände ist auch dieser Band thematisch geprägt durch die in-
nerprotestantischen Streitigkeiten, vor allem mit den Osiandristen in Preußen.
Melanchthon wird im Mai zu einem Theologenkonvent nach Naumburg beor-
dert, der jedoch zu keiner Einigung führt, da die Württemberger Theologen nicht
rechtzeitig eintreffen und andere ganz fernbleiben; seine ohnehin schon große
Skepsis gegenüber Synoden wächst. Im März 1554 stirbt Johann Friedrich I. von
Sachsen, und Melanchthon trauert um seinen ehemaligen Landesherrn. In Eng-
land will Königin Maria I. alle reformatorischen Bemühungen ersticken. Melan-
chthon erfährt von der Inhaftierung und Hinrichtung der evangelischen Bischöfe
und nimmt Anteil an den Geschicken der Glaubensflüchtlinge. Seine Härte ge-
genüber Andersdenkenden beweist Melanchthon dadurch, dass er in einem Brief
an Johannes Calvin seine Zustimmung zur Verbrennung des Antitrinitariers Mi-
262
Jutta Heinz: Facetten eines unterschätzten „Mehrzweck-Instruments“, oder: Wozu ein
Goethe-Wörterbuch? Erscheint in: Goethe-Jahrbuch 139 (2023).
4. Melanchthon-Briefwechsel
Kritische und kommentierte Gesamtausgabe des Briefwechsels Melanchthons,
angelegt in zwei Reihen: dem Regestenwerk, das eine erste Erschließung der Kor-
respondenz durch Verständnishilfen, exakte Datierungen und Register bietet, und
der eigentlichen Edition des Briefwechsels.
Mitglieder der Kommission:
die ordentlichen Mitglieder der Akademie Andreas Holzem, Ernst Gustav Jung
(bis Juli 2022), Irmgard Männlein-Robert, Thomas Maissen (stellv. Vorsitzender),
Christoph Strohm (Vorsitzender), Eike Wolgast; Prof. Dr. Gerlinde Huber-Rebe-
nich (Bern), Prof. Dr. Nicole Kuropka (Wuppertal, seit Juli 2022), Prof Dr. Dirk
Werle (Eieideiberg)
Leiterin der Forschungsstelle: Dr. Christine Mundhenk
Mitarbeitende: Dr. Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, Regine Klar, Tobias Gilcher
Die Edition von Melanchthons Korrespondenz ist planmäßig vorangeschritten. Bis
zum Frühjahr haben Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, Regine Klar und Christine
Mundhenk die Bearbeitung des 23. Textbandes, der den Zeitraum von Januar 1553
bis Februar 1554 umfasst, abgeschlossen. Fünfzig der enthaltenen 408 Stücke sind
vorher noch gar nicht oder nur unvollständig publiziert worden. Der gedruckte
Band wurde im Oktober ausgeliefert.
Den Großteil des Jahres war das Editionsteam mit dem 24. Textband beschäf-
tigt, der Melanchthons Korrespondenz von März 1554 bis März 1555 enthält. Wie
die vorhergehenden Bände ist auch dieser Band thematisch geprägt durch die in-
nerprotestantischen Streitigkeiten, vor allem mit den Osiandristen in Preußen.
Melanchthon wird im Mai zu einem Theologenkonvent nach Naumburg beor-
dert, der jedoch zu keiner Einigung führt, da die Württemberger Theologen nicht
rechtzeitig eintreffen und andere ganz fernbleiben; seine ohnehin schon große
Skepsis gegenüber Synoden wächst. Im März 1554 stirbt Johann Friedrich I. von
Sachsen, und Melanchthon trauert um seinen ehemaligen Landesherrn. In Eng-
land will Königin Maria I. alle reformatorischen Bemühungen ersticken. Melan-
chthon erfährt von der Inhaftierung und Hinrichtung der evangelischen Bischöfe
und nimmt Anteil an den Geschicken der Glaubensflüchtlinge. Seine Härte ge-
genüber Andersdenkenden beweist Melanchthon dadurch, dass er in einem Brief
an Johannes Calvin seine Zustimmung zur Verbrennung des Antitrinitariers Mi-
262