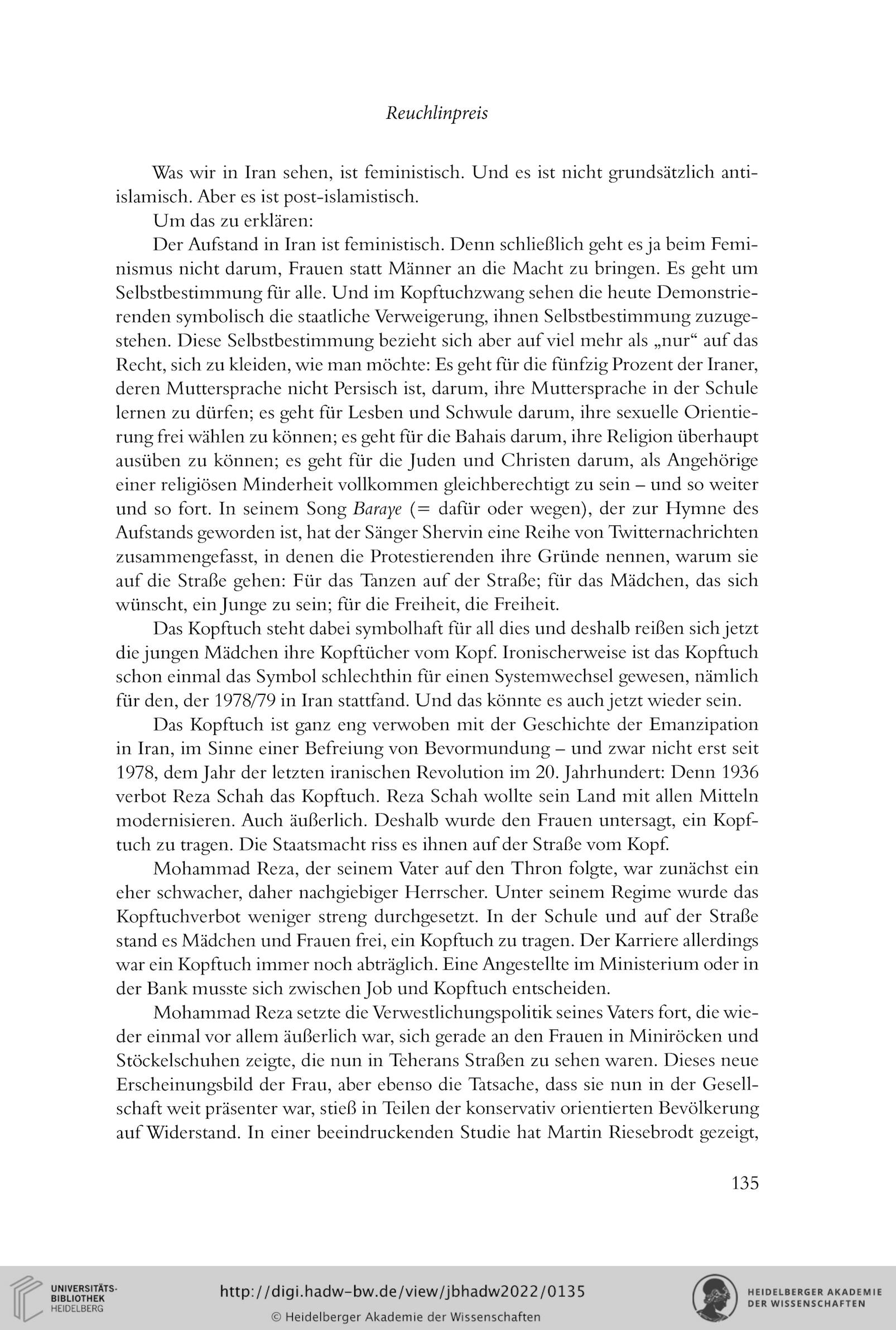Reuchlinpreis
Was wir in Iran sehen, ist feministisch. Und es ist nicht grundsätzlich anti-
islamisch. Aber es ist post-islamistisch.
Um das zu erklären:
Der Aufstand in Iran ist feministisch. Denn schließlich geht es ja beim Femi-
nismus nicht darum, Frauen statt Männer an die Macht zu bringen. Es geht um
Selbstbestimmung für alle. Und im Kopftuchzwang sehen die heute Demonstrie-
renden symbolisch die staatliche Verweigerung, ihnen Selbstbestimmung zuzuge-
stehen. Diese Selbstbestimmung bezieht sich aber auf viel mehr als „nur“ auf das
Recht, sich zu kleiden, wie man möchte: Es geht für die fünfzig Prozent der Iraner,
deren Muttersprache nicht Persisch ist, darum, ihre Muttersprache in der Schule
lernen zu dürfen; es geht für Lesben und Schwule darum, ihre sexuelle Orientie-
rung frei wählen zu können; es geht für die Bahais darum, ihre Religion überhaupt
ausüben zu können; es geht für die Juden und Christen darum, als Angehörige
einer religiösen Minderheit vollkommen gleichberechtigt zu sein - und so weiter
und so fort. In seinem Song Baraye ( — dafür oder wegen), der zur Hymne des
Aufstands geworden ist, hat der Sänger Shervin eine Reihe von Twitternachrichten
zusammengefasst, in denen die Protestierenden ihre Gründe nennen, warum sie
auf die Straße gehen: Für das Tanzen auf der Straße; für das Mädchen, das sich
wünscht, ein Junge zu sein; für die Freiheit, die Freiheit.
Das Kopftuch steht dabei symbolhaft für all dies und deshalb reißen sich jetzt
die jungen Mädchen ihre Kopftücher vom Kopf Ironischerweise ist das Kopftuch
schon einmal das Symbol schlechthin für einen Systemwechsel gewesen, nämlich
für den, der 1978/79 in Iran stattfand. Und das könnte es auch jetzt wieder sein.
Das Kopftuch ist ganz eng verwoben mit der Geschichte der Emanzipation
in Iran, im Sinne einer Befreiung von Bevormundung - und zwar nicht erst seit
1978, dem Jahr der letzten iranischen Revolution im 20. Jahrhundert: Denn 1936
verbot Reza Schah das Kopftuch. Reza Schah wollte sein Land mit allen Mitteln
modernisieren. Auch äußerlich. Deshalb wurde den Frauen untersagt, ein Kopf-
tuch zu tragen. Die Staatsmacht riss es ihnen auf der Straße vom Kopf.
Mohammad Reza, der seinem Vater auf den Thron folgte, war zunächst ein
eher schwacher, daher nachgiebiger Herrscher. Unter seinem Regime wurde das
Kopftuchverbot weniger streng durchgesetzt. In der Schule und aut der Straße
stand es Mädchen und Frauen frei, ein Kopftuch zu tragen. Der Karriere allerdings
war ein Kopftuch immer noch abträglich. Eine Angestellte im Ministerium oder in
der Bank musste sich zwischen Job und Kopftuch entscheiden.
Mohammad Reza setzte die Verwestlichungspolitik seines Vaters fort, die wie-
der einmal vor allem äußerlich war, sich gerade an den Frauen in Miniröcken und
Stöckelschuhen zeigte, die nun in Teherans Straßen zu sehen waren. Dieses neue
Erscheinungsbild der Frau, aber ebenso die Tatsache, dass sie nun in der Gesell-
schaft weit präsenter war, stieß in Teilen der konservativ orientierten Bevölkerung
auf Widerstand. In einer beeindruckenden Studie hat Martin Riesebrodt gezeigt,
135
Was wir in Iran sehen, ist feministisch. Und es ist nicht grundsätzlich anti-
islamisch. Aber es ist post-islamistisch.
Um das zu erklären:
Der Aufstand in Iran ist feministisch. Denn schließlich geht es ja beim Femi-
nismus nicht darum, Frauen statt Männer an die Macht zu bringen. Es geht um
Selbstbestimmung für alle. Und im Kopftuchzwang sehen die heute Demonstrie-
renden symbolisch die staatliche Verweigerung, ihnen Selbstbestimmung zuzuge-
stehen. Diese Selbstbestimmung bezieht sich aber auf viel mehr als „nur“ auf das
Recht, sich zu kleiden, wie man möchte: Es geht für die fünfzig Prozent der Iraner,
deren Muttersprache nicht Persisch ist, darum, ihre Muttersprache in der Schule
lernen zu dürfen; es geht für Lesben und Schwule darum, ihre sexuelle Orientie-
rung frei wählen zu können; es geht für die Bahais darum, ihre Religion überhaupt
ausüben zu können; es geht für die Juden und Christen darum, als Angehörige
einer religiösen Minderheit vollkommen gleichberechtigt zu sein - und so weiter
und so fort. In seinem Song Baraye ( — dafür oder wegen), der zur Hymne des
Aufstands geworden ist, hat der Sänger Shervin eine Reihe von Twitternachrichten
zusammengefasst, in denen die Protestierenden ihre Gründe nennen, warum sie
auf die Straße gehen: Für das Tanzen auf der Straße; für das Mädchen, das sich
wünscht, ein Junge zu sein; für die Freiheit, die Freiheit.
Das Kopftuch steht dabei symbolhaft für all dies und deshalb reißen sich jetzt
die jungen Mädchen ihre Kopftücher vom Kopf Ironischerweise ist das Kopftuch
schon einmal das Symbol schlechthin für einen Systemwechsel gewesen, nämlich
für den, der 1978/79 in Iran stattfand. Und das könnte es auch jetzt wieder sein.
Das Kopftuch ist ganz eng verwoben mit der Geschichte der Emanzipation
in Iran, im Sinne einer Befreiung von Bevormundung - und zwar nicht erst seit
1978, dem Jahr der letzten iranischen Revolution im 20. Jahrhundert: Denn 1936
verbot Reza Schah das Kopftuch. Reza Schah wollte sein Land mit allen Mitteln
modernisieren. Auch äußerlich. Deshalb wurde den Frauen untersagt, ein Kopf-
tuch zu tragen. Die Staatsmacht riss es ihnen auf der Straße vom Kopf.
Mohammad Reza, der seinem Vater auf den Thron folgte, war zunächst ein
eher schwacher, daher nachgiebiger Herrscher. Unter seinem Regime wurde das
Kopftuchverbot weniger streng durchgesetzt. In der Schule und aut der Straße
stand es Mädchen und Frauen frei, ein Kopftuch zu tragen. Der Karriere allerdings
war ein Kopftuch immer noch abträglich. Eine Angestellte im Ministerium oder in
der Bank musste sich zwischen Job und Kopftuch entscheiden.
Mohammad Reza setzte die Verwestlichungspolitik seines Vaters fort, die wie-
der einmal vor allem äußerlich war, sich gerade an den Frauen in Miniröcken und
Stöckelschuhen zeigte, die nun in Teherans Straßen zu sehen waren. Dieses neue
Erscheinungsbild der Frau, aber ebenso die Tatsache, dass sie nun in der Gesell-
schaft weit präsenter war, stieß in Teilen der konservativ orientierten Bevölkerung
auf Widerstand. In einer beeindruckenden Studie hat Martin Riesebrodt gezeigt,
135