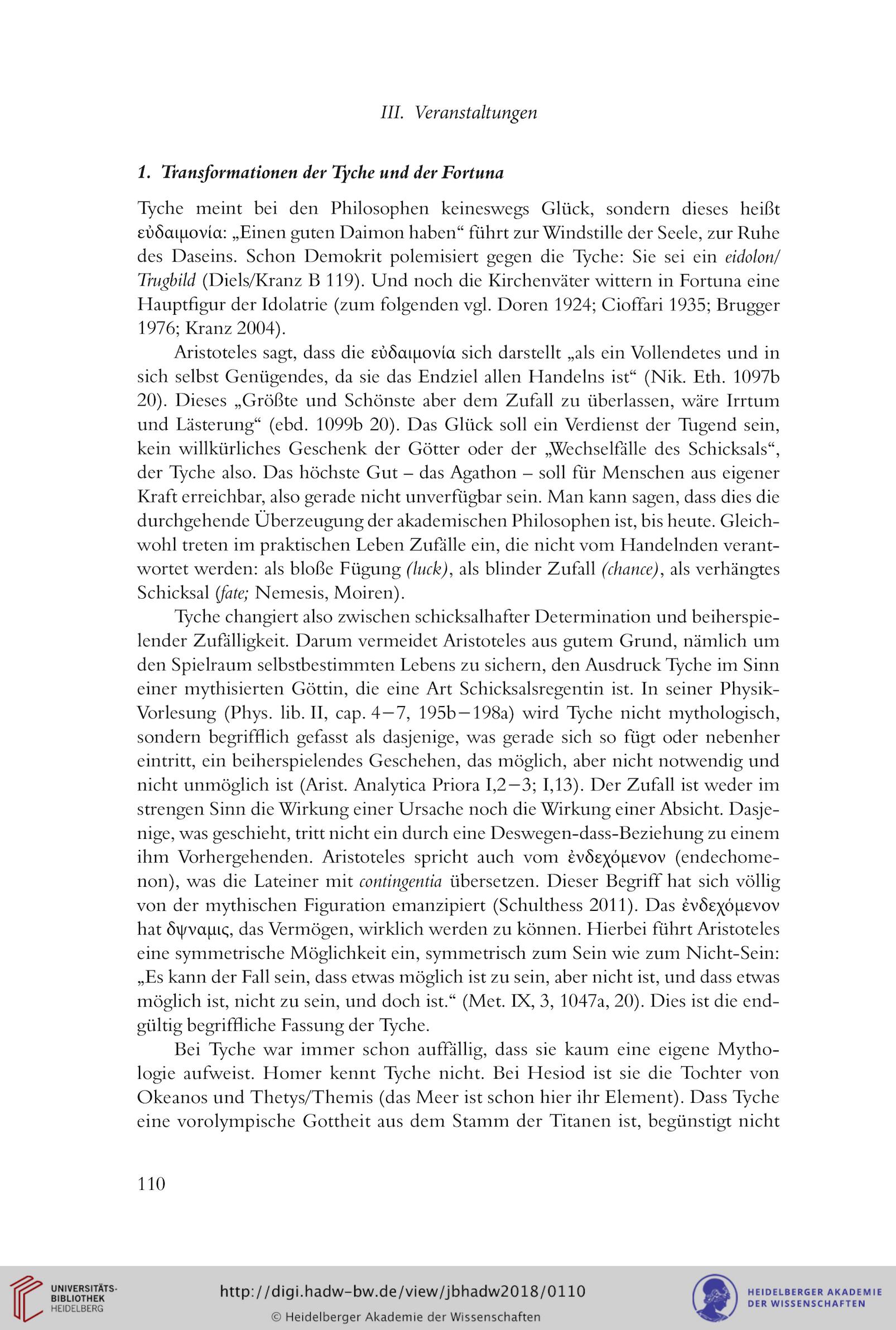III. Veranstaltungen
1. Transformationen der Ty ehe und der Fortuna
Tyche meint bei den Philosophen keineswegs Glück, sondern dieses heißt
cvöaipovia: „Einen guten Daimon haben“ führt zur Windstille der Seele, zur Ruhe
des Daseins. Schon Demokrit polemisiert gegen die Tyche: Sie sei ein eidolon/
Trugbild (Diels/Kranz B 119). Und noch die Kirchenväter wittern in Fortuna eine
Hauptfigur der Idolatrie (zum folgenden vgl. Doren 1924; Cioffari 1935; Brügger
1976; Kranz 2004).
Aristoteles sagt, dass die cüöaipovia sich darstellt „als ein Vollendetes und in
sich selbst Genügendes, da sie das Endziel allen Handelns ist“ (Nik. Eth. 1097b
20). Dieses „Größte und Schönste aber dem Zufall zu überlassen, wäre Irrtum
und Lästerung“ (ebd. 1099b 20). Das Glück soll ein Verdienst der Tugend sein,
kein willkürliches Geschenk der Götter oder der „Wechselfälle des Schicksals“,
der Tyche also. Das höchste Gut - das Agathon - soll für Menschen aus eigener
Kraft erreichbar, also gerade nicht unverfügbar sein. Man kann sagen, dass dies die
durchgehende Überzeugung der akademischen Philosophen ist, bis heute. Gleich-
wohl treten im praktischen Leben Zufälle ein, die nicht vom Handelnden verant-
wortet werden: als bloße Fügung (lack), als blinder Zufall (chance), als verhängtes
Schicksal (fate; Nemesis, Moiren).
Tyche changiert also zwischen schicksalhafter Determination und beiherspie-
lender Zufälligkeit. Darum vermeidet Aristoteles aus gutem Grund, nämlich um
den Spielraum selbstbestimmten Lebens zu sichern, den Ausdruck Tyche im Sinn
einer mythisierten Göttin, die eine Art Schicksalsregentin ist. In seiner Physik-
Vorlesung (Phys. lib. II, cap. 4 —7, 195b —198a) wird Tyche nicht mythologisch,
sondern begrifflich gefasst als dasjenige, was gerade sich so fügt oder nebenher
eintritt, ein beiherspielendes Geschehen, das möglich, aber nicht notwendig und
nicht unmöglich ist (Arist. Analytica Priora 1,2—3; 1,13). Der Zufall ist weder im
strengen Sinn die Wirkung einer Ursache noch die Wirkung einer Absicht. Dasje-
nige, was geschieht, tritt nicht ein durch eine Deswegen-dass-Beziehung zu einem
ihm Vorhergehenden. Aristoteles spricht auch vom £VÖ£\öp£vov (endechome-
non), was die Lateiner mit contingentia übersetzen. Dieser Begriff hat sich völlig
von der mythischen Figuration emanzipiert (Schulthess 2011). Das £v0£xog£vov
hat ö\(/vapic;, das Vermögen, wirklich werden zu können. Hierbei führt Aristoteles
eine symmetrische Möglichkeit ein, symmetrisch zum Sein wie zum Nicht-Sein:
„Es kann der Fall sein, dass etwas möglich ist zu sein, aber nicht ist, und dass etwas
möglich ist, nicht zu sein, und doch ist.“ (Met. IX, 3, 1047a, 20). Dies ist die end-
gültig begriffliche Fassung der Tyche.
Bei Tyche war immer schon auffällig, dass sie kaum eine eigene Mytho-
logie aufweist. Homer kennt Tyche nicht. Bei Hesiod ist sie die Tochter von
Okeanos und Thetys/Themis (das Meer ist schon hier ihr Element). Dass Tyche
eine vorolympische Gottheit aus dem Stamm der Titanen ist, begünstigt nicht
110
1. Transformationen der Ty ehe und der Fortuna
Tyche meint bei den Philosophen keineswegs Glück, sondern dieses heißt
cvöaipovia: „Einen guten Daimon haben“ führt zur Windstille der Seele, zur Ruhe
des Daseins. Schon Demokrit polemisiert gegen die Tyche: Sie sei ein eidolon/
Trugbild (Diels/Kranz B 119). Und noch die Kirchenväter wittern in Fortuna eine
Hauptfigur der Idolatrie (zum folgenden vgl. Doren 1924; Cioffari 1935; Brügger
1976; Kranz 2004).
Aristoteles sagt, dass die cüöaipovia sich darstellt „als ein Vollendetes und in
sich selbst Genügendes, da sie das Endziel allen Handelns ist“ (Nik. Eth. 1097b
20). Dieses „Größte und Schönste aber dem Zufall zu überlassen, wäre Irrtum
und Lästerung“ (ebd. 1099b 20). Das Glück soll ein Verdienst der Tugend sein,
kein willkürliches Geschenk der Götter oder der „Wechselfälle des Schicksals“,
der Tyche also. Das höchste Gut - das Agathon - soll für Menschen aus eigener
Kraft erreichbar, also gerade nicht unverfügbar sein. Man kann sagen, dass dies die
durchgehende Überzeugung der akademischen Philosophen ist, bis heute. Gleich-
wohl treten im praktischen Leben Zufälle ein, die nicht vom Handelnden verant-
wortet werden: als bloße Fügung (lack), als blinder Zufall (chance), als verhängtes
Schicksal (fate; Nemesis, Moiren).
Tyche changiert also zwischen schicksalhafter Determination und beiherspie-
lender Zufälligkeit. Darum vermeidet Aristoteles aus gutem Grund, nämlich um
den Spielraum selbstbestimmten Lebens zu sichern, den Ausdruck Tyche im Sinn
einer mythisierten Göttin, die eine Art Schicksalsregentin ist. In seiner Physik-
Vorlesung (Phys. lib. II, cap. 4 —7, 195b —198a) wird Tyche nicht mythologisch,
sondern begrifflich gefasst als dasjenige, was gerade sich so fügt oder nebenher
eintritt, ein beiherspielendes Geschehen, das möglich, aber nicht notwendig und
nicht unmöglich ist (Arist. Analytica Priora 1,2—3; 1,13). Der Zufall ist weder im
strengen Sinn die Wirkung einer Ursache noch die Wirkung einer Absicht. Dasje-
nige, was geschieht, tritt nicht ein durch eine Deswegen-dass-Beziehung zu einem
ihm Vorhergehenden. Aristoteles spricht auch vom £VÖ£\öp£vov (endechome-
non), was die Lateiner mit contingentia übersetzen. Dieser Begriff hat sich völlig
von der mythischen Figuration emanzipiert (Schulthess 2011). Das £v0£xog£vov
hat ö\(/vapic;, das Vermögen, wirklich werden zu können. Hierbei führt Aristoteles
eine symmetrische Möglichkeit ein, symmetrisch zum Sein wie zum Nicht-Sein:
„Es kann der Fall sein, dass etwas möglich ist zu sein, aber nicht ist, und dass etwas
möglich ist, nicht zu sein, und doch ist.“ (Met. IX, 3, 1047a, 20). Dies ist die end-
gültig begriffliche Fassung der Tyche.
Bei Tyche war immer schon auffällig, dass sie kaum eine eigene Mytho-
logie aufweist. Homer kennt Tyche nicht. Bei Hesiod ist sie die Tochter von
Okeanos und Thetys/Themis (das Meer ist schon hier ihr Element). Dass Tyche
eine vorolympische Gottheit aus dem Stamm der Titanen ist, begünstigt nicht
110