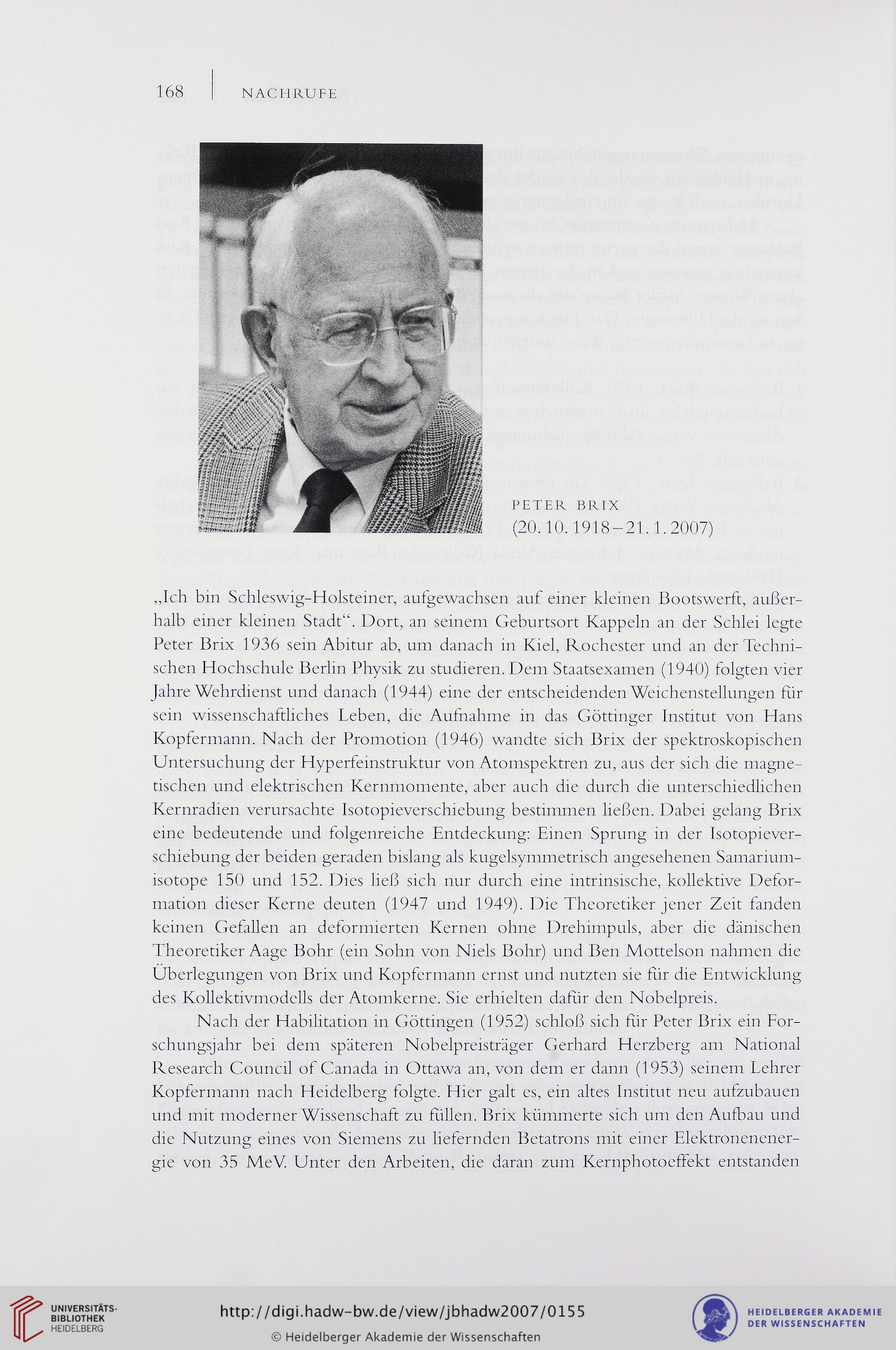Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2007
— 2007
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.66959#0155
DOI Kapitel:
I. Das Geschäftsjahr 2007
DOI Kapitel:Nachrufe
DOI Artikel:Putlitz, Gisbert zu: Peter Brix (20.10.1918-21.1.2007)
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.66959#0155
- Schmutztitel
- Titelblatt
- 5-9 Inhaltsübersicht
- 10-11 Vorstand und Verwaltung der Akademie
- 11 Personalrat der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 11 Verein zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften e.V.
- 11 Union der deutschen Akademie der Wissenschaften
- 11 Vertreter der Akademie in wissenschaftlichen Institutionen
- 12-30 Verzeichnis der Mitglieder / Tabula mortuorum
-
31-199
I. Das Geschäftsjahr 2007
- 31-59 Jahresfeier am 9. Juni 2007
-
60-114
Wissenschaftliche Sitzungen
-
60-63
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 16. Januar 2007
-
63-67
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 26. Januar 2007
-
67-71
Gesamtsitzung am 27. Januar 2007
-
71-75
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 20. April 2007
-
75-78
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 20. April 2007
- 78-80 Gesamtsitzung am 21. April 2007
- 80-81 Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 20. Juli 2007
-
82-84
Sitzung der Math.-nat. Klasse am 20. Juli 2007
-
85-98
Gesamtsitzung am 21. Juli 2007
-
98-102
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 26. Oktober 2007
- 102-104 Sitzung der Math.-nat. Klasse am 26. Oktober 2007
-
104-107
Gesamtsitzung am 27. Oktober 2007
- 107-114 Öffentliche Gesamtsitzung in Stuttgart am 15. Dezember 2007
-
60-63
Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 16. Januar 2007
-
115-131
Öffentliche Veranstaltungen
- 115-116 Wissenschaftliches Kolloquium: "Fortschritte der Archäometrie"
-
117-119
Mitarbeitervortragsreihe "Wir forschen für Sie"
- 120 Symposion "Religion und Gewalt"
- 121-124 Tagung "Wort/Bild/Zeichen - Beiträge zur Semiotik im Recht"
- 124-126 Ausstellung "Sprache - Schrift - Bild: Wege zu unserem kulturellen Gedächtnis"
- 126-130 Vortrag in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlin: Wissenschaftliche Kompetenz und politische Verantwortung
- 130-131 Präsentation "365 Orte im Land der Ideen - Die virtuelle Seidenstraße"
-
132-160
Antrittsreden
-
161-199
Nachrufe
-
200-271
II. Die Forschungsvorhaben
- 200-202 Verzeichnis der Forschungsvorhaben und der Arbeitsstellenleiter
- 202 Der Akademie zugeordnete Forschungsvorhaben
- 203-204 Patristische Kommission der Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland
-
205-271
Tätigkeitsberichte
- 205-206 1. Goethe-Wörterbuch
- 206-215 2. Radiometrische Altersbestimmung von Wasser und Sedimenten
- 215-221 3. Weltkarte der tektonischen Spannungen (Karlsruhe)
- 221-222 4. Deutsche Inschriften des Mittelalters
- 222-225 5. Deutsches Rechtswörterbuch
- 226-229 6. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch/DEAF
- 229-231 7. Wörterbuch der altgaskognischen Urkundensprache/DAG
- 231-232 8. Spanisches Wörterbuch des Mittelalters/DEM
- 232-234 9. Melanchthon-Forschungsstelle
- 234-237 10. Martin Bucers Deutsche Schrifen
- 237-241 11. Edition des Reuchlin-Briefwechsels (Pforzheim)
- 241-242 12. Luther-Register (Tübingen)
- 242-244 13. Evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts
- 244-246 14. Europa Humanistica
- 246-249 15. Epigraphische Datenbank
- 249-252 16. Edition literarischer Keilschriftentexte aus Assur
- 252-254 17. Buddhistische Steinschriften in China
- 254-255 18. Année Philologique
- 255-257 19. Lexikon der antiken Kulte und Riten (Heidelberg/Würzburg)
- 257-265 20. Felsbilder und Inschriften am Karakorum-Highway
- 265-267 21. Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jahrhundert
- 268-271 Der Akademie zugeordnete Forschungsvorhaben
-
272-338
III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- 272-280 A. Die Preisträger
-
281-338
B. Das WIN-Kolleg
- 281-282 Aufgaben und Ziele des WIN-Kollegs
- 282-284 Die Kollegiaten
- 285-287 1. Forschungsschwerpunkt "Gehirn und Geist. Physische und psychische Funktionen des Gehirns": Abschlußsymposium "Moleculed - Neurons - Mind"
- 288-305 2. Forschungsschwerpunkt "Kulturelle Grundlagen der Europäischen Einigung"
- 306-330 3. Forschungsschwerpunkt "Der menschliche Lebenszyklus - biologische, gesellschaftliche, kulturelle Aspekte"
- 331-338 C. Die Nachwuchskonferenzen
- 339-349 IV. Gesamthaushalt 2007 der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
- 340-342 Publikationen
- 343-349 Personenregister
- Maßstab/Farbkeil
168
NACHRUFE
PETER BRIX
(20.10. 1918-21.1.2007)
„Ich bin Schleswig-Holsteiner, aufgewachsen auf einer kleinen Bootswerft, außer-
halb einer kleinen Stadt“. Dort, an seinem Geburtsort Kappeln an der Schlei legte
Peter Brix 1936 sein Abitur ab, um danach in Kiel, Rochester und an der Techni-
schen Hochschule Berlin Physik zu studieren. Dem Staatsexamen (1940) folgten vier
Jahre Wehrdienst und danach (1944) eine der entscheidenden Weichenstellungen für
sein wissenschaftliches Leben, die Aufnahme in das Göttinger Institut von Hans
Kopfermann. Nach der Promotion (1946) wandte sich Brix der spektroskopischen
Untersuchung der Hyperfeinstruktur von Atomspektren zu, aus der sich die magne-
tischen und elektrischen Kernmomente, aber auch die durch die unterschiedlichen
Kernradien verursachte Isotopieverschiebung bestimmen ließen. Dabei gelang Brix
eine bedeutende und folgenreiche Entdeckung: Emen Sprung in der Isotopiever-
schiebung der beiden geraden bislang als kugelsymmetrisch angesehenen Samarium-
isotope 150 und 152. Dies ließ sich nur durch eine intrinsische, kollektive Defor-
mation dieser Kerne deuten (1947 und 1949). Die Theoretiker jener Zeit fanden
keinen Gefallen an deformierten Kernen ohne Drehimpuls, aber die dänischen
Theoretiker Aage Bohr (ein Sohn von Niels Bohr) und Ben Mottelson nahmen die
Überlegungen von Brix und Kopfermann ernst und nutzten sie für die Entwicklung
des Kollektivmodells der Atomkerne. Sie erhielten dafür den Nobelpreis.
Nach der Habilitation in Göttingen (1952) schloß sich für Peter Brix ein For-
schungsjahr bei dem späteren Nobelpreisträger Gerhard Herzberg am National
Research Council of Canada in Ottawa an, von dem er dann (1953) seinem Lehrer
Kopfermann nach Heidelberg folgte. Hier galt es, ein altes Institut neu aufzubauen
und mit moderner Wissenschaft zu füllen. Brix kümmerte sich um den Aufbau und
die Nutzung eines von Siemens zu liefernden Betatrons mit einer Elektronenener-
gie von 35 MeV. Unter den Arbeiten, die daran zum Kernphotoeffekt entstanden
NACHRUFE
PETER BRIX
(20.10. 1918-21.1.2007)
„Ich bin Schleswig-Holsteiner, aufgewachsen auf einer kleinen Bootswerft, außer-
halb einer kleinen Stadt“. Dort, an seinem Geburtsort Kappeln an der Schlei legte
Peter Brix 1936 sein Abitur ab, um danach in Kiel, Rochester und an der Techni-
schen Hochschule Berlin Physik zu studieren. Dem Staatsexamen (1940) folgten vier
Jahre Wehrdienst und danach (1944) eine der entscheidenden Weichenstellungen für
sein wissenschaftliches Leben, die Aufnahme in das Göttinger Institut von Hans
Kopfermann. Nach der Promotion (1946) wandte sich Brix der spektroskopischen
Untersuchung der Hyperfeinstruktur von Atomspektren zu, aus der sich die magne-
tischen und elektrischen Kernmomente, aber auch die durch die unterschiedlichen
Kernradien verursachte Isotopieverschiebung bestimmen ließen. Dabei gelang Brix
eine bedeutende und folgenreiche Entdeckung: Emen Sprung in der Isotopiever-
schiebung der beiden geraden bislang als kugelsymmetrisch angesehenen Samarium-
isotope 150 und 152. Dies ließ sich nur durch eine intrinsische, kollektive Defor-
mation dieser Kerne deuten (1947 und 1949). Die Theoretiker jener Zeit fanden
keinen Gefallen an deformierten Kernen ohne Drehimpuls, aber die dänischen
Theoretiker Aage Bohr (ein Sohn von Niels Bohr) und Ben Mottelson nahmen die
Überlegungen von Brix und Kopfermann ernst und nutzten sie für die Entwicklung
des Kollektivmodells der Atomkerne. Sie erhielten dafür den Nobelpreis.
Nach der Habilitation in Göttingen (1952) schloß sich für Peter Brix ein For-
schungsjahr bei dem späteren Nobelpreisträger Gerhard Herzberg am National
Research Council of Canada in Ottawa an, von dem er dann (1953) seinem Lehrer
Kopfermann nach Heidelberg folgte. Hier galt es, ein altes Institut neu aufzubauen
und mit moderner Wissenschaft zu füllen. Brix kümmerte sich um den Aufbau und
die Nutzung eines von Siemens zu liefernden Betatrons mit einer Elektronenener-
gie von 35 MeV. Unter den Arbeiten, die daran zum Kernphotoeffekt entstanden